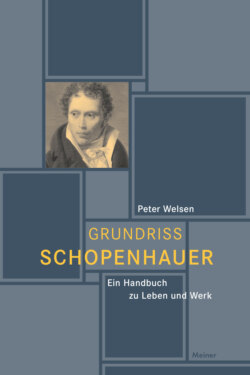Читать книгу Grundriss Schopenhauer - Peter Welsen - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Lemmata
Оглавлениеa priori In seiner von Kant inspirierten Erkenntnistheorie weist Schopenhauer dem Begriff des Apriorischen eine zentrale Rolle zu. Ähnlich wie der Königsberger Denker grenzt er apriorische Erkenntnis gegen aposteriorische ab. Während letztere ihren Geltungsgrund in der Erfahrung hat, also empirisch ist, geht erstere der Erfahrung in gewisser Hinsicht voraus. So erklärt Schopenhauer, die apriorische Erkenntnis liege »vor aller Erfahrung« (G 68; vgl. a. W I 524 sowie P I 59 u. 97) und hänge daher nicht von dieser ab (vgl. G 131 sowie W I 33, 40, 111, 117, 524 u. 537). Nach seiner Auffassung liegt vielmehr eine Abhängigkeit in umgekehrter Richtung vor. Schopenhauer knüpft expressis verbis an Kant an, dessen Position er folgendermaßen beschreibt: »Kant nun endlich versteht zuvörderst unter transscendental die Anerkennung des Apriorischen und daher bloß Formalen in unserer Erkenntniß, als eines solchen; d. h. die Einsicht, daß dergleichen Erkenntniß von der Erfahrung unabhängig sei, ja, dieser selbst die unwandelbare Regel, nach der sie ausfallen muß, vorschreibe« (P I 96 f.).1 Damit stellt die apriorische Erkenntnis eine »Bedingung[] der Möglichkeit aller Erfahrung« (G 124) dar. Ferner schließt sich Schopenhauer auch darin Kant an, daß er die apriorische Erkenntnis, sofern sie als Bedingung der Möglichkeit der Erfahrung fungiert, mit dem Ausdruck »transscendental« (G 56, W II 211 f. u. P I 96 f.) bezeichnet.2
Der Bereich des Apriorischen beinhaltet nach Kant und Schopenhauer keine materialen Erkenntnisse, sondern formale. Schopenhauer hebt wiederholt hervor, daß »das Angeborene, daher Apriorische und von der Erfahrung Unabhängige unsers gesammten Erkenntnißvermögens durchaus beschränkt ist auf den formellen Theil der Erkenntniß, d. h. auf das Bewußtseyn der selbsteigenen Funktionen des Intellekts und der Weise ihrer allein möglichen Thätigkeit, welche Funktionen jedoch sammt und sonders des Stoffs von außen bedürfen, um materielle Erkenntnisse zu liefern« (G 131; vgl. a. W I 525, W II 42 u. 211 sowie P I 95 ff. u. 106 ff.). Handelt es sich beim Apriorischen um formale Erkenntnisse bzw. formale Strukturen der Erkenntnis, die nicht in Erfahrung gründen, sondern diese ermöglichen, so bedeutet dies für Schopenhauer, daß es nicht etwa auf irgendwelche kontingenten, sondern auf die allgemeinen Bedingungen der Möglichkeit der Erkenntnis hinausläuft. Mehr noch, Schopenhauer versichert, die apriorische Erkenntnis zeichne sich durch »absolute Allgemeingültigkeit« (W II 141), »unbedingte Gewißheit« (G 59) und »größte Notwendigkeit« (W I 106) aus, die sich grundlegend von der »approximativen« und »komparativen Allgemeinheit« (W II 103 u. 141) der empirischen Erkenntnis unterscheide. Um die entsprechenden Einsichten zu charakterisieren, gebraucht er sogar den Ausdruck »aeternae veritates« (W I 524 u. P I 57). Freilich ist diese Einschätzung nicht ganz wörtlich zu nehmen. In diesem Zusammenhang macht Schopenhauer geltend, daß die apriorische Erkenntnis in gewisser Hinsicht »aus der Erfahrung geschöpft« (P I 59) ist, und stellt fest: »Ja sogar die Apriorität eines Theils der menschlichen Erkenntniß wird von ihr [der Metaphysik] als eine gegebene Thatsache aufgefaßt, aus der sie auf den subjektiven Ursprung desselben schließt.« (W II 211 f.) Gemeint ist damit, daß die apriorischen Bedingungen der Erfahrung im Ausgang von einem kontingenten Faktum, der Tatsache der Erfahrung, erschlossen werden, so daß sie nicht absolut, sondern allenfalls relativ – d. h. im Verhältnis zu diesem Faktum – notwendig wären. Daher kann man Schopenhauer durchaus folgen, wenn er erklärt, daß bereits Kant bei seiner Untersuchung der apriorischen Strukturen der Erkenntnis auf ein empirisches Fundament rekurrierte: »Kant gieng, bei seiner Nachweisung des Unzulänglichen der vernünftigen Erkenntniß zur Ergründung des Wesens der Welt, von der Erkenntniß, als einer Thatsache, die unser Bewußtseyn liefert, aus, verfuhr also, in diesem Sinne, a posteriori.« (W II 339)
Vergegenwärtigt man sich, daß Erkenntnis nach Schopenhauer ein erkennendes Subjekt voraussetzt, so erstaunt es nicht weiter, daß er den Ursprung der apriorischen Erkenntnis ebenfalls im Subjekt ansiedelt. Nun geht Schopenhauer jedoch einen Schritt weiter und behauptet mit Kant, daß »gerade die Apriorität dieser Erkenntnißformen […] nur auf dem subjektiven Ursprung derselben beruhen kann« (W I 525; vgl. a. P I 96 f.). Das ist so zu verstehen, daß Apriorität – nach Auffassung beider Philosophen – strenge Allgemeinheit und Notwendigkeit bedeutet, diese aber nicht im Bereich der äußeren Wirklichkeit, sondern lediglich im Bereich der inneren Wirklichkeit – also des erkennenden Subjekts – angetroffen werden kann. Schopenhauer gibt dieses – von Descartes beeinflußte – Argument wie folgt wieder: »Apodiktische Gewißheit kann einer Erkenntniß freilich nur ihr Ursprung a priori geben: eben dieser aber beschränkt sie auf das bloß Formelle der Erfahrung überhaupt, indem er anzeigt, daß sie durch die subjektive Beschaffenheit des Intellekts bedingt sei.« (W II 211; vgl. a. W I 537 u. 556) Ob aber der subjektive Ursprung einer Erkenntnis ausreicht, um ihre Allgemeinheit und Notwendigkeit zu sichern, und ob diese Merkmale nicht auch Entitäten zukommen können, die keine Subjekte sind, wird weder von Kant noch von Schopenhauer eingehender diskutiert.
Eine weitere, nicht zu unterschätzende Schwierigkeit liegt darin, daß Schopenhauer im Zuge seiner Erläuterung der apriorischen Erkenntnis immer wieder auf das Gehirn zu sprechen kommt. Dabei drückt er sich recht deutlich aus: »Transscendental ist die Philosophie, welche sich zum Bewußtseyn bringt, daß die ersten und wesentlichsten Gesetze dieser sich uns darstellenden Welt in unserm Gehirn wurzeln und dieserhalb a priori erkannt werden.« (P I 97) Anscheinend gelangt Schopenhauer deshalb zu dieser Einschätzung, weil er die Subjektivität der apriorischen Erkenntnis an deren Abhängigkeit vom Gehirn festmacht (vgl. W I 58, W II 29, 43, 60 u. 99 sowie P II 49 ff.). Nun ist das Gehirn sicherlich eine Bedingung der Möglichkeit menschlicher Erkenntnis und bietet sich – im Verhältnis zu dieser – durchaus als vorgängig dar, doch kann dies nicht darüber hinwegtäuschen, daß es sich beim Gehirn nicht um eine formale, sondern um eine materiale – der empirischen Wirklichkeit angehörende – Entität handelt. Beinhalten die Begriffe des Apriorischen und des Transzendentalen die Unabhängigkeit von der empirischen Wirklichkeit, so fällt das Gehirn wohl kaum darunter. Ferner wird man den Funktionen des Gehirns auch keine strenge Allgemeinheit und Notwendigkeit zuschreiben können.
Es drängt sich die Frage auf, wie Schopenhauer solch eine Verwechslung unterlaufen konnte. Auf den ersten Blick scheint es tatsächlich, als setze er menschliche Subjektivität mit dem »Erkenntnißapparat[] und seiner Einrichtung (Gehirnfunktion)« (P I 59) gleich, doch bei genauerem Hinsehen zeigt sich, daß er das Problem der Erkenntnis im Ausgang von zwei unterschiedlichen, sich ergänzenden Methoden untersucht: einer transzendentalen, idealistischen und einer physiologischen, realistischen. Je nachdem, welche Perspektive er wählt, fördert er andere Aspekte des Problems zutage. Das gilt natürlich auch für die apriorische Erkenntnis, deren Grundsätze er im zweiten Band seines Hauptwerks tabellarisch darstellt: »Nun kann man diese Tafel nach Belieben betrachten entweder als eine Zusammenstellung der ewigen Grundgesetze der Welt, mithin als die Basis einer Ontologie; oder aber als ein Kapitel aus der Physiologie des Gehirns; je nachdem, ob man den realistischen, oder den idealistischen Gesichtspunkt faßt; wiewohl der zweite in letzter Instanz Recht behält.« (W II 59)3
Vor dem Hintergrund seiner Lehre vom transzendentalen Idealismus vertritt Schopenhauer – ähnlich wie Kant – die Auffassung, die apriorische Erkenntnis habe nicht einfach nur ihren Ursprung im Subjekt, sondern gelte auch nur für das, was das Subjekt erkennen könne, also für den Bereich der Erfahrung bzw. der Erscheinung: »Denn gerade die Apriorität dieser Erkenntnißformen, da sie nur auf dem subjektiven Ursprung derselben beruhen kann, schneidet uns die Erkenntniß des Wesens an sich der Dinge auf immer ab und beschränkt uns auf eine Welt von bloßen Erscheinungen, so daß wir nicht ein Mal a posteriori, geschweige a priori, die Dinge erkennen können, wie sie an sich selbst seyn mögen.« (W I 525; vgl. a. W II 214 f. u. P I 95) Dies aber bedeutet, daß die Metaphysik nicht als apriorische Wissenschaft auftreten kann. Angesichts dieses Befundes gelangt Schopenhauer zu dem Ergebnis, sie müsse »empirische Erkenntißquellen haben« (W II 211) und nehme insofern den Rang einer »Erfahrungswissenschaft« (W II 214) ein.
Wie bieten sich nun die apriorischen Erkenntnisse im einzelnen dar? Schopenhauer ist überzeugt, daß »der Satz vom Grunde der gemeinschaftliche Ausdruck für alle diese uns a priori bewußten Formen des Objekts ist, und daß daher Alles, was wir rein a priori wissen, nichts ist, als eben der Inhalt jenes Satzes und was aus diesem folgt, in ihm also eigentlich unsre ganze a priori gewisse Erkenntniß ausgesprochen ist« (W I 32; vgl. a. W I 112 u. 588). Dieser Satz beinhaltet zum einen, daß sich im Bewußtsein stets Subjekt und Objekt gegenüberstehen, und zum anderen, daß jedes Objekt gesetzmäßig mit einem anderen Objekt verbunden ist.4 Mit anderen Worten: Schopenhauer geht von einer apriorischen Korrelation von Subjekt und Objekt sowie von apriorischen Verbindungen der Objekte untereinander aus. Was letztere betrifft, so teilt er sie in mehrere Klassen ein, denen er unterschiedliche Formen des Satzes vom Grunde zuordnet. Es handelt sich um den Satz des zureichenden Grundes des Werdens, des Erkennens, des Seins und des Wollens. Die entsprechenden apriorischen Strukturen sind die Kategorie bzw. das Gesetz der Kausalität (vgl. G 124 u. 131, W I 32, W II 46 ff. sowie P I 106 u. 108), der »formelle Theil der Erkenntniß« (G 131), die Anschauungsformen des Raumes und der Zeit (vgl. G 124 u. 131, W I 32, W II 44 ff. sowie P I 106 u. 108) sowie das Gesetz der Motivation, das lediglich eine besondere Form des Satzes vom zureichenden Grunde des Werdens darstellt (vgl. G 162). Dazu kommen die Erkenntnisse, die sich daraus ableiten lassen: die »allerersten Elemente der Naturlehre« (W II 212; vgl. a. G 60, W I 38, 86 f., 106 u. 588 sowie W II 58 ff.) sowie die Einsichten der Logik (vgl. W I 75, N 282 sowie W II 107, 141 u. 212) und Mathematik (vgl. N 282, sowie W II 107, 141 u. 212).
Ferner glaubt Schopenhauer, daß es eine – allerdings nicht formale, sondern inhaltliche – Erkenntnis des Schönen gibt, die in gewisser Hinsicht als apriorisch zu betrachten sei: »Rein a posteriori und aus bloßer Erfahrung ist gar keine Erkenntniß des Schönen möglich: sie ist immer, wenigstens zum Theil, a priori, wiewohl von ganz anderer Art, als die uns a priori bewußten Gestaltungen des Satzes vom Grunde. Diese betreffen die allgemeine Form der Erscheinung als solcher, wie sie die Möglichkeit der Erkenntiß überhaupt begründet, das allgemeine, ausnahmslose Wie des Erscheinens, und aus dieser Erkenntniß geht Mathematik und reine Naturwissenschaft hervor: jene andere Erkenntnißart a priori hingegen, welche die Darstellung des Schönen möglich macht, betrifft, statt der Form, den Inhalt der Erscheinungen, statt des Wie, das Was des Erscheinens.« (W I 282)
abstrakt Schopenhauer geht in seiner Erkenntnistheorie von einem Gegensatz zwischen abstrakten und intuitiven Vorstellungen aus. Letztere setzt er mit den Anschauungen, erstere mit den Begriffen gleich, deren Besitz den Menschen vom Tier abgrenzt und seine Vernunft ausmacht: »Der Hauptunterschied zwischen allen unsern Vorstellungen ist der des Intuitiven und Abstrakten. Letzteres macht nur eine Klasse von Vorstellungen aus, die Begriffe: und diese sind auf der Erde allein das Eigenthum des Menschen, dessen ihn von allen Thieren unterscheidende Fähigkeit zu denselben von jeher Vernunft genannt worden ist.« (W I 33; vgl. a. G 113 f., W I 66 ff., 71 u. 125 sowie W II 83) Schopenhauer betrachtet die abstrakten Vorstellungen im Vergleich zu den intuitiven insofern als abgeleitet, als sie im Ausgang von ihnen gebildet werden und ihren Inhalt von ihnen beziehen: »Wie aus dem unmittelbaren Lichte der Sonne in den geborgten Wiederschein [sic!] des Mondes, gehn wir von der anschaulichen, unmittelbaren, sich selbst vertretenden und verbürgenden Vorstellung über zur Reflexion, zu den abstrakten, diskursiven Begriffen der Vernunft, die allen Gehalt nur von jener anschaulichen Erkenntniß und in Beziehung auf dieselbe haben.« (W I 66) Dabei versteht Schopenhauer unter Reflexion eine Weise des Erkennens, die sich durch Nachträglichkeit auszeichnet, und er hebt den derivativen Charakter der Vorstellungen, mit denen sie zu tun hat, dadurch hervor, daß er sie als »Vorstellungen von Vorstellungen« einstuft: »Die Reflexion ist nothwendig Nachbildung, Wiederholung, der urbildlichen anschaulichen Welt, wiewohl Nachbildung ganz eigener Art, in einem völlig heterogenen Stoff. Deshalb sind die Begriffe ganz passend Vorstellungen von Vorstellungen zu nennen.« (W I 73; vgl. a. G 114 u. 117 sowie W I 67 f. u. 74)
Die abstrakten Vorstellungen heben sich – nach Schopenhauer – auch in folgender Hinsicht von den intuitiven ab: Zum einen besitzen sie eine »Sphäre« (G 114 u. W I 75 f.) bzw. einen »Umfang« (W II 78), das heißt, sie sind allgemein, so daß es möglich ist, eine oder mehrere5 – sei es abstrakte oder anschauliche – Vorstellungen darunter zu subsumieren, und zum anderen bleiben sie, was ihre inhaltliche Bestimmung anbelangt, hinter den intuitiven zurück. Beides hängt in der Weise miteinander zusammen, daß der Inhalt eines Begriffs mit seinem Umfang abnimmt: »Je höher man nun in der Abstraktion aufsteigt, desto mehr läßt man fallen, also desto weniger denkt man noch. Die höchsten, d. i. die allgemeinsten Begriffe sind die ausgeleertesten und ärmsten, zuletzt nur noch leichte Hülsen, wie z. B. Seyn, Wesen, Ding, Werden u. dgl. m.« (G 114 f.; vgl. a. W II 78 f. u. 87)6
Schopenhauer vertritt die Auffassung, daß Begriffe durch eine Abstraktion entstehen, die von der Vernunft geleistet wird (vgl. G 132, W I 71 sowie W II 82 f., 89 u. 225) und die einem »Abwerfen unnützen Gepäckes« (G 117 u. W II 78) gleicht. Er beschreibt diesen Vorgang wie folgt: »Denn bei ihrer Bildung zerlegt das Abstraktionsvermögen die […] vollständigen, also anschaulichen Vorstellungen in ihre Bestandtheile, um diese abgesondert, jeden für sich, denken zu können als die verschiedenen Eigenschaften, oder Beziehungen, der Dinge. Bei diesem Processe nun aber büßen die Vorstellungen nothwendig die Anschaulichkeit ein, wie Wasser, wenn in seine Bestandtheile zerlegt, die Flüssigkeit und Sichtbarkeit. Denn jede also ausgesonderte (abstrahirte) Eigenschaft läßt sich für sich allein wohl denken, jedoch darum nicht für sich allein auch anschauen. Die Bildung eines Begriffs geschieht überhaupt dadurch, daß von dem anschaulich Gegebenen Vieles fallen gelassen wird, um dann das Uebrige für sich allein denken zu können: derselbe ist also ein Wenigerdenken, als angeschaut wird. Hat man, verschiedene anschauliche Gegenstände betrachtend, von jedem etwas Anderes fallen lassen und doch bei Allen das Selbe übrig behalten; so ist dies das genus jener Species. Demnach ist der Begriff eines jeden genus der Begriff einer jeden darunter begriffenen Species, nach Abzug alles Dessen, was nicht allen Speciebus zukommt.« (G 114) Freilich bleibt bei dieser – empiristisch ausgerichteten7 – Theorie der Begriffsbildung im dunkeln, wie es der Abstraktion gelingen soll, Merkmale zu isolieren, sie zu vernachlässigen und die übriggebliebenen gemeinsamen Merkmale zu einem Begriff zusammenzufassen, ohne bereits selbst über Begriffe – nämlich jene der entsprechenden Merkmale – zu verfügen.
Anschauung Schopenhauer weist der Anschauung in seinen Überlegungen zur Erkenntnis keineswegs nur eine wichtige, sondern die entscheidende Rolle zu. Dabei geht er einen Schritt über Kant hinaus. Bekanntlich erblickt dieser – gemäß der Devise »Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind«8 – in der Erfahrung eine Synthese, in die Anschauung und Begriff in gleicher Weise eingehen. Was jedoch Schopenhauer betrifft, so schließt er sich zwar der Auffassung an, daß die Erkenntnis ihren Stoff von der Anschauung erhält, doch wertet er diese im Vergleich zum Begriff ganz erheblich auf. Dabei bezeichnet er die Anschauung häufig als intuitive Vorstellung, den Begriff hingegen als abstrakte. Sie bilden, wie nicht anders zu erwarten ist, einen Gegensatz: »Der Hauptunterschied zwischen allen unsern Vorstellungen ist der des Intuitiven und Abstrakten.« (W I 33) Dieser besteht darin, daß die Anschauung den Inhalt der Erkenntnis liefert: »Also alles Materielle in unserer Erkenntniß, d. h. Alles, was sich nicht auf die subjektive Form, selbsteigene Thätigkeitsweise, Funktion des Intellekts zurückführen läßt, mithin der gesammte Stoff derselben, kommt von außen, nämlich zuletzt aus der, von der Sinnesempfindung ausgehenden, objektiven Anschauung der Körperwelt.« (G 131 f.; vgl. a. W II 86)9 Aus diesem Grund erblickt Schopenhauer in der Anschauung den »innerste[n] Kern jeder ächten und wirklichen Erkenntniß« (W II 87; vgl. a. G 120, W II 97 sowie P II 57), ja sogar die Erkenntnis schlechthin: »Die Anschauung ist nicht nur die Quelle aller Erkenntniß, sondern sie selbst ist die Erkenntniß κατ’ εξοχην, ist allein die unbedingt wahre, die ächte, die ihres Namens vollkommen würdige Erkenntniß: denn sie allein ertheilt eigentliche Einsicht, sie allein wird vom Menschen wirklich assimilirt, geht in sein Wesen über und kann mit vollem Grunde sein heißen; während die Begriffe ihm bloß ankleben.« (W II 92) Damit will Schopenhauer zum Ausdruck bringen, daß allein die Anschauung – im Gegensatz zum Begriff – die Wirklichkeit nicht mittelbar, sondern unmittelbar präsentiert. Er nimmt einen wesentlichen Gedanken der Phänomenologie vorweg, indem er versichert: »[Sie] giebt keine Meinung, sondern die Sache selbst.« (W I 66) Unter dieser Voraussetzung ist es nur konsequent, daß Schopenhauer betont: »Alle letzte, d. h. ursprüngliche Evidenz ist eine anschauliche: dies verräth schon das Wort.« (W I 104; vgl. a. P II 57)10
Genießt die Anschauung bzw. die intuitive Vorstellung gegenüber dem Begriff bzw. der abstrakten Vorstellung den Vorrang, so liegt das zunächst daran, daß »die Begriffe ihren Stoff von der anschauenden Erkenntniß entlehnen« (W II 85; vgl. a. W I 66, 96 u. 104 sowie W II 224 f.). Schopenhauer stellt dazu fest: »In diesem Sinne können die Anschauungen recht passend primäre, Begriffe hingegen sekundäre Vorstellungen benannt werden« (W II 86; vgl. a. G 95). Darüber hinaus macht Schopenhauer – im Gegensatz zu Kant – geltend, daß es anschauliche Erkenntnis gibt, die nicht auf Begriffe angewiesen, sondern rein intuitiv ist. Dabei handelt es sich zum einen um bestimmte Formen der empirischen Erkenntnis wie die unmittelbare, nicht begrifflich fixierte Auffassung kausaler Verhältnisse (vgl. G 92 ff.) und zum andern um die Erkenntnis des Wesens der Dinge bzw. der Ideen, die Schopenhauer als die »höchste[] dem Menschen erreichbare[]« (W II 96; vgl. a. W II 441 f.) betrachtet. Mit anderen Worten, der Primat der Anschauung beruht auch darauf, daß sie – anders als noch bei Kant – nicht etwa für sich genommen »blind« ist, sondern bereits Erkenntnis liefert.11 Da nun die Anschauung einen unmittelbaren Zugang zur Wirklichkeit – und damit Erkenntnis aus erster Hand – ermöglicht, ist es nicht weiter erstaunlich, daß Schopenhauer die bedeutendsten kognitiven Leistungen, zu denen ein Mensch fähig ist, auf sie zurückführt: »Weisheit und Genie, diese zwei Gipfel des Parnassus menschlicher Erkenntniß, wurzeln nicht im abstrakten, diskursiven, sondern im anschauenden Vermögen.« (W II 90; vgl. a. W II 93, 96 u. 445 ff.)
Ähnlich wie Kant unterscheidet auch Schopenhauer zwischen einer reinen, apriorischen und einer empirischen Anschauung. Während die erstere auf die beiden Formen der Anschauung, Raum und Zeit, beschränkt ist, zeichnet sich letztere dadurch aus, daß sie darüber hinaus einen Inhalt bzw. eine Materie besitzt: »Was diese Klasse von Vorstellungen, in welcher Raum und Zeit rein angeschaut werden, von der ersten Klasse, in der sie […] wahrgenommen werden, unterscheidet, das ist die Materie« (G 147). Demnach bietet sich die empirische Anschauung – im Gegensatz zur reinen – nicht als formal, sondern als material dar. Was ihre Differenz zur reinen Anschauung ausmacht, ist ihr Stoff, der seinerseits zwei Komponenten aufweist. Es handelt sich um die Empfindung und die Kategorie der Kausalität, die erforderlich ist, um die Wahrnehmung eines Gegenstandes zu ermöglichen. So erklärt Schopenhauer, »daß was zur reinen Anschauung des Raumes und der Zeit hinzukommt, wenn aus ihr eine empirische wird, einerseits die Empfindung und andererseits die Erkenntniß der Kausalität ist, welche die bloße Empfindung in objektive empirische Anschauung verwandelt« (W I 553). Ein wesentlicher Einwand, den Schopenhauer gegen Kant erhebt, läuft darauf hinaus, daß er die Beteiligung der Kategorie der Kausalität bei der Entstehung der empirischen Anschauung bzw. Wahrnehmung übersehen habe (vgl. G 96 ff. sowie W I 538 f., 545 f., 548 u. 553).
Angesichts der Tatsache, daß mit der Kategorie der Kausalität eine Funktion, die nicht der Sinnlichkeit, sondern dem Verstand angehört, in die empirische Anschauung eingeht, läßt sich ohne weiteres nachvollziehen, daß Schopenhauer auf deren »Intellektualität« (G 66 ff.) besteht. Ist davon die Rede, daß »unsere Anschauung der Außenwelt nicht bloß sensual, sondern hauptsächlich intellektual […] ist« (P I 250), so klingt das zunächst, als begebe er sich in die Nähe eines Fichte oder Schelling, die ebenfalls auf eine Instanz rekurrieren, die sie als intellektuale oder intellektuelle Anschauung bezeichnen. Freilich meinen sie damit eine Art übersinnlicher Anschauung, deren Gegenstand das Ich oder das Absolute ist. Gegen diese Konzeption grenzt sich Schopenhauer energisch ab: »Was übrigens mich betrifft, so muß ich bekennen, daß ich ebenfalls jene das Uebersinnliche, das Absolutum, nebst langen Geschichten, die sich mit demselben zutragen, unmittelbar wahrnehmende, oder auch vernehmende, oder intellektual anschauende Vernunft mir, in meiner Beschränktheit, nicht anders faßlich und vorstellig machen kann, als gerade so, wie den sechsten Sinn der Fledermäuse.« (W I 635; vgl. a. G 128 f. u. 139 f., W I 17, 55 f., 515, 591 f. u. 623, W II 217 u. 224 sowie P II 17) Schopenhauer begründet seine Einschätzung damit, daß sich die Einsichten, die auf die intellektuelle Anschauung zurückgehen, einer objektiven Überprüfung entziehen und daher »subjektiv, individuell und […] problematisch« (W II 217) sind. Letztlich handle es sich um ein Mittel, um die »fixirten Favoritideen« (W I 635) des jeweiligen Denkers zu rechtfertigen.
Es wurde bereits angedeutet, daß Schopenhauer die empirische Anschauung bzw. die Wahrnehmung als »intellektual« betrachtet. In diesem Zusammenhang geht er von einer grundlegenden »Kluft zwischen Empfindung und Anschauung« (G 68) aus. Diese besteht darin, daß die Empfindung subjektiv und die Anschauung objektiv ist, und zwar insofern, als nur letztere, nicht aber erstere Gegenstände präsentiert. Die Empfindung hingegen erschöpft sich in einem Reiz in den Sinnesorganen, der nach Schopenhauer »nichts mehr [ist], als ein lokales, specifisches, innerhalb seiner Art einiger Abwechslung fähiges, jedoch an sich selbst stets subjektives Gefühl, welches als solches gar nichts Objektives, also nichts einer Anschauung Aehnliches enthalten kann« (G 67; vgl. a. W I 39). Allerdings stellt die Empfindung die »Data« (G 72, W I 39 u. W II 48) bzw. den »Stoff« (G 68 u. P I 108) der Erfahrung dar. Um nun die Entstehung der empirischen Anschauung im Ausgang von der Empfindung einsichtig zu machen, nimmt Schopenhauer an, daß letztere von einer Instanz, die er als »Verstand« bezeichnet, zu ersterer transformiert werde: »Die Sinne nämlich liefern nichts weiter, als den rohen Stoff, welchen allererst der Verstand […] in die objektive Auffassung einer gesetzmäßig geregelten Körperwelt umarbeitet.« (G 68; vgl. a. P I 250) Dies geschehe dergestalt, daß das erkennende Subjekt die Empfindung als Wirkung eines äußeren, seinen Leib affizierenden Gegenstandes auffasse, den es vermittels seines Verstandes bzw. der Kategorie der Kausalität – als außerhalb des Leibes im Raum situierten – konstruiere. Auf diese Weise gelange das Subjekt zu einer objektiven, den affizierenden Gegenstand darbietenden Anschauung. Schopenhauer beschreibt diesen Vorgang wie folgt: »Erst wenn der Verstand […] in Thätigkeit geräth und seine einzige und alleinige Form, das Gesetz der Kausalität, in Anwendung bringt, geht eine mächtige Verwandlung vor, indem aus der subjektiven Empfindung die objektive Anschauung wird. Er nämlich faßt, vermöge seiner selbsteigenen Form, also a priori, d. i. vor aller Erfahrung […], die gegebene Empfindung des Leibes als eine Wirkung auf […], die als solche nothwendig eine Ursache haben muß. Zugleich nimmt er die ebenfalls im Intellekt […] prädisponirt liegende Form des äußern Sinnes zu Hülfe, den Raum, um jene Ursache außerhalb des Organismus zu verlegen: denn dadurch erst entsteht ihm das Außerhalb, dessen Möglichkeit eben der Raum ist; so daß die reine Anschauung a priori die Grundlage der empirischen abgeben muß. Bei diesem Proceß nimmt nun der Verstand […] alle, selbst die minutiösesten Data der gegebenen Empfindung zu Hülfe, um, ihnen entsprechend, die Ursache derselben im Raume zu konstruiren.« (G 67 f.; vgl. a. W I 39 u. 539, E 65 f., W II 31, 48 u. 322 sowie P I 250) Der Übergang von der Empfindung zur Anschauung ist nach Schopenhauer ein unmittelbarer, das heißt, er ist nicht auf eine Vermittlung durch Begriffe angewiesen: »Diese […] Verstandesoperation ist […] keine diskursive, reflektive, in abstracto, mittels Begriffen und Worten, vor sich gehende; sondern eine intuitive und ganz unmittelbare.« (G 68; vgl. a. W I 39)
Anthropologie Auf den ersten Blick könnte der Eindruck entstehen, die Anthropologie spiele bei Schopenhauer keine wichtige Rolle. Das liegt daran, daß er lediglich an wenigen Stellen auf diese Disziplin eingeht. Nach seiner Auffassung handelt es sich dabei weniger um eine eigenständige Wissenschaft als um mehrere empirische Disziplinen, die sich unter der Voraussetzung, daß sie den Menschen zum Gegenstand haben, als Anthropologie darbieten. Schopenhauer greift in verschiedenen Teilen seines Werks auf ihre Ergebnisse zurück: »Hingegen Anthropologie, als Erfahrungswissenschaft, läßt sich aufstellen, ist aber theils Anatomie und Physiologie, – theils bloße empirische Psychologie, d. i. aus der Beobachtung geschöpfte Kenntniß der moralischen und intellektuellen Aeußerungen und Eigenthümlichkeiten des Menschengeschlechts, wie auch der Verschiedenheit der Individualitäten in dieser Hinsicht. Das Wichtigste daraus wird jedoch nothwendig, als empirischer Stoff, von den drei Theilen der Metaphysik vorweggenommen und bei ihnen verarbeitet.« (P II 27; vgl. a. HN III 253) Dem ist hinzuzufügen, daß sich Schopenhauer nicht bloß in den metaphysischen Partien seines Ansatzes (Naturphilosophie, Ästhetik, Ethik), sondern darüber hinaus auch in seiner Erkenntnistheorie immer wieder anthropologische Beobachtungen zunutze macht. Mehr noch, er nimmt dabei eine Reihe interessanter Einsichten der philosophischen Anthropologie des 20. Jahrhunderts vorweg (z. B. die Anpassung von Instinkt und organischer Ausstattung an die Umwelt, die Rolle der Sprache in Hinblick auf den Unterschied von Mensch und Tier, die Überwindung des cartesianischen Dualismus).12
Apperzeption Während Schopenhauer den Begriff der Apperzeption im Rahmen seines eigenen Ansatzes eher selten gebraucht, geht er ihm anläßlich seiner Auseinandersetzung mit Kant ausführlicher nach. Systematisch ist dieser Begriff insofern von Interesse, als er – im Gegensatz zu jenem des Selbstbewußtseins – bei Schopenhauer nicht etwa nur einen Teil des Bewußtseins, die Willensakte, sondern das ganze Bewußtsein umfaßt. Damit bietet sich die Apperzeption als Selbstbewußtsein im weitesten Sinne dar, während das, was Schopenhauer als Selbstbewußtsein bezeichnet, keineswegs alle Vorstellungen, sondern lediglich die Willensakte und nicht die Vorstellungen der äußeren Dinge zum Gegenstand hat.
Ähnlich wie Kant möchte Schopenhauer klären, wie es dem erkennenden Subjekt möglich ist, den »erfahrungsmäßigen Komplex des Ganzen und seinen Verlauf« (P I 190) zu überblicken, das heißt, er versucht die Frage nach der »Identität« bzw. der »Einheit des Bewußtseyns« (W I 61; vgl. a. W II 162 u. 293) zu klären. Nach seiner Auffassung gründet diese im »logische[n]« bzw. »theoretische[n] Ich«, das als »Einheitspunkt« oder »Träger des ganzen Bewußtseyns« (W II 293) fungiere. Genau diese Instanz setzt nun Schopenhauer mit der »synthetischen Einheit der Apperception« (W I 554, W II 162 u. 293 sowie P I 190) gleich. Allerdings ist er insofern etwas ungenau, als das logische oder theoretische Ich lediglich dem erkennenden Subjekt entspricht. Unter der Apperzeption wäre hingegen die apriorische Vertrautheit mit sich selbst zu verstehen, mit der es ausgestattet ist, und unter der synthetischen Einheit der Apperzeption deren spezifische Einheit, die etwa von der analytischen zu unterscheiden wäre.13 Von der Sache her stimmt Schopenhauer darin mit Kant überein, daß sich das erkennende Subjekt gegenüber dem Mannigfaltigen der Vorstellungen als einheitliches durchhält und daß es dies auch weiß. Er folgt ihm auch darin, daß dieses Wissen nicht explizit zu sein braucht, wohl aber jeder Erkenntnis implizit zugrunde liegt: »Auf den Einwand: ›Ich erkenne nicht nur, sondern ich weiß doch auch, daß ich erkenne‹, würde ich antworten: Dein Wissen von deinem Erkennen ist von deinem Erkennen nur im Ausdruck unterschieden.« (G 158)14
Ein wesentlicher Unterschied zu Kant besteht darin, daß Schopenhauer die Apperzeption nicht nur aus transzendentalphilosophischer, sondern auch aus physiologischer und willensmetaphysischer Sicht thematisiert. So bezeichnet er die synthetische Einheit der Apperzeption immer wieder als »Brennpunkt« oder »Fokus der Gehirnthätigkeit« (W I 554 sowie W II 293, 324 f. u. 585). Mehr noch, er vertritt die Auffassung, die transzendentalphilosophische Theorie der Apperzeption leide an einem entscheidenden Defizit und bedürfe – zusätzlich zu einer physiologischen – auch noch einer willensmetaphysischen Fundierung: »Kants Satz: ›das Ich denke muß alle unsere Vorstellungen begleiten‹, ist unzureichend: denn das Ich ist eine unbekannte Größe, d. h. sich selber ein Geheimniß. – Das, was dem Bewußtseyn Einheit und Zusammenhang giebt, indem es, durchgehend durch dessen sämmtliche Vorstellungen, seine Unterlage, sein bleibender Träger ist, kann nicht selbst durch das Bewußtseyn bedingt, mithin keine Vorstellung seyn: vielmehr muß es das Prius des Bewußtseyns und die Wurzel des Baumes seyn, davon jenes die Frucht ist. Dieses, sage ich, ist der Wille: er allein ist unwandelbar und schlechthin identisch, und hat, zu seinen Zwecken, das Bewußtseyn hervorgebracht.« (W II 162) In diesem Zusammenhang vergleicht Schopenhauer das transzendentale Subjekt mit dem Fokus eines Hohlspiegels und das Gehirn bzw. den Willen mit ihm selbst: »Wie aber der Fokus eines Brennglases oder eines Hohlspiegels sehr täuschend als ein reales, ja materielles Objekt vor uns schwebt; so auch das Ich. Ohne dies Ich giebt es jedoch kein Bewußtseyn; wie der Hohlspiegel kein Bild giebt, wenn sich nicht seine Stralen zum Fokus vereinigen können. Der Hohlspiegel selbst aber wäre der Leib oder der Wille, die im Grunde identisch sind« (HN IV/1 28 Anm.).15 Dabei zeichnen sich der Leib und der Wille gegenüber dem Subjekt des Erkennens dadurch aus, daß sie nichts Formales, sondern etwas Reales sind. Während ersterer der – im Rahmen des transzendentalen Idealismus als Erscheinung gedeuteten – empirischen Wirklichkeit angehört, ist letzterer das metaphysisch wirkliche Ding an sich. Mit anderen Worten, das erkennende Subjekt bzw. die transzendentale Apperzeption gewährleisten die Einheit des Bewußtseins lediglich formaliter, nicht aber realiter, und sind deshalb auf den Leib sowie den Willen angewiesen.
Askese Schopenhauer versteht unter Askese die »vorsätzliche Brechung des Willens, durch Versagung des Angenehmen und Aufsuchen des Unangenehmen, die selbstgewählte büßende Lebensart und Selbstkasteiung, zur anhaltenden Mortifikation des Willens« (W I 484 f.). Das genannte Ziel soll durch ein Verhalten erreicht werden, das mit einer Verneinung des Willens zum Leben einhergeht. Dazu zählen der Verzicht auf geschlechtliche Betätigung und Besitz, die Einschränkung und Vernachlässigung leiblicher Bedürfnisse durch Fasten und Kasteiung sowie schließlich die gelassene Annahme des Todes. Entscheidend ist für Schopenhauer, daß diesen Verhaltensweisen eine entsprechende, auf die Verneinung des Willens zum Leben abzielende Einstellung zugrunde liegt. Obgleich die Askese in dieser Hinsicht über die moralischen Tugenden hinausgehe, seien diese ein »Beförderungsmittel der Selbstverleugnung« (W II 709) und könnten – bei konsequenter Ausübung – der Askese durchaus recht nahekommen (vgl. W II 710). Schopenhauer vertritt die Auffassung, daß asketisches Verhalten keineswegs nur als unangenehm empfunden wird, sondern er betont: »[S]o ist dagegen Der, in welchem die Verneinung des Willens zum Leben aufgegangen ist, so arm, freudelos und voll Entbehrungen sein Zustand, von außen gesehn, auch ist, voll innerer Freudigkeit und wahrer Himmelsruhe.« (W I 482)
metaphysisches Bedürfnis Schopenhauer schreibt dem Menschen im Gegensatz zum Tier ein metaphysisches Bedürfnis zu, das er als »unvertilgbar« (G 139) im Sinne eines irreduziblen Wesensmerkmals betrachtet. Zunächst äußert sich dieses Bedürfnis darin, daß der Mensch sein Dasein nicht als selbstverständlich hinnimmt, sondern – gerade angesichts der negativen Aspekte desselben wie z. B. der »Vergeblichkeit alles Strebens« (W II 187), des Leidens sowie des Todes (vgl. W II 187 f. u. 543) – darüber erstaunt und nachzudenken beginnt. Stellt man in Rechnung, daß Schopenhauer im Menschen eine Erscheinung des Willens als Ding an sich erblickt, so läßt sich nachvollziehen, wenn er erklärt, das »innere Wesen der Natur« komme »beim Eintritt der Vernunft, also im Menschen, zum ersten Male zur Besinnung« (W II 186). Freilich bleibe der Mensch nicht beim Erstaunen stehen, sondern er verlange nach einer Antwort auf die Frage, wer er sei und was es mit ihm – sowie der Welt, in der er sein Dasein friste – insgesamt auf sich habe. Genauer gesagt habe der Mensch das Bedürfnis, eine metaphysische Antwort auf seine Frage zu erhalten. In diesem Zusammenhang erklärt Schopenhauer: »Unter Metaphysik verstehe ich jede angebliche Erkenntniß, welche über die Möglichkeit der Erfahrung, also über die Natur, oder die gegebene Erscheinung der Dinge, hinausgeht, um Aufschluß zu ertheilen über Das, wodurch jene, in einem oder dem andern Sinne, bedingt wäre; oder, populär zu reden, über Das, was hinter der Natur steckt und sie möglich macht.« (W II 191) Angesichts der Tatsache, daß sich der Mensch – und allein dieser – durch ein Bedürfnis nach Metaphysik auszeichnet, stuft ihn Schopenhauer als animal metaphysicum (vgl. W II 187) ein.
Befriedigung Der Begriff der Befriedigung nimmt in Schopenhauers Ausführungen zum Willen eine zentrale Stellung ein. Befriedigung tritt – nach seiner Auffassung – dann ein, wenn eine Begierde oder ein Wunsch erfüllt oder ein Schmerz beseitigt ist. Während der Zustand, in welchem die Begierde oder der Wunsch unerfüllt sind, als schmerzhaft erlebt wird, trifft auf den umgekehrten Zustand das Gegenteil zu. Was beiden Zuständen letztlich zugrunde liegt, ist der Wille, der im einen Fall an sein Ziel gelangt und im anderen daran gehindert wird, es zu erreichen. In diesem Sinn stellt Schopenhauer fest: »Wir haben längst dieses den Kern und das Ansich jedes Dinges ausmachende Streben als das selbe und nämliche erkannt, was in uns, wo es sich am deutlichsten, am Lichte des vollesten Bewußtseyns manifestirt, Wille heißt. Wir nennen dann seine Hemmung durch ein Hindernis, welches sich zwischen ihn und sein einstweiliges Ziel stellt, Leiden; hingegen sein Erreichen des Ziels Befriedigung, Wohlseyn, Glück.« (W I 387)
Schopenhauer charakterisiert die Befriedigung als negativ, den Wunsch hingegen, der ihr vorangeht, als positiv. Das liegt daran, daß er glaubt, Befriedigung könne nicht stattfinden, ohne daß zunächst ein entsprechender Wunsch gegeben sei: »Alle Befriedigung, oder was man gemeinhin Glück nennt, ist eigentlich und wesentlich immer nur negativ und durchaus nie positiv. Es ist nicht eine ursprünglich und von selbst auf uns kommende Beglückung, sondern muß immer die Befriedigung eines Wunsches seyn. Denn Wunsch, d. h. Mangel, ist die vorhergehende Bedingung jedes Genusses.« (W I 399) Aber auch in anderer Hinsicht stuft Schopenhauer die Befriedigung als negativ ein. Es handelt sich darum, daß der Schmerz eher auffällt und intensiver erlebt wird als der Zustand der Befriedigung, der oftmals erst dann ins Bewußtsein tritt, wenn er beendet ist.
Schopenhauer schätzt die Aussichten, einen Zustand dauerhafter Befriedigung zu erreichen, als gering ein. So legt er dar, daß mit jedem erfüllten Wunsch zahlreiche andere Wünsche offenbleiben, daß die Begierde länger anhält als die Befriedigung derselben und daß sich nach der Erfüllung einer Begierde sogleich eine neue oder aber Langeweile einstellt (vgl. W I 252 u. 400 f.). Schopenhauer erklärt sogar, daß »das Wesen des Menschen darin besteht, daß sein Wille strebt, befriedigt wird und von Neuem strebt, und so immerfort, ja, sein Glück und Wohlseyn nur Dieses ist, daß jener Uebergang vom Wunsch zur Befriedigung und von dieser zum neuen Wunsch rasch vorwärts geht, da das Ausbleiben der Befriedigung Leiden, das des neuen Wunsches leeres Sehnen, languor, Langeweile ist« (W I 326 f.). Angesichts der Tatsache, daß sich der Mensch von der Befriedigung eines Wunsches mehr erwartet, als diese einzulösen vermag, bietet sie sich – so Schopenhauer – tatsächlich als ein »beschämender Irrthum« (W I 398) dar.
Begriff Schopenhauer versteht unter einem Begriff – im Gegensatz zu einer anschaulichen, intuitiven Vorstellung – eine abstrakte Vorstellung. Nach seiner Auffassung sind beide Arten von Vorstellungen geradezu »toto genere verschiedene« (W I 71). Ein Begriff ist insofern nicht intuitiv, als er keine – sei es reine oder empirische – Anschauung enthält16, und er ist insofern abstrakt, als er aus einer Abstraktion von einer anschaulichen Vorstellung hervorgeht. In diesem Zusammenhang ordnet Schopenhauer dem Begriff das Erkenntnisvermögen der Vernunft zu, durch welches sich der Mensch gegenüber dem Tier auszeichne: »Der allein wesentliche Unterschied zwischen Mensch und Thier, den man von jeher einem, Jenem ausschließlich eigenen und ganz besonderen Erkenntnißvermögen, der Vernunft, zugeschrieben hat, beruht darauf, daß der Mensch eine Klasse von Vorstellungen hat, deren kein Thier theilhaft ist: es sind die Begriffe, also die abstrakten Vorstellungen; im Gegensatz der anschaulichen, aus welchen jedoch jene abgezogen sind.« (G 113; vgl. a. W I 33 u. 68 sowie W II 72) Die Tätigkeit der Vernunft bezeichnet Schopenhauer als »Denken« (G 117) oder »Reflexion« (G 117 sowie W I 66, 68 u. 73).
Dabei bringt der Terminus »Reflexion« – nach seiner Auffassung – den abgeleiteten Charakter des Begriffs zum Ausdruck: »Die Reflexion ist nothwendig Nachbildung, Wiederholung, der urbildlichen anschaulichen Welt, wiewohl Nachbildung ganz eigener Art, in einem völlig heterogenen Stoff.« (W I 73) Daher nennt Schopenhauer die Begriffe auch »Vorstellungen aus Vorstellungen« (G 114 u. W I 73 f.) und stuft sie im Verhältnis zu den Anschauungen, die »primäre [Vorstellungen]« seien, als »sekundäre Vorstellungen« (W II 86) ein. Diese Rangordnung beruht darauf, daß Begriffe ihren Inhalt letztlich der Anschauung verdanken, ja ohne diese gar keinen Inhalt besäßen: »Wie aus dem unmittelbaren Lichte der Sonne in den geborgten Wiederschein [sic!] des Mondes, gehn wir von der anschaulichen, unmittelbaren, sich selbst vertretenden und verbürgenden Vorstellung über zur Reflexion, zu den abstrakten, diskursiven Begriffen der Vernunft, die allen Gehalt nur von jener anschaulichen Erkenntniß und in Beziehung auf dieselbe haben.« (W I 66; vgl. a. W I 86 u. 137 sowie W II 85 f.) Vor diesem Hintergrund wird auch verständlich, warum Schopenhauer glaubt, neue, die Erkenntnis bereichernde Einsichten ließen sich nicht aus dem Begriff, sondern lediglich aus der Anschauung entnehmen (vgl. W II 78). Damit bleibt die Aufgabe der Reflexion darauf beschränkt, den Inhalt, den ihr die Anschauung präsentiert, zu verarbeiten. Schopenhauer formuliert das wie folgt: »Da nun aber die Vernunft immer nur das anderweitig Empfangene wieder vor die Erkenntniß bringt, so erweitert sie nicht eigentlich unser Erkennen, sondern giebt ihm bloß eine andere Form. Nämlich was intuitiv, was in concreto erkannt wurde, läßt sie abstrakt und allgemein erkennen.« (W I 89)
Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, daß Schopenhauer der Vernunft in Hinblick auf die Begriffe zwei unterschiedliche Aufgaben zuweist. Die erste, grundlegendere besteht darin, die Begriffe im Ausgang von der Anschauung zu bilden, und zwar mit Hilfe ihrer Fähigkeit, abstrakt zu denken bzw. zu abstrahieren: »Unsere Vernunft, oder das Denkvermögen, hat […] zu ihrem Grundwesen das Abstraktionsvermögen, oder die Fähigkeit, Begriffe zu bilden« (G 116; vgl. a. W I 71 u. W II 80).17 Schopenhauer beschreibt die Leistung, welche die Vernunft dabei vollbringt, mit folgenden Worten: »[D]as Abstraktionsvermögen [zerlegt] die […] vollständigen, also anschaulichen Vorstellungen in ihre Bestandtheile, um diese abgesondert, jeden für sich, denken zu können als die verschiedenen Eigenschaften, oder Beziehungen, der Dinge. Bei diesem Processe nun aber büßen die Vorstellungen nothwendig die Anschaulichkeit ein […]. Denn jede also ausgesonderte (abstrahirte) Eigenschaft läßt sich für sich allein wohl denken, jedoch darum nicht für sich allein auch anschauen. Die Bildung eines Begriffs geschieht überhaupt dadurch, daß von dem anschaulich Gegebenen Vieles fallen gelassen wird, um dann das Uebrige für sich allein denken zu können: derselbe ist also ein Wenigerdenken, als angeschaut wird. Hat man, verschiedene anschauliche Gegenstände betrachtend, von jedem etwas Anderes fallen lassen und doch bei Allen das Selbe übrig behalten; so ist dies das genus jener Species. Demnach ist der Begriff eines jeden genus der Begriff einer jeden darunter begriffenen Species, nach Abzug alles Dessen, was nicht allen Speciebus zukommt.« (G 114) Es liegt auf der Hand, daß die Eigenschaften, die im Laufe dieses Verfahrens abgelegt werden, nicht wesentlich, jene hingegen, die festgehalten werden und in den Begriff eingehen, wesentlich – also konstitutiv für das entsprechende genus – sind: »Aber nicht das Angeschaute, noch das dabei Empfundene, bewahrt der Begriff auf, sondern dessen Wesentliches, Essentielles, in ganz veränderter Gestalt, und doch als genügenden Stellvertreter Jener.« (W II 77) Vergegenwärtigt man sich, daß im Zuge der Abstraktion die unwesentlichen Eigenschaften des anschaulich Gegebenen beiseite gelassen werden, so leuchtet durchaus ein, daß Schopenhauer erklärt, die Bildung von Begriffen gehe mit einem »Abwerfen unnützen Gepäkkes« (G 117 u. W II 78) einher.
Die zweite, auf der ersten aufbauende Aufgabe der Vernunft erblickt Schopenhauer darin, die im Ausgang von der Anschauung gebildeten Begriffe zu gebrauchen. Das geschieht etwa dann, wenn Begriffe zu Urteilen oder Urteile zu Schlüssen zusammengefügt werden. So legt Schopenhauer dar, daß das »Denken im engern Sinne« oder »eigentliche Denken« (G 121, W I 80 sowie W II 130) im Urteilen und – darauf aufbauend – im Schließen besteht. Damit nun diese Operationen stattfinden können, ist es – nach Schopenhauer – erforderlich, daß die Begriffe mit Hilfe eines sinnlichen Zeichens – das heißt eines Wortes oder auch eines Phantasiebildes – fixiert werden: »Da nun […] die, zu abstrakten Begriffen sublimirten und dabei zersetzten Vorstellungen alle Anschaulichkeit eingebüßt haben; so würden sie dem Bewußtseyn ganz entschlüpfen und ihm zu den damit beabsichtigten Denkoperationen gar nicht Stand halten; wenn sie nicht durch willkürliche Zeichen sinnlich fixirt und festgehalten würden: dies sind die Worte.« (G 115; vgl. a. W II 80)18 Dies bedeutet, daß Schopenhauer die Sprache nicht als für die Begriffsbildung entscheidend betrachtet, sondern darin lediglich ein Mittel erblickt, den von der Sprache unabhängigen Begriff sinnlich zu repräsentieren. Obgleich er – aus pragmatischen Erwägungen – von einer »enge[n] Verbindung des Begriffs mit dem Wort, also der Sprache mit der Vernunft« (W II 80) ausgeht, ja sogar betont, daß der Begriff »an das Wort gebunden ist« (W II 77), gilt für ihn: »Dennoch ist der Begriff sowohl von dem Worte, an welches er geknüpft ist, als auch von den Anschauungen, aus denen er entstanden, völlig verschieden. Er ist ganz anderer Natur, als diese Sinneseindrücke.« (ebd.)19
Hält man sich vor Augen, daß im Begriff die wesentlichen Eigenschaften anschaulich gegebener Inhalte zusammengefaßt sind, so läßt sich nachvollziehen, daß ihn Schopenhauer als »Allgemeines« (G 114 u. 117 f.) charakterisiert. Demnach fungiert der Begriff als übergeordnete Gattung (oder genus), unter die, wie bereits angedeutet wurde, mehrere untergeordnete Spezies fallen können. Dies bedeutet, daß er einen »Umfang« oder eine »Sphäre« (G 114 u. W I 74 ff.) besitzt, die eine oder mehrere Entitäten geringerer Allgemeinheit in sich faßt. Dabei hebt Schopenhauer hervor, daß es in Hinblick auf die Allgemeinheit des Begriffs nicht entscheidend ist, daß er sich tatsächlich auf mehrere Entitäten bezieht, sondern lediglich, daß er über die Möglichkeit verfügt, dies zu tun: »Allein dies Gelten von mehreren Dingen ist keine wesentliche, sondern nur accidentale Eigenschaft des Begriffs. Es kann daher Begriffe geben, durch welche nur ein einziges reales Objekt gedacht wird, die aber deswegen doch abstrakt und allgemein […] sind […]. Nicht also weil ein Begriff von mehreren Objekten abstrahirt ist, hat er Allgemeinheit; sondern umgekehrt, weil Allgemeinheit, d. i. Nichtbestimmung des Einzelnen, ihm als abstrakter Vorstellung der Vernunft wesentlich ist, können verschiedene Dinge durch den selben Begriff gedacht werden.« (W I 74 f.) Angesichts der Tatsache, daß die Allgemeinheit eines Begriffs in dem Maße zunimmt, in dem Eigenschaften ausgeklammert werden, ist Schopenhauer darin zuzustimmen, daß Begriffe, je abstrakter sie sind, desto weniger Inhalt besitzen: »Die höchsten, d. i. die allgemeinsten Begriffe sind die ausgeleertesten und ärmsten, zuletzt nur noch leichte Hülsen, wie z. B. Seyn, Wesen, Ding, Werden u. dgl. m.« (G 115) Begriffe dieser Art begeben sich – nach seiner Einschätzung – in bedenkliche Nähe zu »bloße[m] Wortkram« (W II 78) und ähneln »Wolkengebilden ohne Realität« (W II 87). Besonders fatal wirkt sich ihr Gebrauch, wie Schopenhauer beobachtet, in der Philosophie aus: »Wenn ich daher solche moderne Philosopheme lese, die sich in lauter sehr weiten Abstraktis fortbewegen; so kann ich bald, trotz aller Aufmerksamkeit, fast nichts mehr dabei denken; weil ich eben keinen Stoff zum Denken erhalte, sondern mit lauter leeren Hülsen operiren soll […]. Wer dies erfahren will, lese die Schriften der Schellingianer und, noch besser, der Hegelianer.« (W II 79)
Schopenhauer grenzt den Begriff nicht nur vom Wort, sondern auch von zwei weiteren Arten von Vorstellungen ab. Zum einen handelt es sich um das Phantasma, zum anderen um die Idee. Ähnlich wie das Wort fungiere das Phantasma als »Repräsentant eines Begriffs«, doch im Gegensatz zu diesem liege mit dem Phantasma eine Vorstellung von etwas Einzelnem vor, die dem Begriff – als Vorstellung von etwas Allgemeinem – »nicht adäquat«, ja sogar »nie adäquat« sei (G 118 f. u. W I 72). Im Gegensatz zum Phantasma sei die Idee zwar eine allgemeine Vorstellung, doch sie unterscheide sich darin vom Begriff, daß sie nicht abstrakt, sondern konkret sei. Angesichts der Allgemeinheit, die Begriff und Idee gemeinsam haben, erblickt Schopenhauer in der Idee einen adäquaten Repräsentanten des Begriffs: »Der Begriff ist abstrakt, diskursiv, innerhalb seiner Sphäre völlig unbestimmt, nur ihrer Gränze nach bestimmt […]. Die Idee dagegen, allenfalls als adäquater Repräsentant des Begriffs zu definiren, ist durchaus anschaulich und, obwohl eine unendliche Menge einzelner Dinge vertretend, dennoch durchgängig bestimmt« (W I 296).
Schopenhauer begnügt sich keineswegs mit einer erkenntnistheoretischen Erläuterung des Begriffs, sondern äußert sich – etwa im § 27 der Abhandlung über den Satz vom Grunde – über den »Nutzen der Begriffe«. Er erblickt diesen zunächst darin, daß sich der Mensch mit Hilfe des Begriffs über das an die Gegenwart gebundene anschaulich Gegebene erheben und sich Abwesendem sowie Vergangenem und Zukünftigem zuwenden kann. Aufgrund seiner – ihn vor dem Tier auszeichnenden – Fähigkeit, Begriffe zu gebrauchen, »kann er Unterschiede jeder Art, also auch die des Raumes und der Zeit, beliebig fallen lassen, wodurch er, in Gedanken, die Uebersicht der Vergangenheit und Zukunft, wie auch des Abwesenden, erhält; während das Thier in jeder Hinsicht an die Gegenwart gebunden ist« (G 117; vgl. a. W I 68 sowie W II 72 u. 77). Könne sich der Mensch von der Gegenwart lösen, so bedeute dies, daß er zwischen mehreren Motiven abwägen, sein Handeln nach Plänen ausrichten und sogar an seinen Tod denken könne (vgl. W I 68 f.). Dies zusammen macht eine Eigentümlichkeit des Menschen aus, die Schopenhauer als »Besonnenheit« bezeichnet: »Diese Besonnenheit nun wieder, also die Fähigkeit sich zu besinnen, zu sich zu kommen, ist eigentlich die Wurzel aller seiner theoretischen und praktischen Leistungen, durch welche der Mensch das Thier so sehr übertrifft; zunächst nämlich der Sorge für seine Zukunft, unter Berücksichtigung der Vergangenheit, sodann des absichtlichen, planmäßigen, methodischen Verfahrens bei jedem Vorhaben, daher des Zusammenwirkens Vieler zu Einem Zweck, mithin der Ordnung, des Gesetzes, des Staats, u. s. w.« (G 117; vgl. a. W I 68 u. W II 72) Bei anderer Gelegenheit beschreibt Schopenhauer die »Wirkungen«, die aus dem Gebrauch der Begriffe resultieren, folgendermaßen: »Solche sind die Sprache, das überlegte planmäßige Handeln und die Wissenschaft; hernach was aus diesen allen sich ergiebt.« (W I 71) In anderen Bereichen wie z. B. der Ästhetik und der Ethik betrachtet Schopenhauer hingegen den Rekurs auf Begriffe als weniger hilfreich; er ist vielmehr davon überzeugt, daß man sich dort in erster Linie auf die Anschauung zu stützen habe (vgl. W I 94 f., 297 u. 327).
Ist der Begriff hingegen in der Wissenschaft unentbehrlich, so liegt dies nicht zuletzt daran, daß ihre Aufgabe darin besteht, Wissen bzw. abstrakte Erkenntnis zu liefern, die ihrerseits – im Gegensatz zum Gefühl bzw. zur intuitiven Erkenntnis – zwingend Begriffe voraussetzen: »In dieser Hinsicht ist nun der eigentliche Gegensatz des Wissens das Gefühl […]. Der Begriff, den das Wort Gefühl bezeichnet, hat durchaus nur einen negativen Inhalt, nämlich diesen, daß etwas, das im Bewußtseyn gegenwärtig ist, nicht Begriff, nicht abstrakte Erkenntnis der Vernunft sei« (W I 87; vgl. a. W I 89 u. 92). Dies bedeutet, daß sich wissenschaftliche Erkenntnis dadurch auszeichnet, daß sie in Urteilen zum Ausdruck kommt, die wahr oder falsch sein können: »Wissen überhaupt heißt: solche Urtheile in der Gewalt seines Geistes zu willkürlicher Reproduktion haben, welche in irgend etwas außer ihnen ihren zureichenden Erkenntnißgrund haben, d. h. wahr sind.« (W I 87) Ist aber das Vorliegen eines Urteils die Bedingung dafür, daß überhaupt von »wahr« und »falsch« gesprochen werden kann, so läßt sich auch nachvollziehen, daß Schopenhauer im Begriff, der sich als irreduzible Komponente eines jeden Urteils darbietet, nicht allein die Grundlage des Wissens, sondern auch des Irrtums erblickt: »Aber mit der abstrakten Erkenntniß, mit der Vernunft, ist im Theoretischen der Zweifel und der Irrthum […] eingetreten.« (W I 66 f.; vgl. a. W II 83)
Schopenhauer vertritt die Auffassung, daß sich Begriffe wie alle Vorstellungen auf andere Vorstellungen beziehen, die ihr Erkenntnisgrund sind: »[S]o besteht auch das ganze Wesen der Begriffe, oder der Klasse der abstrakten Vorstellungen, allein in der Relation, welche in ihnen der Satz vom Grunde ausdrückt: und da diese die Beziehung auf den Erkenntnißgrund ist, so hat die abstrakte Vorstellung ihr ganzes Wesen einzig und allein in ihrer Beziehung auf eine andere Vorstellung, welche ihr Erkenntnißgrund ist. Diese kann nun zwar wieder zunächst ein Begriff, oder abstrakte Vorstellung seyn, und sogar auch dieser wieder nur einen eben solchen abstrakten Erkenntißgrund haben; aber nicht so ins Unendliche: sondern zuletzt muß die Reihe der Erkenntnißgründe mit einem Begriff schließen, der seinen Grund in der anschaulichen Erkenntniß hat. Denn die ganze Welt der Reflexion ruht auf der anschaulichen als ihrem Grunde des Erkennens.« (W I 73) Dies bedeutet, daß Erkenntnis, die in Urteilen – und damit in Begriffen – zum Ausdruck kommt, auf eine Begründung durch andere Erkenntnis angewiesen ist, die, sofern sie nicht bloß formal ist, der Anschauung bedarf. Mehr noch, Schopenhauer vertritt die Auffassung, daß die beschriebene Relation zwischen den Begriffen das ist, was letztlich die Wahrheit einer Erkenntnis ausmacht.20
Bejahung des Willens Schopenhauer charakterisiert den Willen bzw. den Willen zum Leben als ein zielloses Streben: »In der That gehört Abwesenheit alles Zieles, aller Gränzen, zum Wesen des Willens an sich, der ein endloses Streben ist.« (W I 217) Nach seiner Auffassung bejaht sich der Wille zunächst, das heißt, er tritt in Erscheinung, ohne sich selbst zu beschränken oder zu hemmen. Allerdings bestehe die Möglichkeit, daß der Wille zur Selbsterkenntnis gelange. Dies geschieht – nach Schopenhauer – auf die Weise, daß mit dem Menschen ein Wesen, in dem sich der Wille als Ding an sich objektiviert, darauf stößt, daß es letzten Endes nichts anderes als eine individuelle Erscheinung desselben ist.21 Angesichts dieser Einsicht sehe es sich mit der Alternative konfrontiert, den Willen zu bejahen oder aber zu verneinen (vgl. W I 238, 359 u. 385 f. sowie W II 669 f.).
Die Bejahung des Willens beschreibt er folgendermaßen: »Der Wille bejaht sich selbst, besagt: indem in seiner Objektität, d. i. der Welt und dem Leben, sein eigenes Wesen ihm als Vorstellung vollständig und deutlich gegeben wird, hemmt diese Erkenntniß sein Wollen keineswegs; sondern eben dieses so erkannte Leben wird auch als solches von ihm gewollt, wie bis dahin ohne Erkenntniß, als blinder Drang, so jetzt mit Erkenntniß, bewußt und besonnen.« (W I 359) Konkret beinhaltet die Bejahung des Willens die Bejahung des Leibes, in welchem der Wille erscheint bzw. sich objektiviert (vgl. W I 408 u. 416). Sie zielt sowohl auf die »Erhaltung des Individuums« als auch – erst recht – auf die »Fortpflanzung des Geschlechts« (W I 408 ff. u. 416 sowie W II 665) ab. Mehr noch, Schopenhauer erblickt im Geschlechtstrieb den »Kern des Willens zum Leben« (W II 601) und in seiner Befriedigung die »entschiedenste Bejahung des Willens zum Leben« (W I 410; vgl. a. W I 412 u. W II 666). Ähnlich gelten Schopenhauer die Genitalien als der »eigentliche Brennpunkt des Willens« (W I 412) und der Geschlechtsakt als »dessen Kern, als dessen größte Koncentration« (P II 343; vgl. a. W II 667).
Vergegenwärtigt man sich, daß Schopenhauer den Willen zum Leben als zielloses Streben betrachtet, so erstaunt es nicht weiter, daß er sich von der Bejahung desselben keine dauerhafte Befriedigung, geschweige denn Glück erwartet, sondern betont, sie bringe allenfalls Leiden mit sich (vgl. WI 387 ff.). Das gelte nicht bloß für das Individuum, das seinen eigenen Willen bejahe, sondern darüber hinaus auch für die anderen, mit denen es zu tun habe.22 Zum einen bedeute die Bejahung des eigenen Willens häufig eine Verneinung fremden Willens, die als Leiden empfunden werde und ein Unrecht darstelle (vgl. W I 417 u. 454 sowie W II 709), zum andern aber laufe sie – im Geschlechtstrieb – darauf hinaus, daß neues Leben in die Welt gesetzt und damit neues Leiden hervorgebracht werde. Schopenhauer stellt dazu fest: »Mit jener Bejahung über den eigenen Leib hinaus, und bis zur Darstellung eines neuen, ist auch Leiden und Tod, als zur Erscheinung des Lebens gehörig, aufs Neue mitbejaht und die […] Möglichkeit der Erlösung diesmal für fruchtlos erklärt.« (W I 410; vgl. a. W II 665 f.) Auf diesen Umstand führt Schopenhauer auch die Scham zurück, die mit der Sexualität einhergeht (vgl. W I 410, W II 666 f. u. P II 344).
Da Schopenhauer keine präskriptive, sondern eine deskriptive Ethik lehrt, weigert er sich, dem Menschen hinsichtlich der Alternative einer Bejahung oder Verneinung des Willens etwas »vorzuschreiben oder anzuempfehlen« (W I 359). Nichtsdestoweniger stuft er die Bejahung – durchaus im ethischen Sinne – als negativ und die Verneinung als positiv ein. Dabei lehnt er sich an die christliche Auffassung von Schuld und Erlösung an: »Nicht, dem Satz vom Grunde gemäß, die Individuen, sondern die Idee des Menschen in ihrer Einheit betrachtend, symbolisirt die Christliche Glaubenslehre die Natur, die Bejahung des Willens zum Leben, im Adam, dessen auf uns vererbte Sünde, d. h. unsere Einheit mit ihm in der Idee, welche in der Zeit durch das Band der Zeugung sich darstellt, uns Alle des Leidens und des ewigen Todes theilhaft macht: dagegen symbolisirt sie die Gnade, die Verneinung des Willens, die Erlösung, im menschgewordenen Gotte, der, als frei von aller Sündhaftigkeit, d. h. von allem Lebenswillen, auch nicht, wie wir, aus der entschiedensten Bejahung des Willens hervorgegangen seyn kann, noch wie wir einen Leib haben kann, der durch und durch nur konkreter Wille, Erscheinung des Willens, ist; sondern von der reinen Jungfrau geboren, auch nur einen Scheinleib hat.« (W I 500; vgl. a. W II 666, 679 u. 712) Die Leiden aber, welche die Bejahung des Willens nach sich zieht, interpretiert Schopenhauer als Strafe für die Schuld, die sie beinhaltet. Angesichts dieses Befundes überrascht es nicht weiter, daß er im Zustand, in welchem der Mensch den Willen zum Leben bejaht, letzten Endes einen »Wahn« (W I 359 u. W II 709) erblickt.
Bewußtsein Schopenhauer gebraucht den Begriff des Bewußtseins, um das Gesamt der mentalen Zustände zu bezeichnen, die von jemandem erlebt werden.23 Dabei setzt er das Bewußtsein entweder mit der Vorstellung gleich (vgl. W I 87) oder nähert es dadurch an sie an, daß er in der Vorstellung die »erste[] Thatsache des Bewußtseyns« (W I 65) erblickt. Daß beide Begriffe mehr oder weniger dasselbe meinen, geht auch daraus hervor, daß Schopenhauer dem Bewußtsein de facto dieselbe Struktur wie der Vorstellung zuschreibt. In Anlehnung an Reinhold und Fichte betont Schopenhauer, daß sich beides – Bewußtsein wie Vorstellung – durch eine apriorische Korrelation zwischen einem subjektiven und einem objektiven Pol auszeichnet: »Denn Bewußtseyn besteht im Erkennen: aber dazu gehört ein Erkennendes und ein Erkanntes […]. Wie nämlich kein Objekt ohne Subjekt seyn kann, so auch kein Subjekt ohne Objekt, d. h. kein Erkennendes ohne ein von ihm Verschiedenes, welches erkannt wird.« (W II 235) Ähnlich heißt es von der Vorstellung, daß ihre »erste wesentlichste Grundform das Zerfallen in Objekt und Subjekt ist« (W I 65).24
Innerhalb des Bereichs des Bewußtseins unterscheidet Schopenhauer zwischen dem Bewußtsein äußerer Dinge einerseits und dem – auf innere Zustände gerichteten – Selbstbewußtsein anderseits. So stellt er fest, daß das Bewußtsein »in das Bewußtseyn des eigenen Selbst (Selbstbewußtseyn) und in das Bewußtseyn anderer Dinge (äußere Anschauung) zerfällt« (W II 99; vgl. a. W II 234 f., 286 u. 435).25 In diesem Zusammenhang vertritt Schopenhauer die Auffassung, das Selbstbewußtsein habe in erster Linie die willentlichen Regungen des Subjekts bzw. seinen Willen zum Inhalt: »Jeder wird, bei Beobachtung des eigenen Selbstbewußtseyns bald gewahr werden, daß sein Gegenstand allezeit das eigene Wollen ist.« (E 51) Im Vergleich zum Selbstbewußtsein beziehe sich das Bewußtsein der äußeren Dinge auf eine Vielzahl von Gegenständen und sei daher »von unserm gesammten Bewußtseyn überhaupt der bei weitem größte Theil« (E 50).
Beide Komponenten des Bewußtseins treffen, wie Schopenhauer erläutert, in einer Instanz zusammen, die er als das »Ich« bezeichnet: »[D]er Indifferenzpunkt Beider […] wäre das Ich, welches, als gemeinschaftlicher Endpunkt, Beiden angehört.« (W II 236) Ferner zeichnet sich das Bewußtsein nach seiner Auffassung auch insofern durch Einheit aus, als es sich – angesichts des Wechsels seiner Zustände – als identisch durchhält: »Ein Bewußtseyn aber ist wesentlich ein einheitliches und erfordert daher stets einen centralen Einheitspunkt.« (W II 292; vgl. a. W I 61) Damit nimmt Schopenhauer eine Position ein, die im großen und ganzen mit Kants Lehre von der synthetischen Einheit der Apperzeption in eins fällt (vgl. W II 293).
Im Gegensatz zu Kant stuft Schopenhauer das Bewußtsein allerdings nicht einfach nur als Bedingung der Möglichkeit der Erkenntnis ein, sondern er wirft darüber hinaus die Frage auf, wodurch das Bewußtsein seinerseits bedingt ist. Ausgangspunkt dieser – anthropologisch gemeinten – Frage ist die Beobachtung, daß Bewußtsein in aller Regel an einen Körper gebunden ist: »Das Bewußtseyn ist uns schlechterdings nur als Eigenschaft animalischer Wesen bekannt: folglich dürfen, ja können wir es nicht anders, denn als animalisches Bewußtseyn denken; so daß dieser Ausdruck schon tautologisch ist.« (W II 237; vgl. a. P II 296)26 Mehr noch, Schopenhauer ist überzeugt, daß Bewußtsein nicht nur in Verbindung mit einem Körper auftritt, sondern daß es den Bedürfnissen desselben dient und seine jeweilige Beschaffenheit durch sie bestimmt ist. So legt Schopenhauer dar: »Die Nothwendigkeit des Bewußtseyns wird […] dadurch herbeigeführt, daß, in Folge der gesteigerten Komplikation und dadurch der mannigfaltigeren Bedürfnisse eines Organismus, die Akte seines Willens durch Motive gelenkt werden müssen, nicht mehr […] durch bloße Reize. […] Im vernünftigen Intellekt aber erfahren sie hiezu überdies noch eine weitere Verarbeitung durch Reflexion und Ueberlegung.« (W II 292 f.; vgl. a. W II 326) Freilich geht Schopenhauer noch einen Schritt weiter. Angesichts der Tatsache, daß er den Körper als Erscheinung des Willens deutet, gelangt er zum Ergebnis, daß das Bewußtsein nicht allein durch den Körper, sondern letztlich auch – auf dem Umweg über den Körper – durch den Willen bedingt ist: »Die Erkenntniß überhaupt […] geht also ursprünglich aus dem Willen selbst hervor, gehört zum Wesen der höhern Stufen seiner Objektivation, als eine bloße μηχανη, ein Mittel zur Erhaltung des Individuums und der Art, so gut wie jedes Organ des Leibes.« (W I 204; vgl. a. W II 165 u. 325 ff.)
Vergegenwärtigt man sich, daß Schopenhauer lehrt, das Bewußtsein hänge vom Körper und dieser wiederum vom Willen ab, so könnte man sagen, er stufe das Bewußtsein im Verhältnis zu jenem als sekundär und im Verhältnis zu diesem sogar nur als tertiär ein. Nun aber betont Schopenhauer, daß sein Ansatz unterschiedliche, einander wechselseitig korrigierende Perspektiven in sich vereine. Im wesentlichen sind dies eine transzendentalphilosophische, eine anthropologische sowie eine willensmetaphysische Perspektive. Geht man von der erstgenannten aus, so bietet sich das Bewußtsein als der Ursprung der Philosophie dar: »Nur das Bewußtseyn ist unmittelbar gegeben, daher ist ihre Grundlage auf Thatsachen des Bewußtseyns beschränkt: d. h. sie ist wesentlich idealistisch.« (W II 11) Aus dieser Perspektive ist das Bewußtsein natürlich auch Grundlage für die Erkenntnis des Körpers sowie des Willens. Umgekehrt betont Schopenhauer: »Allerdings nämlich steht dem subjektiven Ausgangspunkt ›die Welt ist meine Vorstellung‹ vorläufig mit gleicher Berechtigung gegenüber der objektive ›die Welt ist Materie‹, oder ›die Materie allein ist schlechthin‹ […], oder ›alles Existirende ist Materie‹.« (W II 22) Aus dieser Sicht böte sich das Bewußtsein als Funktion des Körpers bzw. des Gehirns dar und wäre nicht primär, sondern sekundär. Schopenhauer hält beide Betrachtungsweisen für einseitig und fordert, daß sie »in Uebereinstimmung gebracht werden müssen« (W II 318). Nimmt man schließlich den Willen als Ding an sich hinzu, so verschieben sich die Gewichte noch einmal, und das Bewußtsein rückt im Verhältnis zum Körper und zum Willen an die dritte Stelle. Aus der Perspektive der Metaphysik des Willens stellt Schopenhauer fest: »Dieses erkennende und bewußte Ich verhält sich zum Willen, welcher die Basis der Erscheinung desselben ist, wie das Bild im Fokus des Hohlspiegels zu diesem selbst, und hat, wie jenes, nur eine bedingte, ja eigentlich bloß scheinbare Realität. Weit entfernt, das schlechthin Erste zu seyn […], ist es im Grunde tertiär, indem es den Organismus voraussetzt, dieser aber den Willen.« (W II 325; vgl. a. N 220)
Bewußtsein, besseres Der Begriff des besseren Bewußtseins steht im Zentrum von Schopenhauers frühen, in die Jahre vor 1814 fallenden Überlegungen zur Erlösung, die im Handschriftlichen Nachlaß dokumentiert sind. Bereits in einem Aphorismus, der wohl 1808 oder 1809 verfaßt wurde, sieht Schopenhauer die Aufgabe der Philosophie darin, dem Menschen durch den Aufstieg in einen Bereich jenseits der Außenwelt zu Trost zu verhelfen: »Alle Philosophie und aller Trost, den sie gewährt, läuft darauf hinaus, daß eine Geisterwelt ist und daß wir in derselben, von allen Erscheinungen der Außenwelt getrennt, ihnen von einem erhabenen Sitz mit größter Ruhe ohne Theilnahme zusehen können, wenn unser der Körperwelt gehörender Theil auch noch so sehr darin herumgerissen wird.« (HN I 7 f.)
Den beiden genannten Bereichen ordnet Schopenhauer – im Sinne einer »Duplicität des Bewußtseyns« (HN I 68 u. 136 f.) – zwei Arten des Bewußtseins zu, die in der »Identität Eines Ichs verknüpft« (HN I 68) seien. Während der empirischen Wirklichkeit das »empirische Bewußtseyn« entspreche, sei das »bessere Bewußtseyn« auf die höhere, die empirische überbietende Wirklichkeit gerichtet. In diesem Zusammenhang bewertet Schopenhauer die empirische Wirklichkeit negativ, das heißt, er betrachtet sie als etwas, »was nach dem Ausspruch unsers besseren Bewußtseyns nicht seyn sollte« (HN I 41), die höhere Wirklichkeit hingegen schätzt er positiv ein, mehr noch, er setzt ihre – durch das bessere Bewußtsein ermöglichte – Erfahrung mit der »Seeligkeit« (HN I 79, 104 u. 167) des Menschen gleich. Daraus ergibt sich, daß Schopenhauer das Ziel des Menschen in der Überwindung der empirischen Wirklichkeit im Zuge des Eintritts in das bessere Bewußtsein erblickt: »Zum Lichte, zur Tugend, zum heiligen Geiste, zum bessern Bewußtseyn – müssen wir Alle: das ist der Einklang, der ewige Grundton der Schöpfung.« (HN I 90) Der Übergang vom empirischen zum besseren Bewußtsein kann nach Schopenhauer entweder frei (vgl. HN 91) oder im Ausgang von der Erfahrung des Leidens (vgl. HN I 52, 87, 91 u. 105) erfolgen. Freilich handle es sich dabei keineswegs nur um einen kognitiven Schritt, sondern darum, daß der Mensch mit der empirischen Wirklichkeit das, was sie zutiefst ausmache, nämlich das »Leben« (HN I 85, 87 u. 104 f.) bzw. das »Lebenwollen« (HN I 91 u. 105), verneine. Dies aber läuft, wie Schopenhauer versichert, auf Askese hinaus: »Asketik […] ist Negation des zeitlichen Bewußtseins: und Hedonik seine Affirmation.« (HN I 69; vgl. a. HN I 39 u. 52)
Dabei betrachtet Schopenhauer das Leben bzw. das zeitliche Bewußtsein – im Sinne der indischen Maja27 – als Wahn, den es mit dem Erreichen des besseren Bewußtseins zu überwinden gilt: »Soll Ruhe, Seeligkeit, Friede gefunden werden, so muß der Wahn aufgegeben werden, und soll dieser, so muß das Leben aufgegeben werden.« (HN I 104) Dabei geht es Schopenhauer allerdings weniger um den Tod selbst als um die Verneinung des Lebens, die zu fördern er geeignet ist und die einer Heiligung des Menschen gleichkommt: »[D]er Tod ist nicht die Heiligung sondern giebt nur die Möglichkeit der Heiligung. Denn wie mit dem Leben unausbleiblich der Wahn gesetzt ist, so ist auch mit dem Wahn das Leben gesetzt. Und wer beharrt auf dem Lebenwollen, wird leben, wenn auch dieser Leib stirbt: denn sofern der Wahn ist, bleibt auch seine Erscheinung nicht aus.« (HN I 105)
Schopenhauer betont, daß sich das bessere Bewußtsein nicht positiv, sondern allenfalls negativ – in Abgrenzung gegen das empirische Bewußtsein – beschreiben läßt: »Will es bessres Bewußtseyn seyn so können wir positiv von ihm nichts weiter sagen, denn unser Sagen liegt im Gebiet der Vernunft; wir können also nur sagen was auf diesem vorgeht, wodurch wir von dem bessern Bewußtseyn nur negativ sprechen.« (HN I 23) Während das empirische Bewußtsein durch Sinnlichkeit, Verstand und Vernunft sowie die Relation von Subjekt und Objekt bestimmt sei, treffe dies auf das bessere Bewußtsein nicht zu. Insbesondere weist Schopenhauer darauf hin, daß letzteres nicht der Zeit, sondern der Ewigkeit angehört (vgl. HN I 67 u. 85), daß es nicht der Kausalität unterworfen ist (vgl. HN I 67 sowie HN II 326 u. 329) und daß es darin keinen Gegensatz von Subjekt und Objekt gibt (vgl. HN I 67, 137, 151 u. 167). Damit aber besitzt es nichts, was auf eine kognitive Funktion hinausliefe: »[D]as bessre Bewußtsein denkt und erkennt nicht, da es jenseit des Subjekts und Objekts liegt« (HN I 67). Liegt das bessere Bewußtsein jenseits der menschlichen Erkenntnis, so ist es, wie Schopenhauer darlegt, nicht statthaft, das empirische Bewußtsein von ihm herzuleiten: »Die Frage ist transcendent und diese Relation ist ein transcendentaler Schein.« (ebd.)
Obgleich Schopenhauer auf der Differenz zwischen beiden Arten des Bewußtseins insistiert, glaubt er, daß sich das bessere Bewußtsein in zwei Bereichen der empirischen Wirklichkeit andeutet, von denen sich einer als eher theoretisch und der andere als eher praktisch darbietet (vgl. HN I 23). Im ersten Fall handelt es sich darum, daß das Genie die raum- und zeitlose Idee erfaßt und für einen Augenblick darin aufgeht (vgl. HN I 47 u. 136 f.), im zweiten hingegen darum, daß sich der Mensch im tugendhaften Handeln altruistisch verhält und damit den Unterschied zwischen sich und dem Anderen aufhebt (vgl. HN I 45, 51 u. 149). Freilich macht Schopenhauer geltend, daß die Idee ein Objekt ist, während im besseren Bewußtsein der Gegensatz zwischen Subjekt und Objekt verschwindet: »Aber das bessre Bewußtseyn kennt weder Objekt noch Subjekt: es steht also auf keinem von beiden Standpunkten da auch die Platonische Idee ein Objekt ist.« (HN I 151; vgl. a. HN I 76 u. 166 f.) Angesichts der Tatsache, daß sich die Kontemplation der Idee an das bessere Bewußtsein annähert, ohne damit in eins zu fallen, konstatiert Schopenhauer, daß eine »Aeußerung« (HN I 151) desselben vorliege oder es »repräsentirt« (HN I 76) werde. Bei anderer Gelegenheit stuft er das Erfassen der Idee als »Bedingung« oder »Weg« (HN I 167) zum besseren Bewußtsein ein. Aus ähnlichen Erwägungen gelten ihm auch Heiligkeit und Tugend als »Aeußerung des bessern Bewußtseyns« (HN I 51 u. 151) und letzteres umgekehrt als »Quelle der Tugend« (HN I 53 u. 122).
Während sich das bessere Bewußtsein in der empirischen Wirklichkeit lediglich kundtut, nicht aber rein auftritt, stellt sich dem Philosophen sowie dem Heiligen die Aufgabe, es angemessen zu bestimmen: »Der vollkommene Philosoph stellt theoretisch das bessre Bewußtseyn rein dar, indem er es genau und gänzlich vom empirischen sondert. Der Heilige thut dasselbe praktisch. Beiden ist es karakteristisches Merkmal ihrer Vollkommenheit, daß sie keinen Theil des empirischen Bewußtseyns schonen, unter welcher Gestalt er auch erscheinen mag.« (HN I 149)
Bosheit Die Bosheit stellt – neben dem Egoismus und dem Mitleid – die dritte Triebfeder menschlichen Handelns dar. Vergegenwärtigt man sich, daß Schopenhauer die Quantität eines Unrechts als die »Größe des Uebels, welches ich einem Andern dadurch zufüge, dividirt durch die Größe des Vortheils, den ich selbst dadurch erlange« (E 259) bestimmt, so kann man ohne weiteres nachvollziehen, daß er die Bosheit als das schlimmste Unrecht betrachtet (vgl. W I 416). Sie besteht nämlich darin, daß eine Handlung nicht etwa dem eigenen Interesse dient, sondern allein den Schaden des Anderen zum Zweck hat. Genau dies macht ihren Unterschied zum Egoismus aus: »Der Egoismus kann zu Verbrechen und Unthaten aller Art führen: aber der dadurch verursachte Schaden und Schmerz Anderer ist ihm bloß Mittel, nicht Zweck, tritt also nur accidentell dabei ein. Der Bosheit und Grausamkeit hingegen sind die Leiden und Schmerzen Anderer Zweck an sich und dessen Erreichen Genuß.« (E 240) Demzufolge lautet der Grundsatz, in dem die Bosheit zum Ausdruck kommt, omnes, quantum potes, laede (vgl. E 199 u. 240).
Schopenhauer erklärt sich die Bosheit dadurch, daß ein Mensch, der angesichts der Vergeblichkeit seines Begehrens von übergroßem Leiden befallen wird, den Versuch unternimmt, »durch den Anblick des fremden Leidens, welches er zugleich als eine Aeußerung seiner Macht erkennt, das eigene zu mildern« (W I 452).
Brahmanismus Nach dem Buddhismus ist der Brahmanismus diejenige Religion, die Schopenhauer am meisten schätzt. Gewährt er dem Buddhismus den Vorzug, so hat das zwei Gründe: Zum einen kommt dieser – im Gegensatz zum Brahmanismus – ohne Götter aus, ist also atheistisch, und zum andern stellt Buddha seine Lehre in abstrakterer, reinerer Form dar als jener: »Hingegen war die Absicht des Buddha Schakya Muni, den Kern aus der Schaale abzulösen, die hohe Lehre selbst von allem Bilder- und Götterwesen zu befreien und ihren reinen Gehalt sogar dem Volke zugänglich und faßlich zu machen. Dies ist ihm wundervoll gelungen, und daher ist seine Religion die vortrefflichste und durch die größte Anzahl von Gläubigen vertretene auf Erden.« (P II 245)
Der Brahmanismus erscheint Schopenhauer nicht zuletzt deshalb attraktiv, weil er eine pessimistische Weltsicht beinhaltet, also die empirische Wirklichkeit als im wesentlichen schlecht betrachtet. Ähnlich wie Schopenhauer führt der Brahmanismus die Beschaffenheit der Welt auf eine ursprüngliche, in ihrem obersten Prinzip gründende Schuld zurück und verbindet diesen Umstand mit dem Anliegen der Erlösung. So berichtet Schopenhauer: »Brahma bringt durch eine Art Sündenfall, oder Verirrung, die Welt hervor, bleibt aber dafür selbst darin, es abzubüßen, bis er sich daraus erlöst hat.« (P II 326)
In diesem Zusammenhang nimmt die Lehre von der Metempsychose bzw. Seelenwanderung eine herausragende Stellung ein. Sie stellt, wie Schopenhauer konstatiert, geradezu den »Kern des Brahmanismus und Buddhaismus« (W II 592), ja die »natürliche Ueberzeugung des Menschen« (W II 593) dar. Inhaltlich geht es darum, daß ein Mensch in einem anderen Lebewesen wiedergeboren wird und dabei für seine guten und schlechten Taten dadurch belohnt oder bestraft wird, daß die neue Form seiner Existenz eine bessere oder schlechtere ist. Freilich leidet diese Konzeption nach Schopenhauer daran, daß sie die Vergeltung für die Handlungen eines Menschen in die Zukunft verlegt und damit das Wesen des Menschen als zeitlich darstellt (W II 588 f. u. 704 f.). Nach seiner Auffassung liegt dieses außerhalb der Zeit und besteht die Vergeltung darin, daß es ein und derselbe Wille ist, der Leiden zufügt und erduldet. Schopenhauer erblickt darin so etwas wie eine »ewige Gerechtigkeit« (W I 442 f.). Nichtsdestoweniger rechnet er es dem Brahmanismus hoch an, daß er das Wesen des Menschen nicht innerhalb, sondern außerhalb des Individuums ansiedelt: »Diese Wahrheit ist es, welche mythisch, d. h. dem Satze vom Grunde angepaßt und dadurch in die Form der Erscheinung übersetzt, durch die Seelenwanderung ausgedrückt wird« (W I 454). Bei alledem betont Schopenhauer, daß dasjenige, was sich von Individuum zu Individuum durchhält, nicht etwa eine mit Geist begabte Seele, sondern der Charakter bzw. der Wille ist. Daher zieht er es vor, nicht von Metempsychose, sondern von Palingenesie zu sprechen (vgl. W II 589).
Was die Erlösung anbelangt, so besteht sie nach Auffassung des Brahmanismus darin, daß ein Individuum seinen Willen verneint und nicht mehr wiedergeboren wird (vgl. W I 443, W II 712 u. P I 73). Dabei geht es in das oberste Prinzip der Wirklichkeit, das Brahm, ein bzw. löst sich darin auf (vgl. W I 508 u. W II 712). Die Nähe zu Schopenhauers eigener Konzeption der Erlösung ist kaum zu übersehen.
Auch in erkenntnistheoretischer Hinsicht tritt eine bedeutsame Übereinstimmung zutage. So hebt Schopenhauer hervor, daß auch der Brahmanismus idealistisch ist, also die Auffassung vertritt, die empirische Wirklichkeit sei lediglich eine Erscheinung oder Vorstellung (vgl. W I 30 u. 516, E 308 f. sowie P I 22 f.). Mehr noch, er interpretiert diesen Befund im Sinne einer »traumartigen Beschaffenheit der ganzen Welt« (W I 516). Damit meint er, die empirische Wirklichkeit sei eine bloße Illusion. Dem entspreche die brahmanistische Lehre, die menschliche Erkenntnis werde vom Schleier der Maja getrübt und sei daher nicht in der Lage, die wahre Wirklichkeit bzw. das Ding an sich zu erfassen (vgl. W I 34, 45, 453 u. 516, W II 705 sowie E 310). Dieses – im Brahmanismus als Brahm benannte – Prinzip zeichne sich durch Einheit sowie Ewigkeit aus und liege der empirischen Wirklichkeit zugrunde. Natürlich ergibt sich daraus, daß jedes Individuum an diesem Prinzip teilhat. Daher stellt Schopenhauer fest, der Brahmanismus lehre den Menschen, »sich als das Urwesen selbst, das Brahm, zu betrachten, welchem alles Entstehn und Vergehn wesentlich fremd ist« (W II 543). In diesem Zusammenhang macht er auch auf den praktischen Aspekt dieser Einsicht aufmerksam: Zum einen ließen sich die Anhänger des Brahmanismus – angesichts der Partizipation an einem ewigen Prinzip – vom Tod nur wenig beeindrucken (vgl. ebd.); zum andern aber stelle die Einsicht, daß sich die empirische Wirklichkeit im Schein erschöpfe und letzten Endes im Brahm gründe, die entscheidende Voraussetzung für die Erlösung dar (vgl. W II 712 u. P II 439).
Aus der Annahme, der gesamten empirischen Wirklichkeit liege mit dem Brahm ein und dasselbe Prinzip zugrunde, ergibt sich natürlich, daß sich das Individuum allenfalls in empirischer, nicht aber in metaphysischer Hinsicht von den anderen Individuen unterscheidet. Diese – in ethischer Hinsicht folgenreiche – Erkenntnis kommt in den Worten tat twam asi zum Ausdruck, die Schopenhauer mit »Dies bist du« (W I 442 u. 464, E 311 f. sowie P II 239) übersetzt. Er legt dar, daß die Einsicht in den einheitlichen Grund der Wirklichkeit eine wesentliche Komponente des Mitleids darstellt, das seinerseits den Menschen zu tugendhaftem – und das heißt: altruistischem – Handeln motiviert. Damit nimmt der Brahmanismus eine ethische Position ein, die jener Schopenhauers ähnelt. So stellt dieser fest, daß auch der Brahmanismus – im Ausgang von seiner Tendenz zur Verneinung des Willens – für eine Ethik der Menschenliebe eintritt, die sich in Askese und Resignation vollendet. Die entsprechenden Ideale seien: »Liebe des Nächsten mit völliger Verleugnung aller Selbstliebe; die Liebe überhaupt nicht auf das Menschengeschlecht beschränkt, sondern alles Lebende umfassend; Wohlthätigkeit bis zum Weggeben des täglich sauer Erworbenen; gränzenlose Geduld gegen alle Beleidiger; Vergeltung alles Bösen, so arg es auch seyn mag, mit Gutem und Liebe; freiwillige und freudige Erduldung jeder Schmach; Enthaltung aller thierischen Nahrung; völlige Keuschheit und Entsagung aller Wollust für Den, welcher eigentliche Heiligkeit anstrebt; Wegwerfung alles Eigenthums, Verlassung jedes Wohnorts, aller Angehörigen, tiefe gänzliche Einsamkeit, zugebracht in stillschweigender Betrachtung, mit freiwilliger Buße und schrecklicher, langsamer Selbstpeinigung, zur gänzlichen Mortifikation des Willens, welche zuletzt bis zum freiwilligen Tode geht durch Hunger« (W I 480; vgl. a. W II 710 f. u. E 266).28
Angesichts der Nähe der christlichen Ethik zur brahmanistischen – und auch buddhistischen – vermutet Schopenhauer, daß sie – ähnlich wie die Vorstellung der Menschwerdung Gottes – indischen Ursprungs ist. So könne man kaum zweifeln, »daß sie, wie auch die Idee von einem Mensch gewordenen Gotte (Avatar), aus Indien stammt […], so daß das Christenthum ein Abglanz Indischen Urlichtes […] wäre« (E 281; vgl. a. G 144, W II 572, 712 u. 730 sowie P II 419 ff.). Einen prägnanten Unterschied zwischen der christlichen und der brahmanistischen Religion erblickt Schopenhauer hingegen darin, daß erstere die Schöpfung der Welt aus dem Nichts, letztere hingegen deren Selbstgenügsamkeit bzw. Unendlichkeit lehrt (vgl. P I 123 sowie W I 592, P II 243 u. 420).
Buddhismus Schopenhauer bringt dem Buddhismus eine besondere Wertschätzung entgegen. Das liegt nicht zuletzt daran, daß sein eigenes Denken dieser Religion näher als jeder anderen steht. So erklärt Schopenhauer: »Wollte ich die Resultate meiner Philosophie zum Maaßstabe der Wahrheit nehmen, so müßte ich dem Buddhaismus den Vorzug vor den andern zugestehn.« (W II 197; vgl. a. N 327 f. u. P II 245) Dabei betont Schopenhauer allerdings, er habe bei der Abfassung von Die Welt als Wille und Vorstellung nicht unter dem Einfluß des Buddhismus gestanden, sondern diesen erst später für sich entdeckt.29
Ein wesentlicher Punkt, in dem Schopenhauer mit dem Buddhismus übereinstimmt, besteht darin, daß er nicht von der Existenz eines Gottes überzeugt ist, also keine theistische, sondern eine atheistische Position einnimmt (vgl. W I 595 G 142 ff., N 331 u. P I 132). Dadurch fühlt er sich in seiner Auffassung bestätigt, daß es der Religion keineswegs wesentlich ist, auf die Existenz eines göttlichen Wesens zu setzen. Vielmehr erscheint es ihm »wirklich skandalös […], wie […] in den Schriften deutscher Gelehrter, durchgängig Religion und Theismus ohne Weiteres als identisch und synonym genommen werden« (G 144). Unter der Voraussetzung, daß Gott nicht existiert, ist es natürlich auch nicht sinnvoll, ihn als erste Ursache der Welt und diese als seine Schöpfung zu betrachten. Schopenhauer weist zu Recht darauf hin, daß der Buddhismus in dieser Hinsicht konsequent ist und sich von beiden Annahmen distanziert (vgl. W I 592 u. G 142 f.).
Wichtiger als die Frage nach Gott ist für Schopenhauer, ob eine Religion optimistisch oder pessimistisch ist. Auch was diese Alternative betrifft, stimmt der Buddhismus – als pessimistische Religion (vgl. N 329, P I 48 sowie P II 417 u. 427 f.) – mit Schopenhauers eigener Einschätzung der empirischen Wirklichkeit als einer von Schuld und daraus resultierendem Leiden geprägten überein. Mit diesem aber drängt sich das Anliegen der Erlösung auf, die auch im Buddhismus das »höchste Ziel« (W II 707) darstelle. Dieser beinhaltet nach Schopenhauer die »Erkenntniß der vier Grundwahrheiten: 1) dolor, 2) doloris ortus, 3) doloris interitus, 4) octopartita via ad doloris sedationem« (W II 730).
Dabei bietet sich die Erlösung bei Schopenhauer ähnlich wie im Buddhismus dar. Sie besteht nicht etwa darin, daß der Mensch die empirische Wirklichkeit überwindet, indem er nach dem Tod in eine andere, bessere Wirklichkeit gelangt, sondern indem er in einen Bereich eintritt, der – aus der Perspektive der Welt als Vorstellung – als Nichts bzw. Nirwana erscheint: »Die Buddhaisten aber bezeichnen, mit voller Redlichkeit, die Sache bloß negativ, durch Nirwana, welches die Negation dieser Welt, oder des Sansara ist. Wenn Nirwana als das Nichts definirt wird; so will dies nur sagen, daß der Sansara kein einziges Element enthält, welches zur Definition, oder Konstruktion des Nirwana dienen könnte.« (W II 712; vgl. a. W I 443 u. 508 sowie P II 406 f.) Erreicht wird dieses Ziel – sowohl nach Schopenhauer als auch aus buddhistischer Sicht – im Zuge einer zunehmenden Verneinung des Willens, die in der vollkommenen Askese kulminiert (vgl. G 142, W I 481, W II 710 f. u. 742 sowie P I 48 u. 132).
Freilich ist das Nirwana im Buddhismus ein Zustand, der erst nach einer Reihe von Wiedergeburten bzw. am Ende einer Seelenwanderung erreicht wird. Zwar leidet die buddhistische Lehre von der Metempsychose nach Schopenhauer an einer Reihe von »Ungereimtheiten« (W II 588 f.), doch er räumt ein, daß sie einen wahren Kern besitze. Dieser bestehe darin, daß der Charakter des Menschen, den Schopenhauer als Idee – und damit als ewig – betrachtet, über den Tod hinaus fortdauere, um sich in einem neuen Individuum mit einem anderen Intellekt zu verbinden. Angesichts der Tatsache, daß nach dieser Auffassung nicht etwa die mit einem Intellekt ausgestattete Seele, sondern – mit dem Charakter – der Wille über den Tod hinaus Bestand hat, zieht es Schopenhauer vor, nicht von Metempsychose, sondern von Palingenesie zu sprechen: »[D]emgemäß ist zur Bezeichnung dieser Lehre das Wort Palingenesie richtiger, als Metempsychose.« (W II 589) Der Bezug zur Erlösung bleibt auch bei Schopenhauer erhalten: »Diese steten Wiedergeburten machten dann die Succession der Lebensträume eines an sich unzerstörbaren Willens aus, bis er, durch so viele und verschiedenartige, successive Erkenntniß, in stets neuer Form, belehrt und gebessert, sich selbst aufhöbe.« (ebd.) Dabei führt Schopenhauer den Umstand, daß nur wenige Menschen zur Erlösung gelangen, darauf zurück, daß die meisten die Schuld früherer Individuen übernommen haben und abbüßen müssen.30 Er betrachtet diese Erklärung – im Vergleich zur augustinischen Lehre von der Prädestination – als einleuchtender, da sie die Frage nach der Zahl der Erlösten nicht bloß im Rekurs auf eine willkürliche Auswahl beantworte (vgl. P II 406). Einen weiteren Vorzug der buddhistischen Auffassung erblickt Schopenhauer darin, daß sie keine ewige Verdammnis, sondern lediglich – je nach Schuld – eine Wiedergeburt in entsprechender Gestalt vorsieht (vgl. ebd.).
Die Parallelen zwischen Schopenhauer und dem Buddhismus gehen über die Frage nach der Erlösung hinaus. In erkenntnistheoretischer Hinsicht stimmen beide darin überein, daß sich der Idealismus gegenüber dem Realismus im Recht befindet. Genauer gesagt vertreten sie die Auffassung, die empirische Wirklichkeit erschöpfe sich in einer bloßen Erscheinung, ja sie laufe auf eine Illusion hinaus, während das Ding an sich unerkennbar sei (vgl. W II 198 u. 321 f.). Eine weitere Ähnlichkeit besteht darin, daß auch der Buddhismus das Individuum als Erscheinung des Dinges an sich betrachtet, also »den Menschen [lehrt], sich als das Urwesen selbst […] zu betrachten, welchem alles Entstehn und Vergehn wesentlich fremd ist« (W II 543).
Was hingegen die Ethik anbelangt, so rechnet es Schopenhauer dem Buddhismus hoch an, daß er – ähnlich wie das Christentum – für die Menschenliebe eintritt (vgl. E 266), darüber hinaus aber auch die Tiere als leidensfähige Wesen ernst nimmt und ihnen ein Recht auf entsprechende Behandlung konzediert (vgl. W II 719 u. P II 408 ff.). Abgesehen von dieser Differenz ist Schopenhauer davon überzeugt, »daß der Geist der Christlichen Moral mit dem […] des Buddhaismus identisch ist« (W II 743). Aufgrund dieser – sowie einer Reihe anderer – Ähnlichkeiten vermutet Schopenhauer, daß die christliche Religion letzten Endes auf die beiden indischen, nämlich den Brahmanismus und den Buddhismus, zurückgeht: »Der Geist und die ethische Tendenz sind aber das Wesentliche einer Religion, nicht die Mythen, in welche sie solche kleidet. Ich gebe daher den Glauben nicht auf, daß die Lehren des Christenthums irgendwie aus jenen Urreligionen abzuleiten sind.« (W II 730; vgl. a. W II 572 sowie G 144 u. P II 419 ff.)
Charakter Der Begriff des Charakters nimmt in Schopenhauers Ethik eine zentrale Stellung ein. Dabei fällt auf, daß Schopenhauer im Charakter keineswegs nur ein empirisches Phänomen erblickt, sondern ihm – vor dem Hintergrund seiner Metaphysik der Natur sowie seiner Ideenlehre – eine metaphysische Grundlage verleiht. Zunächst bildet der Charakter eine Disposition, die im Bereich des Willens angesiedelt ist: »Diese speciell und individuell bestimmte Beschaffenheit des Willens, vermöge deren seine Reaktion auf die selben Motive in jedem Menschen eine andere ist, macht Das aus, was man dessen Charakter nennt.« (E 87)31 Schopenhauer unterscheidet zwischen drei Arten des Charakters, die miteinander eng zusammenhängen: dem empirischen Charakter, dem erworbenen Charakter, der eine besondere Ausprägung des empirischen ist, sowie dem intelligiblen Charakter, der sich als metaphysische Grundlage des empirischen darbietet.
Der empirische Charakter ist – im Gegensatz zum intelligiblen – der Erfahrung zugänglich. Er stellt eine Eigentümlichkeit des individuellen Willens dar, die sich darin äußert, wie jemand auf bestimmte Motive reagiert, und läßt sich im Ausgang von den entsprechenden Handlungen erschließen. Schopenhauer bezeichnet ihn als empirischen Charakter, »weil er nicht a priori sondern nur durch Erfahrung bekannt wird« (E 87). Stellt man in Rechnung, daß Erfahrung stets die Möglichkeit des Irrtums in sich birgt, so kann man nachvollziehen, daß Menschen bei der Einschätzung des Charakters häufig falsch liegen. So betont auch Schopenhauer: »Daher wird man oft, wie über Andere, so auch über sich selbst enttäuscht, wenn man entdeckt, daß man diese oder jene Eigenschaft, z. B. Gerechtigkeit, Uneigennützigkeit, Muth, nicht in dem Grade besitzt, als man gütigst voraussetzte. Daher auch bleibt, bei einer vorliegenden schweren Wahl, unser eigener Entschluß, gleich einem fremden, uns selber so lange ein Geheimniß, bis jene entschieden ist.« (E 87 f.) Dennoch kann das Urteil über den Charakter – nach Schopenhauer – mit der Erfahrung durchaus an Zuverlässigkeit gewinnen.32
Was den menschlichen Charakter anbelangt, so betrachtet ihn Schopenhauer als individuell. Zwar habe der Mensch auch am Charakter der Gattung teil, doch im Gegensatz zu den Tieren, Pflanzen und unorganischen Wesen, bei denen die Individualität des Charakters – in der genannten Reihenfolge – abnehme, bis sie nicht mehr vorhanden sei, herrsche das Individuelle bei ihm gegenüber dem Gattungsmäßigen vor: »Auf den obern Stufen der Objektität des Willens sehn wir die Individualiät bedeutend hervortreten, besonders beim Menschen, als die große Verschiedenheit individueller Charaktere, d. h. als vollständige Persönlichkeit, schon äußerlich ausgedrückt durch stark gezeichnete individuelle Physiognomie, welche die gesammte Korporisation mitbegreift.« (W I 179; vgl. a. E 87)
Ferner behauptet Schopenhauer, der Charakter sei konstant, ja sogar unveränderlich: »Der Charakter des Menschen ist konstant: er bleibt der selbe, das ganze Leben hindurch.« (E 89; vgl. a. W I 379, W II 262, E 216 u. P I 226) Daraus ergibt sich natürlich, daß Schopenhauer das Ansinnen, den Charakter eines Menschen zu modifizieren, für aussichtslos hält. Was man beeinflussen könne, sei allenfalls die Erkenntnis: »Weiter aber, als auf die Berichtigung der Erkenntniß, erstreckt sich keine moralische Einwirkung, und das Unternehmen, die Charakterfehler eines Menschen durch Reden und Moralisiren aufheben und so seinen Charakter selbst, seine eigentliche Moralität, umschaffen zu wollen, ist ganz gleich dem Vorhaben, Blei durch äußere Einwirkung in Gold zu verwandeln, oder eine Eiche durch sorgfältige Pflege dahin zu bringen, daß sie Aprikosen trüge.« (E 91; vgl. a. W II 260) Gegen diese Einschätzung ließe sich argumentieren, daß sich der Charakter eines Menschen – z. B. durch besonders intensive Erfahrungen und Erlebnisse oder therapeutische Maßnahmen – sehr wohl verändern könne. Einwände dieser Art diskutiert Schopenhauer gar nicht erst. Damit stellt sich die Frage, ob die Lehre von der Unveränderlichkeit des Charakters aus der Luft gegriffen ist oder nicht doch auf irgendeine Weise einsichtig gemacht werden kann. Bei genauerem Hinsehen drängt sich der Eindruck auf, daß diese Lehre keinen empirischen, sondern einen metaphysischen Hintergrund hat. Es handelt sich darum, daß Schopenhauer den empirischen Charakter als Erscheinung eines intelligiblen Charakters interpretiert: »Der empirische Charakter ist ganz und gar durch den intelligibeln, welcher grundloser, d. h. als Ding an sich dem Satz vom Grund (der Form der Erscheinung) nicht unterworfener Wille ist, bestimmt. Der empirische Charakter muß in einem Lebenslauf das Abbild des intelligibeln liefern, und kann nicht anders ausfallen, als das Wesen dieses es erfordert.« (W I 211) Da nun der intelligible Charakter nicht unter die Form der Erscheinung – und damit auch nicht unter die Zeit – fällt, ist es nicht möglich, daß er sich ändert.33 Stellt der empirische Charakter ein Abbild des intelligiblen dar, so kann man nachvollziehen, daß er mit der Unveränderlichkeit ein Merkmal übernimmt, das für diesen konstitutiv ist.34 Zwar mag sich Schopenhauer mit diesen Überlegungen in den Bereich der Spekulation begeben, und es bleibt fraglich, ob die Lehre von der Unveränderlichkeit des Charakters der empirischen Wirklichkeit gerecht wird, doch lassen sie diese Lehre in gewisser Hinsicht verständlich erscheinen.
Ein weiteres Merkmal des empirischen Charakters, das Schopenhauer anführt, besteht darin, daß dieser angeboren ist. Genauer gesagt vertritt Schopenhauer die – etwas merkwürdige – These, der Charakter werde – ähnlich wie die Intelligenz von der Mutter – vom Vater vererbt: »Er ist sogar, in seinen Grundzügen, erblich, aber nur vom Vater, die Intelligenz hingegen von der Mutter.« (E 92)35 Schopenhauer widmet dieser These im zweiten Band von Die Welt als Wille und Vorstellung sogar ein ganzes Kapitel, das er mit »Erblichkeit der Eigenschaften« (W II 604 ff.) überschreibt. – Aus der Auffassung, der Charakter sei angeboren, ergibt sich – für diejenigen Eigentümlichkeiten des Charakters, die unter moralischem Gesichtspunkt von Interesse sind – eine Konsequenz, die schwerer kaum sein könnte: »Aus dieser Darlegung des Wesens des individuellen Charakters folgt allerdings, daß Tugenden und Laster angeboren sind.« (E 92) Dies aber würde bedeuten, daß kein Mensch für seine Tugenden und Laster verantwortlich wäre.
Zusammen mit dem Motiv bildet der Charakter eine der beiden Bedingungen, die determinieren, wie jemand handelt. Trifft ein bestimmtes Motiv auf einen bestimmten Charakter, so tritt die entsprechende Handlung – nach Schopenhauer – notwendig ein, das heißt, es ist nicht möglich, daß eine andere Handlung geschieht: »Wie jede Wirkung in der unbelebten Natur ein nothwendiges Produkt zweier Faktoren ist, nämlich der hier sich äußernden allgemeinen Naturkraft und der diese Aeußerung hier hervorrufenden einzelnen Ursache; gerade so ist jede That eines Menschen das nothwendige Produkt seines Charakters und des eingetretenen Motivs. Sind diese Beiden gegeben, so erfolgt sie unausbleiblich. Damit eine andere entstände, müßte entweder ein anderes Motiv oder ein anderer Charakter gesetzt werden.« (E 95; vgl. a. W I 158 u. 362 ff. sowie E 87, 122 u. 135) Ähnlich wie Kant folgert Schopenhauer daraus, daß man eine Handlung, sofern man den Charakter und das Motiv kennen würde, mit der gleichen Sicherheit wie ein Ereignis in der unbelebten Natur voraussagen könnte: »[E]s ließe sich auch, wie Kant sagt, wenn nur der empirische Charakter und die Motive vollständig gegeben wären, des Menschen Verhalten, auf die Zukunft, wie eine Sonnen- oder Mondfinsterniß ausrechnen.« (W I 367; vgl. a. N 274 sowie E 95 u. 122 f.)36 Scheitert dieses Unterfangen in der Praxis, so liegt das nach Schopenhauer allein daran, daß in der Regel keine ausreichende Kenntnis des Charakters sowie der Motive zur Verfügung steht (vgl. E 95).
Obgleich Schopenhauer davon überzeugt ist, daß Handlungen determiniert sind und der Charakter angeboren und unveränderlich ist, vertritt er die Auffassung, daß es Freiheit gibt. Dabei geht er von der Beobachtung aus, daß sich der Mensch für seine Handlungen verantwortlich fühlt. Verantwortung aber setzt, wie Schopenhauer zu Recht betont, Freiheit voraus: »Soll […] ein Wesen für sein Thun verantwortlich, also soll es zurechnungsfähig seyn; so muß es frei seyn.« (P I 77) Da sich die Freiheit nicht auf Handlungen erstrecken kann, ist Schopenhauer gezwungen, sie in einem anderen Bereich anzusiedeln. Auf den ersten Blick mag es überraschend erscheinen, wenn er den Charakter ins Spiel bringt: »Da, wo die Schuld liegt, muß auch die Verantwortlichkeit liegen: und da diese das alleinige Datum ist, welches auf moralische Freiheit zu schließen berechtigt; so muß auch die Freiheit eben daselbst liegen, also im Charakter des Menschen; um so mehr, als wir uns hinlänglich überzeugt haben, daß sie unmittelbar in den einzelnen Handlungen nicht anzutreffen ist, als welche, unter Voraussetzung des Charakters, streng necessitirt eintreten.« (E 135)
Nach allem, was bislang erläutert wurde, erscheint der Charakter aus zwei Gründen nicht als Ort der Freiheit geeignet. Zum einen gehört er der empirischen Wirklichkeit an, die unter dem Satz vom zureichenden Grunde des Werdens bzw. dem Kausalitätsprinzip steht, also determiniert ist, und zum anderen wurde er als angeboren und unveränderlich beschrieben. Um den Charakter dennoch mit der Freiheit vereinbaren zu können, macht sich Schopenhauer eine Distinktion zunutze, die er von Kant übernimmt. Es handelt sich um die Unterscheidung zwischen dem empirischen und dem intelligiblen Charakter, die er dem Königsberger Denker als »unsterbliches Verdienst« (W I 208) anrechnet, ja sogar für die »größte aller Leistungen des menschlichen Tiefsinns« (E 216) hält.37 Entscheidend ist in diesem Zusammenhang, daß Schopenhauer den empirischen Charakter dem Bereich der Erscheinung bzw. des mundus sensibilis und den intelligiblen Charakter dem Bereich des Dinges an sich bzw. des mundus intelligibilis zuordnet. Dies aber bedeutet, daß lediglich der empirische Charakter, nicht aber der intelligible der Notwendigkeit unterworfen ist. Letzterer hingegen ist frei: »Jenes von Kant dargelegte Verhältniß des empirischen zum intelligiblen Charakter beruht ganz und gar auf dem, was den Grundzug seiner gesammten Philosophie ausmacht, nämlich auf der Unterscheidung zwischen Erscheinung und Ding an sich: und wie bei ihm die vollkommene empirische Realität der Erfahrungswelt zusammenbesteht mit ihrer transscendentalen Idealität; eben so die strenge empirische Nothwendigkeit des Handelns mit dessen transscendentaler Freiheit. Der empirische Charakter nämlich ist, wie der ganze Mensch, als Gegenstand der Erfahrung eine bloße Erscheinung, daher an die Formen aller Erscheinung, Zeit, Raum und Kausalität gebunden und deren Gesetzen unterworfen: hingegen ist die als Ding an sich von diesen Formen unabhängige und deshalb keinem Zeitunterschied unterworfene, mithin beharrende und unveränderliche Bedingung und Grundlage dieser ganzen Erscheinung sein intelligibler Charakter, d. h. sein Wille als Ding an sich, welchem, in solcher Eigenschaft, allerdings auch absolute Freiheit, d. h. Unabhängigkeit vom Gesetze der Kausalität (als einer bloßen Form der Erscheinungen) zukommt.« (E 136 f.)
Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, daß Schopenhauer bei der Bestimmung des Verhältnisses des intelligiblen Charakters zum Ding an sich zwischen mehreren Alternativen schwankt. Bald setzt er ihn mit dem »Wille[n] als Ding an sich« (E 137) gleich, bald mit der »Beschaffenheit an sich« (E 216) oder dem »Wesen an sich« (E 217) desselben, aber er beschreibt ihn auch als »meine[n] Willen im Ganzen« (W I 151) oder als »Wille[n] als Ding an sich, sofern er in einem bestimmten Individuo, in bestimmtem Grade erscheint« (W I 364). Dabei stellt sich die Frage, auf welche Weise sich der empirische Charakter am ehesten als »Erscheinung« (W I 151), »Abbild« (W I 211), »Aeußerung« (W I 365) oder »Entfaltung« (W I 378) des intelligiblen begreifen läßt. Vergegenwärtigt man sich, daß der empirische Charakter individuell ist, und versucht man, seiner Individualität gerecht zu werden, so liegt es nahe, den intelligiblen Charakter als dasjenige, was den empirischen bestimmt, ebenfalls mit Individualität auszustatten. Genau diesen Weg beschreitet Schopenhauer letztlich auch. Deshalb ist es irreführend, den intelligiblen Charakter im Sinne der ersten Alternative einfach mit dem Ding an sich gleichzusetzen. Was hingegen die anderen Alternativen betrifft, so unterscheiden sie im Bereich dessen, was dem empirischen Charakter zugrunde liegt, zwischen dem einen Willen als Ding an sich und seiner Ausdifferenzierung zu einer Vielzahl individueller »Beschaffenheiten« oder »Wesen«, die mit dem jeweiligen intelligiblen Charakter in eins fallen.
Schopenhauer führt diese Ausdifferenzierung im Rahmen seiner Ideenlehre durch. Dabei identifiziert er den intelligiblen Charakter mit einer Idee, die ihrerseits einem Akt des Willens als Ding an sich entspricht: »Der Charakter jedes einzelnen Menschen kann, sofern er durchaus individuell und nicht ganz in dem der Species begriffen ist, als eine besondere Idee, entsprechend einem eigenthümlichen Objektivationsakt des Willens, angesehn werden. Dieser Akt selbst wäre dann sein intelligibler Charakter, sein empirischer aber die Erscheinung desselben. Der empirische Charakter ist ganz und gar durch den intelligiblen, welcher grundloser, d. h. als Ding an sich dem Satz vom Grund (der Form der Erscheinung) nicht unterworfener Wille ist, bestimmt.« (W I 211)38
Vergegenwärtigt man sich, daß Schopenhauer den empirischen Charakter als eine Erscheinung des intelligiblen und diesen als zeitlose, unveränderliche Idee deutet, so fragt sich, in welcher Hinsicht er den intelligiblen Charakter noch als frei betrachten kann. Bei genauerem Hinsehen entdeckt man, daß es Schopenhauer weniger darum geht, daß der Charakter frei ist, sondern daß er das Ergebnis einer freien Wahl ist. In diesem Zusammenhang vergleicht Schopenhauer – auf einen Mythos anspielend, den Platon in der Politeia (613e–621d) ausbreitet – den intelligiblen Charakter mit einem »Dämon, der [den Menschen] leitet und der nicht ihn, sondern den er selbst gewählt hat« (W I 343; vgl. a. E 218 ff.). Freilich scheint es, als könne diese Wahl nicht vom Menschen, der ja als empirisches Wesen determiniert ist, sondern allenfalls vom Willen als Ding an sich durchgeführt werden. Allein dieser trüge dann die Verantwortung für den Charakter des Menschen, aber auch für die Handlungen, die sich daraus ergeben.
Was schließlich den erworbenen Charakter anbelangt, so ist dieser innerhalb des Bereichs des empirischen Charakters angesiedelt. Er besteht darin, daß jemand seinen empirischen Charakter im Laufe der Zeit kennengelernt hat und diesem gemäß handelt: »Haben wir nun erforscht, wo unsere Stärken und wo unsere Schwächen liegen; so werden wir unsere hervorstechenden natürlichen Anlagen ausbilden, gebrauchen, auf alle Weise zu nutzen suchen und immer uns dahin wenden, wo diese taugen und gelten, aber durchaus und mit Selbstüberwindung die Bestrebungen vermeiden, zu denen wir von Natur geringe Anlagen haben; werden uns hüten, Das zu versuchen, was uns doch nicht gelingt.« (W I 383; vgl. a. E 88 f.) Mit anderen Worten, im erworbenen Charakter treten die Züge, die im empirischen angelegt sind, aufgrund der entsprechenden Kenntnis besonders deutlich zutage. Der empirische Charakter befähigt den Menschen, im Einklang mit sich selbst zu leben und auf diese Weise »zur möglichsten Zufriedenheit mit sich selbst zu gelangen« (W I 384).