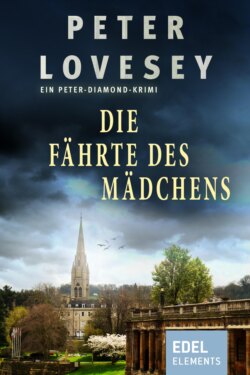Читать книгу Die Fährte des Mädchens - Peter Lovesey - Страница 8
Kapitel vier
ОглавлениеEine Samstagabendvorstellung in der Metropolitan Opera in New York. Domingo und Freni in Höchstform vor einem vollbesetzten, gebannt lauschenden Haus. Die Begräbnisszene näherte sich ihrem Höhepunkt. Vereint in Verdis zu Tränen rührendem »O terra addio« umarmte sich das tragische Liebespaar Radames und Aida, während sich die schweren Steinplatten, unter denen sie lebendig begraben wurden, qualvoll langsam herabsenkten. Hinter der Bühne sangen die Priester und Priesterinnen ihren unbarmherzigen Chor, und die unglückliche Amneris betete für Radames’ unsterbliche Seele. Es gibt Augenblicke in einer Oper, da stört es niemanden, wenn einige in ihren Sitzen hin und her zappeln, um einen besseren Blick auf die Bühne zu haben oder um ihrem schmerzenden Gesäß etwas Linderung zu verschaffen. Aber wenn Aida ihr ergreifendes Finale erreicht, wenn die Sklavin in Radames’ Armen ihr Leben aushaucht, dann ist die Stille im Publikum mit Händen greifbar, von den Orchestersesseln bis hinauf zum sechsten Rang.
So sollte es zumindest sein.
An diesem Abend gab es eine Störung im vorderen Parkett, den teuersten Plätzen in der Met. Ausgerechnet in diesem herzzerreißenden Augenblick schrillte eine Reihe von elektronischen Piepstönen über die singenden Stimmen hinweg, ein Rufsignal, das erheblich lauter war als die Armbanduhrwecker, die ständig in Kinos und Theatern losgehen. Irgendein Banause hatte seinen Pager mit in die Oper genommen.
»Das darf doch wohl nicht wahr sein!« schimpfte ein Mann in der Reihe dahinter los, ungeachtet der Tatsache, daß er die Störung nur noch verstärkte. Andere machten ihrem Ärger ebenfalls Luft: »Stellen Sie das ab, aber dalli« und noch Eindringlicheres war zu hören.
In der dritten Reihe, aus der das Piepsen kam, öffnete ein graumelierter Mann mit schwarzgeränderter Brille seine Smokingjacke, hakte den Pager aus dem Gürtel und drückte einen Knopf, der ihn verstummen ließ. Der gesamte Zwischenfall hatte nicht länger als sechs Sekunden gedauert, aber der Zeitpunkt hätte nicht unglücklicher gewählt sein können.
Und jetzt war der Vorhang gefallen, die Künstler nahmen den Applaus entgegen, und im mittleren Parkett waren genauso viele Augen auf den Mann in der dritten Reihe gerichtet wie auf Domingo. Unbändige Empörung schlug dem Übeltäter entgegen. So sehr er sich auch bemühte, nicht darauf zu achten, indem er energisch klatschte und stur auf die Bühne blickte, von den verärgerten Musikliebhabern um ihn herum konnte er keine Gnade erwarten. New Yorker sind nicht für ihre Zurückhaltung bekannt.
»Den würde ich gern lebendig begraben.«
»Wieso läßt man solche Trottel eigentlich hier rein?«
»Ich habe Karten für die Oper gekauft und nicht für eine Scheißgeschäftsbesprechung.«
Der Trottel, um den es ging, klatschte auch dann noch mit Vehemenz, als sich der Vorhang zum sechsten- oder siebtenmal hob, bis schließlich die Lichter im Saal angingen. Dann wandte er sich seiner Begleiterin zu, einer attraktiven, dunkelhaarigen Frau, die mindestens zwanzig Jahre jünger war als er, und versuchte, sie in ein so angeregtes Gespräch zu verwickeln, daß das übrige New York ausgeschlossen wurde.
Sie war alles andere als begeistert. Zur Genugtuung der Leute um sie herum, die nun aufstanden und sich in Richtung Ausgang bewegten, war die Lady nicht gewillt, über den Fauxpas hinwegzugehen. Nach wenigen Augenblicken konnte man nur noch sie hören, als sie ihm eine so lautstarke Standpauke erteilte, daß fast die Kronleuchter erbebten. »... noch nie so etwas Peinliches erlebt, und wenn du dir einbildest, ich würde jetzt noch mit dir zu Abend essen und anschließend eine flotte Nummer schieben, dann hast du dich aber geschnitten.«
Jemand rief: »Richtig so! Schick ihn in die Wüste!«
Und das tat sie. Sie stolzierte durch die Sitzreihe davon und ließ ihren Begleiter stehen, der ihr kopfschüttelnd nachsah. Er versuchte nicht, ihr zu folgen. Er blieb sitzen und ließ die Leute, die er gestört hatte, umsichtigerweise vorgehen. Als niemand mehr in seiner Nähe war, nahm er den Pager wieder heraus und tippte einige Nummern ein. Nachdem er eine Anzeige auf dem Display hatte, griff er in die Brusttasche und holte, ungeachtet der Umgebung, ein Handy hervor.
»Sammy, hast du versucht, mich zu erreichen? Wenn ja, hättest du dir wirklich einen besseren Zeitpunkt aussuchen können, Alter.« Während er zuhörte, rutschte er tief in den Sitz und legte die Füße auf die Reihe vor ihm. »Ach, zum Teufel. Ich hoffe für dich, daß diese Neuigkeit bei neun Komma neun auf der Richterskala liegt.«
Was er dann hörte, löste bei Manfred Flexner sichtliche Irritation aus. Er nahm die Füße herunter. Er beugte sich vor, als könnte er so besser hören. Mit der freien Hand fuhr er sich durchs Haar.
Sechs Minuten später wankte er, kopfschüttelnd und um Fassung bemüht, aus der Oper auf den Platz des Lincoln Center und sog ein paarmal tief die frische Luft ein. Um diese Zeit wimmelte es hier von Zobeln und Nerzen, das Publikum aus der Philharmonie und dem Ballett kämpfte mit den Opernbesuchern um die Taxis. Flexner hatte seinen eigenen Chauffeur, der auf der anderen Straßenseite in der Limousine wartete, also mußte er sich nicht beeilen. Nach Hause wollte er aber noch nicht. Eine Weile starrte er in den beleuchteten Brunnen. Während der letzten halben Stunde hatte er eine Oper gestört, seine Begleiterin verloren und war auf dem internationalen Aktienmarkt um vierzig Punkte abgerutscht. Er brauchte einen Drink.
Am nächsten Morgen sah die Welt nicht freundlicher aus. Er betrachtete die Alka-Seltzer, die in dem Glas auf seinem Schreibtisch sprudelten, und grübelte darüber nach, was hätte sein können. Manny Flexner war im Pharmageschäft.
Pharmazeutika.
Und er schluckte das Produkt der Konkurrenz! Sein ganzes Leben hatte er darauf hingearbeitet, irgendwann einmal einen Dauerbrenner wie Alka-Seltzer zu haben, der sich fast von selbst verkaufte. Er war das typische Beispiel für einen geschäftstüchtigen Jungen von der Lower East Side, der sich zunächst mit Taxifahren ein paar Dollar verdient hatte, eine Zeitlang bescheiden lebte und seinen Verdienst investierte. Da er wie alle echten Unternehmer schon in jungen Jahren erkannte, daß man mit Eigenarbeit und Ersparnissen nicht weit kommt, lieh er sich Geld bei einer Bank, um sich in eine kleine Firma einzukaufen, die Apotheken mit Etiketten belieferte. Als selbstklebende Etiketten aufkamen, hatte er schon fast eine marktbeherrschende Stellung und soviel verdient, daß er noch mehr Geld aufnehmen und in die Pharmabranche einsteigen konnte. In den sechziger und siebziger Jahren erlebte die Pharmaindustrie eine Hochkonjunktur. Manny Flexner hatte einige Firmen in den USA übernommen und expandierte international mit geschickten Aufkäufen in Europa und Südamerika. Eines der Manflex-Produkte, das Angina-Medikament Kaprofix, war zu einer lukrativen Einnahmequelle geworden, denn es verkaufte sich gut in Amerika und Europa.
Die Geschichte hatte aber auch ihre negative Seite. Pharmaunternehmen sind darauf angewiesen, neue Medikamente zu entwickeln; ohne umfangreiche Forschungsprogramme können sie nicht überleben. In den frühen achtziger Jahren hatten Wissenschaftler, die für Manflex tätig waren, einen neuen vielversprechenden Histamin-Antagonisten für die Behandlung von Magengeschwüren entdeckt. Er wurde patentiert und erhielt den Markennamen Fidoxin. Die Absatzmöglichkeiten für Medikamente gegen Magengeschwüre sind riesig. Damals beherrschte Tagamet von Smith-Kline den Markt und machte einen Umsatz von schätzungsweise über einer Milliarde Dollar. Glaxo entwickelte ein Konkurrenzprodukt namens Zantac, das sich womöglich besser verkaufte als jedes andere Medikament in der Welt. Aber Manny Flexner mischte mit.
Die ersten Forschungsergebnisse zu Fidoxin waren ermutigend. Manflex investierte gewaltige Summen in Studien und Feldversuche, um das Prüfungsgremium des Gesundheitsministeriums zufriedenzustellen, das über die Zulassung von Medikamenten entschied. 1981 sah es ganz danach aus, als würde Manflex seine Konkurrenten auf einem Milliarden-Dollar-Markt aus dem Rennen werfen. Doch dann, in der Endphase, wurden bei Patienten, die Fidoxin über einen längeren Zeitraum eingenommen hatten, Nebenwirkungen festgestellt. Fast jedes Mittel hat unerwünschte Nebenwirkungen, doch das Risiko einer ernsten Nierenschädigung ist inakzeptabel. Wohl oder übel mußte Manny Flexner seine Verluste abschreiben und das Projekt einstellen.
Manflex hatte zuviel in dieses Medikament investiert, so daß Manny in den achtziger Jahren bei neuen Forschungsprojekten zurückhaltender war. Die Rezession von 1991 hatte Manflex härter getroffen als die Konkurrenten. Vor allem dank seines altbewährten Produkts Kaprofix zählte das Unternehmen noch immer zu den Top Ten in den USA, aber es war vom vierten auf den siebten Platz zurückgefallen. Oder noch tiefer. Manny wollte es gar nicht mehr so genau wissen.
Heute war der bislang schwärzeste Tag. Er hatte das »Wall Street Journal« vor sich liegen. Seine Aktien waren über Nacht in Tokio und New York in den Keller gerutscht. Der Grund?
»Man spricht vom größten Feuerwerk seit Menschengedenken«, las er seinem Stellvertreter Michael Leapman vor und warf ihm dann die Zeitung zu. »Ein Feuer für zwanzig Milliarden Lire. Die Flammen waren noch dreißig Kilometer südlich von Mailand zu sehen. Wieviel ist das, Michael?«
»Ungefähr zwanzig Meilen.«
»Die Lire, zum Donnerwetter.«
»Nicht so wild, wie’s klingt. Etwa siebzehn Millionen Dollar.«
»Nicht so wild«, wiederholte Manny ironisch. »Eine ganze Fabrik geht in Flammen auf, ein Viertel unserer Beteiligungen in Italien, und es ist nicht so schlimm.«
»Versicherung«, murmelte Michael Leapman.
»Die Versicherung übernimmt die Fabrik und die Materialien. Aber wir hatten da Forschungslabors. Sie haben ein Mittel gegen Depressionen getestet. Depressionen. Ich hoffe bei Gott, daß noch ein bißchen von dem Zeug übriggeblieben ist, ich kann’s nämlich gebrauchen. Forschung ist unersetzlich, und der Markt weiß das. Wissen wir schon Genaueres aus Italien? Ist alles hin?«
Leapman nickte. »Ich habe vor einer Stunde mit Rico Villa gesprochen. Das Ganze ist nur noch ein Haufen weißer Asche.« Er ging durch den Raum zum Getränkeschrank und nahm den Scotch heraus. »Möchtest du einen?«
Manny schüttelte den Kopf und deutete auf das Alka-Seltzer.
»Was dagegen, wenn ich mir einen genehmige?« Michael Leapman, siebenunddreißig, einssiebenundachtzig und blond, war weniger temperamentvoll als sein Chef. Er war halb Schwede. Vermutlich bewahrte ihn die schwedische Hälfte davor, aus der Haut zu fahren. Er war vor fünf Jahren zu Manflex gestoßen, ohne selbst etwas dafür zu tun. Flexner hatte in Detroit eine kleine Firma gekauft, deren Geschäftsführer Leapman war; wie sich herausstellte, war Leapman der einzige Gewinn bei dieser Übernahme, ein kreativer Kopf mit hervorragendem Organisationstalent. Er hatte ein gutes Verhältnis zu seinem zähen, kleinen Boß entwickelt und wurde schon nach nur einem Jahr in den Vorstand berufen.
»Irgendwelche Toten?« fragte Manny. Seine Stimme verriet, daß er an diesem Tag nur schlechte Nachrichten erwartete.
»Offenbar nicht. Sieben Leute sind im Krankenhaus, zwei davon Feuerwehrleute mit Rauchvergiftung. Das ist alles.«
»Umweltschäden?«
Leapman zog eine Augenbraue hoch. Sein Boß war nicht dafür bekannt, daß er eine Schwäche für die Grünen hatte.
»Das könnte uns richtig Ärger einbringen«, sagte Manny. »Denk nur an Seveso. Die Dioxindämpfe. Und es war in Italien, meine ich. Wie viele Millionen mußten die Besitzer an Entschädigung blechen?«
Leapman goß sich großzügig Scotch ein. »Von giftigen Dämpfen ist bisher nicht die Rede gewesen.«
Die Anspannung in Mannys Gesicht ließ ein wenig nach. Er nahm seine Brille ab und wischte sie mit einem Papiertaschentuch ab, das er aus einer Manflex-Packung zog.
»Wir werden schon damit fertig«, sagte Leapman mit Überzeugung. Zuversicht zu verbreiten, war eines seiner nützlichsten Talente. »Natürlich, wir werden ein blaues Auge davontragen. Ein oder zwei Wochen lang werden wir schlechter notiert werden, aber wir sind groß genug, um das zu verkraften. Das Werk bei Mailand hat ohnehin nicht viel Gewinn abgeworfen. Rico hat uns dauernd in den Ohren gelegen, es müsse modernisiert werden.
»Ich weiß, ich weiß. Wir wollten doch gegen Ende des Jahres einiges Kapital reinstecken.«
»Jetzt können wir uns vordringlich um die beiden Werke bei Rom kümmern.«
Manny setzte die Brille wieder auf und musterte Leapman. »Meinst du nicht, wir sollten in Mailand wieder aufbauen?«
»Bei dem derzeitigen wirtschaftlichen Klima?« Sein Ton war unmißverständlich. Ein Wiederaufbau kam nicht in Frage.
»Du hast recht. Wir sollten uns auf das konzentrieren, was wir da drüben haben, und Mailand verkaufen.« Manny hatte die Möglichkeiten abgewogen und schien nun beruhigt. »Ich möchte, daß jemand nach Italien fährt und dort alles in Ordnung bringt, Personalprobleme löst und soviel wie möglich aus diesem Fiasko für uns rettet.« Er zögerte, als suchte er nach einem Namen. »Was meinst du, wer dafür in Frage kommt? Würdest du sagen, daß David das schafft?«
»David?« Der Name erwischte Leapman auf dem falschen Fuß. Er hatte fest damit gerechnet, selbst mit dieser Aufgabe betraut zu werden.
»Mein Junge.«
»Keine Frage.« Leapman war zu klug, als daß er versucht hätte, seinen Chef davon abzubringen, die Aufgabe seinem Sohn zu übertragen, ganz gleich, was er insgeheim davon hielt. Der junge David Flexner – jung, aber beileibe kein Junge mehr – legte keineswegs die seinem Vater eigene Begeisterung für das Unternehmen an den Tag, und doch hegte Manny die unsinnige Hoffnung, daß sein Sohn eines Tages seinen Beitrag leisten würde. Nach vierjährigem Studium der Wirtschaftswissenschaften und drei Jahren im Vorstand von Manflex hätte David eigentlich soweit sein müssen, Führungsaufgaben zu übernehmen. In Wahrheit steckte er all seine Energie in die Hobbyfilmerei.
Am späten Vormittag zeichnete sich auf den Bildschirmen in dem großen Büro neben dem von Manny Flexner eine gewisse Erholung der Aktienkurse des Konzerns ab. Wall Street hatte sich an Tokio und London orientiert und auf die Nachricht von dem Feuer zunächst überreagiert. Jetzt setzte sich eine gemäßigtere Haltung durch. Der Manflex-Konzern hatte zwar einen schweren Rückschlag erlitten, war aber letztlich nicht ernsthaft gefährdet.
Manny demonstrierte seine Zuversicht, indem er seinen Sohn zum Lunch in das Four Seasons einlud. Manny war zweimal geschieden und lebte allein. Das heißt, offiziell lebte er allein. In Wahrheit hatte er eine ganze Reihe von Freundinnen, die sich darin abwechselten, ihn zum Dinner in New Yorks besten Restaurants zu begleiten, und die hinterher die Nacht in seinem Haus an der Upper East Side verbrachten. Daher wußte er, wo man gut essen konnte. Und er mußte sich gut ernähren, um seine Vitalität zu bewahren. Er war dreiundsechzig.
Die Mittagsmahlzeiten jedoch blieben stets dem Geschäft vorbehalten.
»Ich empfehle den Lachs in süßer Senfsauce. Oder den Entensalat mit Sauerkirschen. Nein, probier den Lachs. Der ist wirklich köstlich. Hast du von dem Feuer in Mailand gehört?«
Offensichtlich hatte sein Sohn nicht in den Wirtschaftsteil der Zeitung geschaut. David war über das Alter jugendlicher Rebellion hinaus. Er war ein erwachsener Rebell, mit blondgefärbtem Haar, das ihm bis auf die Schultern fiel. Manny fand, daß blonde Haare nun mal nicht zu einem jüdischen Jungen paßten. Das dunkelgrüne Kordjackett, das David trug, war eine Konzession an die Spielregeln im Restaurant. An Vorstandssitzungen nahm er häufig im T-Shirt teil.
Manny klärte ihn über die wichtigsten unangenehmen Punkte auf und eröffnete ihm seinen Plan, wie er in Italien weiter vorgehen wollte.
»Ich soll dahin? Das könnte schwierig werden, Pop«, sagte David wie aus der Pistole geschossen. »Wann?«
»Wie wär’s mit heute abend?«
David lächelte. Sein gewinnendes Lächeln war zugleich ein Vorteil und ein Nachteil. »Das ist nicht dein Ernst?«
»Mein voller Ernst. Ich habe da zweihundert Leute ohne Arbeit, man muß mit den Gewerkschaften verhandeln ...«
»Ja, aber ...«
»Der Anspruch an die Versicherung muß geltend gemacht werden, und mit Sicherheit wird es Gerichtsprozesse geben. Das muß alles geregelt werden, David.«
»Und Rico Villa? Er ist vor Ort, und er spricht die Sprache.«
Manny verzog das Gesicht und zuckte die Achseln. »Rico könnte noch nicht mal ein Schulsportfest organisieren.«
»Du willst also, daß ich nach Mailand fliege und das Kriegsbeil schwinge.«
»Du sollst den Leuten da bloß die Fakten klarmachen, mehr nicht. Ihr Arbeitsplatz ist nur noch ein Haufen Asche. Es hat keinen Sinn, die Fabrik wieder aufzubauen. Falls einige bereit sind, nach Rom zu wechseln, okay. Verhandle über Abfindungen. Wir werden so großzügig wie möglich sein. Wir sind schließlich keine Ungeheuer.«
David seufzte. »Pop, ich kann hier nicht alles stehen und liegen lassen.«
Obwohl Manny damit gerechnet hatte, tat er überrascht. »Was meinst du damit?«
»Ich habe meine Verpflichtungen. Ein paar Leute sind von mir abhängig, sie verlassen sich auf mich.«
Manny starrte ihn durchdringend an. »Haben die Verpflichtungen auch nur im entferntesten etwas mit Manflex zu tun?«
Sein Sohn errötete. »Nein, es geht um ein Filmprojekt. Wir haben einen Zeitplan.«
Der Kellner kam, einen Sekundenbruchteil bevor Manny aus der Haut fahren konnte. Vater und Sohn schlossen Burgfrieden, solange die gastronomischen Entscheidungen getroffen werden mußten. David wählte diplomatisch den Lachs, den sein Vater empfohlen hatte. Es würde ihn keine Überwindung kosten. Als sie wieder allein waren, versuchte Manny es anders. »Einige der besten Filme, die ich je gesehen habe, sind in Italien gemacht worden.«
»Natürlich. Das italienische Kino zählt zu den besten. Schon immer. ›Fahrraddiebe‹. ›Tod in Venedig‹. ›Der Garten der Finzi Contini‹.«
»›Für eine Handvoll Dollar‹.«
David stellte sich sphinxhaft. »Ach – du meinst Spaghettiwestern.«
Manny nickte und sagte dann großzügig: »Du könntest diese Typen doch kennenlernen. Nimm dir ein paar Wochen länger. Bring in Mailand alles in Ordnung, und danach hast du freie Hand, Junge. Fahr nach Venedig. Ist das ein Angebot?«
Soviel Selbstlosigkeit von einem Workaholic verdiente eine Minute atemloser Anerkennung und erhielt sie auch.
Schließlich gestand David. »Pop, ich weiß, du möchtest, daß ich eines Tages in deine Fußstapfen trete, aber ich denke, ich sollte dir sagen, daß mich die Pharmaindustrie zum Erbrechen langweilt.«
»Du erzählst mir nichts Neues.«
»Aber du willst es einfach nicht akzeptieren.«
»Weil du dem Geschäft keine Chance gibst. Hör zu, David. Das ist die spannendste Branche, die es gibt. Es geht um neue Medikamente und darum, neue Marktanteile zu gewinnen.«
»Das habe ich auch schon verstanden«, sagte David lakonisch.
»Ein einziger Erfolg, ein neues Medikament, kann dein ganzes Leben verändern. Das ist für mich der Kick.«
»Du meinst, es kann das Leben eines kranken Menschen verändern.«
»Natürlich«, sagte Manny, ohne zu zögern. »Nur was den Kranken guttut, tut auch meiner Bilanz gut.«
Er zwinkerte, und sein Sohn mußte unwillkürlich grinsen. Diese Ethik mochte fragwürdig sein, aber die Freimütigkeit war unwiderstehlich.
»Forscherteams sind wie Rennpferde. Man will immer so viele haben, wie man sich leisten kann. Hin und wieder kommt eines davon als erstes ins Ziel. Aber du darfst dich nie zufriedengeben. Wenn du das Medikament dann hast, brauchst du immer noch die staatliche Genehmigung, um es zu vermarkten.« Mannys Augen funkelten angesichts der Herausforderung. In letzter Zeit lächelte er nicht mehr oft, aber gelegentlich huschte ein Ausdruck über sein erschöpftes Gesicht, der Ausdruck eines Mannes, der früher einmal Treffer gelandet hatte, aber anscheinend das Händchen dafür verloren hatte. »Und in Null Komma nix läuft das Patent ab, und du mußt was Neues finden. Ich habe rund um den Globus Teams, die für mich arbeiten. Jeden Augenblick könnten sie das Mittel gegen eine tödliche Krankheit entdecken.«
David nickte. »In dem Werk bei Mailand gab es eine große Forschungs- und Entwicklungsabteilung.«
Manny sagte beifällig: »Du weißt mehr, als du dir anmerken läßt.«
»Du glaubst anscheinend wirklich, daß ich die Sache regeln kann.«
»Deshalb bitte ich dich ja darum, mein Sohn.« Er winkte dem Weinkellner. Nachdem er einen guten Bordeaux ausgesucht hatte, sagte er zu seinem Sohn: »Der Ärger in Italien ist mir an die Nieren gegangen. Ich habe immer geglaubt, daß irgendwer da oben auf meiner Seite ist. Verstehst du, was ich meine? Vielleicht sollte ich mich zur Ruhe setzen.«
»Pop, das ist verrückt, und du weißt es. Wer soll den Laden denn sonst schmeißen?« Dann bemerkte David den eindringlichen Blick seines Vaters. »Oh, nein. Das ist nichts für mich. Ich hab dir doch schon so oft gesagt, daß ich nicht weiß, was ich von der Branche halten soll. Wenn es bloß darum ginge, Medikamente zu machen, die kranken Menschen helfen, okay. Aber wir wissen doch beide, daß dem nicht so ist. Es geht um Beziehungen, darum, sich gut mit Politikern und Bankern zu stellen. Um das, was unter dem Strich rauskommt.«
»Nenn mir eine Branche, in der es nicht darum geht. Das ist nun mal die Welt, in der wir leben, David.«
»Ja, aber die Profite stecken nicht in den Medikamenten, die Leute heilen. Zum Beispiel Arthritis. Wenn wir dafür ein Heilmittel finden, verlieren wir einen prima Markt, also entwickeln wir lieber weiter Medikamente, die den Schmerz betäuben. Sie unterscheiden sich kaum von Aspirin, bloß daß sie fünfzigmal so teuer sind. Wie viele Millionen werden wohl im Augenblick für Nachahmer gegen Arthritis ausgegeben?«
Manny antwortete nicht. Aber er registrierte befriedigt, daß sein Sohn den Branchenjargon benutzte. Ein ›Nachahmer‹ war ein Imitat, leicht abgewandelt, um die Zulassung zu erhalten. Es gab über dreißig solcher Mittel zur Behandlung von Arthritis.
David wurde allmählich wütend. »Aber wieviel wird in die Erforschung der Sichelzellenanämie gesteckt? Die Krankheit tritt zufällig vor allem in Dritte-Welt-Ländern auf, also würde sie nicht viel Profit bringen.«
»In deinem Alter war ich auch ein Idealist«, sagte Manny.
»Und jetzt wirst du mir sagen, daß du in der realen Welt lebst, aber das tust du nicht, Pop. Du willst von der realen Welt nichts wissen, bis du die Augen nicht mehr verschließen kannst, wie beispielsweise bei AIDS. Ich meine nicht dich persönlich. Ich meine die gesamte Industrie.«
»Nun hör aber auf. Die Branche hat sehr schnell auf AIDS reagiert. Wellcome hat in Rekordzeit Retrovir auf den Markt gebracht.«
»Ja, und gleichzeitig sind ihre Aktienkurse um 250 Prozent hochgeschnellt.«
Manny zuckte die Achseln. »Die Gesetze des Marktes. Wellcome hatte das Wundermittel zuerst.«
David spreizte die Hände, um zu signalisieren, daß seine Meinung damit bestätigt war.
Der Kellner kam und goß Manny etwas Wein zum Kosten ein. Nachdem er ihm zugenickt hatte, sagte Manny listig zu seinem Sohn: »Du weißt mehr, als du dir manchmal anmerken läßt. Wenn du Vorstandsvorsitzender wirst, bist du allmächtig. Wenn du willst, kannst du ja versuchen, ein bißchen Ethik in die Pharmaindustrie einzubringen.«
David lächelte. Nach all den Jahren besaß sein Vater noch immer die Chuzpe eines New Yorker Taxifahrers.
»Dann wollen wir dir mal einen Platz in der Abendmaschine nach Mailand reservieren«, sagte Manny und holte sein Handy hervor.