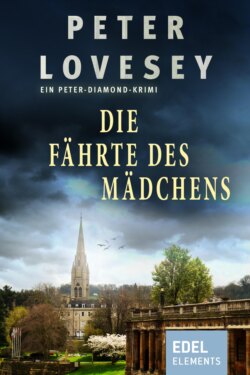Читать книгу Die Fährte des Mädchens - Peter Lovesey - Страница 9
Kapitel fünf
ОглавлениеDie Bibliothek in Kensington wurde 1960 erbaut, aber der Lesesaal im oberen Stock hat eine eindeutig viktorianische Atmosphäre. Der Teppich ist freudlos olivgrün, und die Polstersessel sind in dunklem Leder gehalten. Überall hängen Plakate, auf denen die Leser vor Taschendieben gewarnt und gebeten werden, sofort das Personal zu verständigen, wenn sie sehen, daß jemand Zeitschriften beschädigt oder mitnimmt. Zugegeben, einige dieser Zeitschriften sind höchst begehrt. Der »Evening Standard«, der am frühen Nachmittag geliefert wird, kann nur auf Nachfrage eingesehen werden – nicht, weil sein Inhalt irgendwie anstößig wäre, sondern weil er aus der Auslage verschwinden und nie wieder auftauchen würde. Im Laufe der Zeit kennen die Angestellten die Männer mit den glänzenden Augen, die von zwei Uhr nachmittags an bei ihnen rumhängen und darauf hoffen, als erste ein günstiges Gebrauchtwagenangebot zu entdecken, einen Tip fürs Hunderennen oder eine Stellenanzeige.
Peter Diamond – ehemals beim Sicherheitsdienst von Harrods – gehörte jetzt auch zu diesen Stellungssuchenden.
Endlich war er an der Reihe, den »Standard« durchzusehen, und fuhr mit dem Daumen die Spalten entlang. Wenn er fand, daß eine der angebotenen Stellen für ihn in Frage kam, würde er zum nächsten Telefon eilen. Die meisten Anzeigen schlugen einen freundlichen Ton an – »Rufen Sie unsere Sachbearbeiterin an« oder »Unsere Personalchefin freut sich auf Ihren Anruf« –, so daß man sich förmlich eine nette Dame am anderen Ende der Leitung vorstellen konnte, die darauf brannte, über den vorzüglich bezahlten Posten mit Leistungsbonus und Altersversorgung zu sprechen. Doch wie üblich schien heute in ganz London keine gute Fee eine offene Stelle für einen achtundvierzigjährigen Exdetective zu haben, dem nicht einmal zuzutrauen war, ein Stockwerk bei Harrods zu sichern.
Er gab auf. Unter der Schlagzeile »VERZWEIFLUNG BEI LONDONS BESCHÄFTIGUNGSLOSEN« meldete der »Standard« einen weiteren Anstieg der Arbeitslosenzahlen. Außer Diamonds hängenden Schultern deutete nicht viel auf die Verzweiflung auf der Kensington High Street hin. Junge Frauen mit bunten Plastiktüten voller Leckereien aus den Supermärkten standen am Straßenrand und versuchten Taxis zu bekommen. Männer mittleren Alters in Designertrainingsanzügen joggten Richtung Holland Park. Noch immer war das Al Gallo D’Oro, ein italienisches Restaurant auf der anderen Straßenseite, nach dem mittäglichen Andrang voll besetzt.
Seit nunmehr sieben Monaten lebten Diamond und seine Frau Stephanie eher schlecht als recht in einer Souterrainwohnung auf der Addison Road, einer Einbahnstraße, wo der Verkehrslärm ohne Doppelglasfenster und Ohrstöpsel beinahe unerträglich war. Das Haus war ein stuckverziertes, dreistöckiges Gebäude mit vermoderten Fensterrahmen, die unablässig bebten. Gegenüber war St. Barnabas, ein großer, rußfleckiger Klotz mit einem Türmchen auf jeder Ecke, der beim besten Willen nicht als schöne Kirche bezeichnet werden konnte, obwohl eine Reinigung der Fassade vielleicht einiges bewirkt hätte. Abgesehen von den Türmen von St. Barnabas konnten sie aus ihrem Fuchsbau lediglich die oberen Etagen hoher Mietshäuser sehen. Es war ein gewaltiger Unterschied zu dem Blick über das georgianische Bath, den sie bis vor einem Jahr genossen hatten.
Da er nicht untätig sein wollte, hatte Diamond Wände und Decken der Wohnung mit einer Dispersionsfarbe gestrichen, die auf der Farbtafel als Primelgelb bezeichnet wurde. Er hatte jede Schublade und jeden Schrank ausgeräumt, jede Türangel geölt, den Schornstein gefegt, alle Steckdosen kontrolliert, die Dichtungsringe an den Wasserhähnen ausgetauscht und alle Türen abgedichtet. Sein bewundernswerter Eifer hatte nur den Nachteil, daß er kein Heimwerker war, und so bekam er Öl und Farbe an die Schuhsohlen und trug sie durch die ganze Wohnung, die Wasserhähne tropften schlimmer denn je, die Türen klemmten, bei jedem Windstoß fiel Ruß ins Wohnzimmer, und die Katze hatte sich verstört in den Wäscheschrank geflüchtet.
Stephanie Diamond hätte es am liebsten der Katze gleichgetan. Sie arbeitete an zwei Vormittagen in der Woche in einem UNICEF-Laden und hatte ihre Arbeitszeit vor kurzem verdoppelt, nur um aus dem Haus zu sein. Um die Heimwerkermanie ihres Gatten zu dämpfen, brachte sie seit neuestem Puzzles mit nach Hause, die gestiftet worden waren, so daß Peter sich damit beschäftigen konnte, sie zusammenzusetzen, um festzustellen, ob Teile fehlten, bevor sie im Laden verkauft wurden. Die Idee war nicht so gut, wie sie zunächst schien. Eines Nachts wachte Stephanie gegen vier Uhr auf, weil sich etwas in ihren Rücken bohrte.
»Was um Himmels willen ...?« Sie schaltete die Nachttischlampe ein.
Diamond sah nach. »Na, wer sagt’s denn! Das ist das Eckstück, das mir gefehlt hat.«
»Zum Donnerwetter, Pete.«
»Tasse Tee?«
Sie erinnerte sich an den Geschmack des Tees, seit er den Kessel entkalkt hatte. »Nein, schlaf weiter.«
»Weiß der Himmel, wie das ausgerechnet hier hingekommen ist.«
»Ach, vergiß es.«
Nach einer Pause sagte er: »Stephanie, bist du wach?«
Sie seufzte. »Jetzt ja.«
»Ich habe über das Kind nachgedacht.«
»Welches Kind?«
»Das japanische Mädchen, wegen dem ich rausgeflogen bin. Warum setzt jemand so ein Kind einfach aus? Es war gut angezogen. Sauber. In keinster Weise vernachlässigt.«
»Vielleicht ist sie von zu Hause weggelaufen.«
»Und dann irgendwie im siebten Stock von Harrods gelandet? Das kann ich mir nicht vorstellen.«
»Es nützt nichts, darüber nachzugrübeln«, sagte Stephanie. »Du hast nichts damit zu tun.«
»Stimmt.«
Er schwieg eine Weile.
Sie war fast eingeschlafen, als er sagte: »Es muß doch eine Möglichkeit geben, daß alle Teile an einem Ort bleiben.«
»Hä?«
»Die Puzzles. Ich hab mir gedacht, wenn ich im Laden mithelfen würde...«
Sie setzte sich gerade auf. »Untersteh dich!«
»Ich wollte sagen, daß ich die Puzzles da machen könnte, und wenn dann Teile fehlen, wüßten wir wenigstens, daß sie irgendwo im Laden sein müssen.«
»Wenn du auch nur einen Fuß in diesen Laden setzt, Peter Diamond, verläßt du ihn auf einer Trage, wenn ich mit dir fertig bin.« Eine kühne Behauptung angesichts der Tatsache, daß sie ungefähr fünfzig Kilo wog und er hundertsechsundzwanzig, aber sie wußte, welche Verwüstungen er – in aller Unschuld wohlgemerkt – bei dem vielen Kram dort anrichten konnte. Schon als sie ihn heiratete, hatte sie gewußt, daß er zu Mißgeschicken neigte. Er war schlecht koordiniert. Manche dicken Menschen bewegen sich mit Anmut. Ihr Gatte tat das nicht. Er stieß Dinge um. Auf der Straße übersah er regelmäßig den Bordstein. Gefahrenquellen wie beispielsweise Hundehaufen schienen ihn magnetisch anzuziehen.
»Das ödet mich an, ich hab keine Lust mehr«, sagte er am nächsten Morgen beim Frühstück.
»Angeln?« fragte Stephanie.
Er zuckte die Achseln.
»Na schön, dann sag ich es. Du bist nicht so alt.«
»Offenbar zu alt, um zu arbeiten.«
»Peter, hör auf damit.«
»Du solltest sie mal beim Arbeitsamt Schlange stehen sehen. Jüngere Männer als mich. Manche von ihnen sind viel jünger. Kinder, frisch von der Schule.«
Sie häufte durchwachsenen Speck auf seinen Teller. »Es könnte schlimmer sein.«
»Du meinst, eines von diesen arbeitslosen Kindern könnte unseres sein.«
Sie sah weg, und er verfluchte sich selbst für seine Taktlosigkeit. In ihrer ersten Ehe mit einem Betriebsleiter hatte Steph drei Fehlgeburten gehabt. Nachdem sie Diamond geheiratet hatte, verlor sie noch ein Baby. Es hatte Komplikationen gegeben, die schließlich durch eine Hysterektomie gelöst wurden. In den frühen siebziger Jahren war man mit solchen Operationen rasch bei der Hand. Sie hatte ihre Gebärmutter verloren, aber nicht ihren mütterlichen Instinkt. Bevor er sie kennenlernte, war sie Gruppenleiterin bei den Jungpfadfinderinnen gewesen. Das machte sie jahrelang und mit mehr Engagement, als Baden-Powell sich je hätte träumen lassen. Immer war sie bereit, die Ersatzmutti für kleine Mädchen zu spielen, die von ihren Eltern vernachlässigt wurden. Die waren jetzt alle junge Erwachsene, und manchen von ihnen schrieb sie noch immer.
Er legte seine Hand auf ihre und sagte: »Tut mir leid wegen letzte Nacht, Schatz.«
Ihr Gesicht nahm einen verwunderten Ausdruck an. »Letzte Nacht?«
»Im Bett.«
Sie starrte ihn mit großen Augen an.
»Das Puzzleteilchen.«
»Ach!« Sie lachte. »Das hatte ich schon ganz vergessen. Ich dachte, du redest von was völlig anderem. Ich wußte jetzt gar nicht, was du meinst.«
Es war ein schöner Tag nach über einer Woche grauem Himmel und Regen, deshalb stellte er sich nicht wieder in die Schlange in der Bibliothek, sondern ging zu einem Kiosk, gönnte sich eine eigene Ausgabe des »Evening Standard« und nahm sie mit in den Holland Park, um die Stellenanzeigen zu studieren. Da nichts für ihn dabei war, legte er die Zeitung beiseite und sonnte sich eine Weile auf einer der Holzbänke mit Blick auf den See neben der Orangerie, beobachtete Leute, die ihre Hunde ausführten oder mit ihren Kinderwagen spazierengingen. Alle außer ihm hatten etwas dabei, irgendeinen sichtbaren Grund, warum sie im Park waren. Ein Modellflugzeug, einen Tennisschläger, eine Fotokamera, einen Stock mit Nagelspitze, um Abfall aufzuspießen.
Er stand entschlossen auf. Verdammt, er hatte keinen Grund, hier untätig herumzusitzen. Ihm war eine dringende Arbeit eingefallen. Über Nacht waren an der frischgestrichenen Küchendecke zwei Luftblasen entstanden. Stephanie hatte nichts gesagt, aber er war sicher, daß es ihr aufgefallen war. Er wollte versuchen, die Blasen mit Schmirgelpapier abzuschleifen.
Zu Hause angekommen, breitete er, um keine Unordnung zu machen, den »Standard« auf dem Küchenboden unter dem Teil der Decke aus, den er schmirgeln wollte. Dann stieg er auf einen Stuhl und betrachtete das Problem genauer. Es gab zwei Blasen, groß wie Marshmallows. Keine Frage, sie mußten entfernt werden. Er pikste mit dem Fingernagel in eine hinein. Die Farbe war getrocknet, also zog er versuchsweise daran. Sie war geschmeidig und elastisch, wie Plastik. Er zog fester, und plötzlich löste sich ein ziemlich großes Stück des Farbanstrichs von der Decke und klatschte ihm auf Kopf und Schultern wie ein Brautschleier.
Er fluchte, stieg vom Stuhl, machte sich sauber und untersuchte den Schaden. Jetzt war es mit einfachem Abschmirgeln nicht mehr getan. Die ganze Decke mußte abgekratzt und neu gestrichen werden. Noch schlimmer, sie mußte gereinigt werden, bevor er die Farbe auftrug. Selbst für einen Laien war offensichtlich, daß er vor dem Anstrich das Fett und den Schmutz vom jahrelangen Kochen hätte entfernen müssen. Die Dispersionsfarbe hatte nicht gehalten. Um rasche Ergebnisse zu erzielen, hatte er einen ganzen Topf Farbe verschwendet. In wenigen Stunden würde Stephanie zurückkommen und ihre Küche erneut im Belagerungszustand vorfinden.
Zu größeren Renovierungsarbeiten entschlossen, zog er den Rest der Farbe ab. Sie löste sich in großen Stücken, die sich wie Staubdecken auf die Küchengeräte, den Tisch und die Stühle legten. Nachdem das getan war, setzte er den Kessel auf. Er hatte sich eine Pause verdient, bevor er anfing, die Decke zu säubern.
Aber sie wurde weder gesäubert noch neu gestrichen. Etwas Dringendes kam dazwischen.
Als Stephanie nach Hause kam, war die Küche ein Katastrophengebiet, überall hingen Lappen aus getrockneter Dispersionsfarbe, die Decke war so unappetitlich wie an dem Tag, als sie hier eingezogen waren, Zeitungen und Schmirgelpapier lagen auf dem Boden herum, und eine halbleere Tasse mit kaltem Tee stand auf dem Tisch. Diamond war nicht da. Schließlich kam er gegen sieben nach Hause und entschuldigte sich überschwenglich.
»Aber ich hatte einen interessanten Nachmittag, Steph.«
»Das scheint mir auch so.«
Er erzählte die Geschichte mit der Farbe. »Als ich sie dann von der Decke hatte, hab ich mir einen Tee gemacht, weil ich so fertig war, und während ich den Tee trank, habe ich zufällig einen Teil vom ›Standard‹ aufgehoben, mit dem ich den Boden abgedeckt hatte, damit er nicht schmutzig wird, verstehst du?«
»Darauf wäre ich nicht gekommen.«
»Ich wollte mich ein bißchen ablenken, kurz was lesen und da ...«
»Du hast einen Job in der Zeitung gefunden? Oh, Peter!« Sie wandte sich zu ihm um und breitete die Arme aus.
»Einen Job? Nein.«
Ihre Arme sanken nach unten. »Was denn dann?«
»Das wollte ich ja gerade erzählen. Ich hab die Zeitung aufgehoben und das hier gesehen.« Er reichte ihr ein Stück aus der Zeitung.
Sie las:
»GEHEIMNISVOLLES MÄDCHEN
NOCH IMMER NICHT IDENTIFIZIERT
Das Mädchen, das vor fünf Wochen bei Harrods einen Bombenalarm auslöste, ist noch immer nicht identifiziert worden. Die Kleine, die auf zirka sieben Jahre geschätzt wird, ist nicht in der Lage oder nicht willens zu reden. Eine öffentliche Kampagne, um ihre Eltern zu finden, blieb bislang trotz intensiver Bemühungen in der japanischen Bevölkerungsgruppe ohne Erfolg. Das Kind befindet sich unterdessen in der Obhut des Jugendamtes Kensington & Chelsea. Eine Sprecherin sagte: ›Es ist uns unbegreiflich, warum sich bis jetzt niemand gemeldet hat, der sie kennt.‹«
»Armes Würmchen«, sagte Stephanie, stets bereit, ihre eigenen Sorgen zu vergessen, wenn es um Kinder ging. »Sie muß völlig verstört sein. Erst die Polizei und jetzt das Jugendamt. Wundert mich nicht, daß sie schweigt.«
»Dann hast du also nichts dagegen, wenn ich versuche, ihr zu helfen?« sagte Diamond.
Sie sah ihn mißtrauisch an. »Wenn doch, würde das was ändern?«
»Ich habe herausgefunden, wo sie ist.«
Stephanie runzelte die Stirn, starrte ihn an und blickte dann milder drein. »Deshalb hast du alles stehen- und liegenlassen und bist aus dem Haus? Um das kleine Mädchen zu besuchen? Peter, im Grunde deines Herzens bist du ein Softie.«
»Softie?« sagte er. »Du nennst einen Exbullen einen Softie?«
»Für Kinder hast du dir immer Zeit genommen«, beharrte sie. »Wer hat sich denn letztes Jahr als Weihnachtsmann anstellen lassen?«
»Das war Arbeit. Dieses verlassene Kind ist eine Herausforderung, Steph. Eine Gelegenheit, das zu tun, wovon ich was verstehe, anstatt auf einem Stuhl zu stehen und eine Decke zu schrubben – was ich natürlich noch machen werde, versprochen. Gib’s zu, ich hab Erfahrung. Ich war ein verdammt guter Schnüffler.«
»Mit einem Herz aus Gold.«
Er drehte abwehrend die Augen gen Himmel – und starrte auf die Fettschlieren. »Jedenfalls war ich im Rathaus, und die wollten mir nichts sagen. Verständlich, ich hätte ja irgendein Perverser sein können. Also bin ich zur Polizei, hab ihnen gesagt, daß ich ein Exkollege bin, und bekam eine Adresse. Wo die Kleine vorläufig untergebracht ist. Als ich dahin kam, war sie natürlich schon verlegt worden. Um sie aufzuspüren, mußte ich regelrecht vorgehen wie Sherlock Holmes. Sie haben mir einen Kinderpsychiater genannt, der war zwar nicht sehr hilfreich, aber seine Sekretärin hatte Mitleid und gab mir die Adresse von einer Sonderschule in Earls Court.«
»Sonderschule?« fragte Stephanie skeptisch. »Du meinst für geistig behinderte Kinder?«
Er nickte.
»Ist sie geistig zurückgeblieben?«
»Das hat so deutlich keiner gesagt, aber da haben sie sie hingeschickt.«
»Sie denken wahrscheinlich, daß sie das ist. Wie ist die Schule?«
»Die Kinder wohnen dort. Heute nachmittag hab ich es nicht mehr geschafft, dorthin zu kommen, aber morgen werde ich es versuchen. Anscheinend haben sie noch nicht ganz aufgegeben. Eine japanische Lehrerin kommt zur Schule und versucht, sie zum Reden zu bringen. Bislang ohne Erfolg.«
Stephanie blickte finster. »Wenn alle anderen gescheitert sind, was willst du dann machen? Du kannst kein Japanisch.«
»Das will ich auch nicht versuchen. Könnte ja sein, daß sich alle viel zu sehr auf das Sprachproblem konzentrieren. Ich möchte eine andere Methode probieren.«
»Zum Beispiel?«
Er wollte sich nicht festlegen. »Zuerst muß ich das Vertrauen des Kindes gewinnen. Ich habe die Zeit dafür, Steph. Zum ersten Mal im Leben sitzt mir niemand im Nacken.«
»Nun ja«, sagte Stephanie und ließ ihren Blick nach oben wandern.
»Sag nichts. Ich schrubbe diese verdammte Decke noch heute abend.«