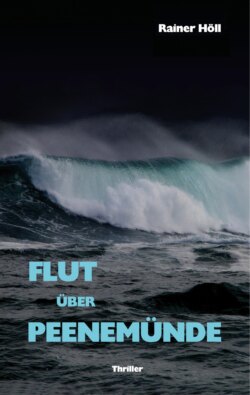Читать книгу Flut über Peenemünde - Rainer Holl - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
9 Freitag, 2. November, 9.15 Uhr
Оглавление„Nun, auch das akademische Viertel ist verstrichen, lassen Sie uns beginnen“, eröffnete Museumsdirektor Werner Petersen die Beratung. Er schaute sich mit registrierendem Blick im Kreis der Teilnehmer um. Die unbequemen hölzernen Stühle im kleinen Beratungsraum des Museums hatte Petersen selbst ausgewählt, sie sollten auf diese Weise endlose Diskussionen zumindest eindämmen. Der Blick aus den Fenstern zum Innenhof zeigte eine schwarz-weiß gefärbte Originalrakete A 4.
„Unser neuer Bürgermeister Joachim Walter hat seine Teilnahme zugesagt, er muss wohl durch etwas Wichtiges verhindert sein. Und unsere schwedische Kollegin Frau Bergner hat sich entschuldigt?“, fragte Petersen in die Runde und sah den Verwaltungsleiter Bernd Hoffmann an. „Nein, ich habe keine Ahnung wo sie steckt“, kam sofort die Antwort.
Die Runde aus Museumsmitarbeitern, Kommunalvertretern und Mitgliedern des Museumsbeirates beriet erstmals über die Anforderungen, die im Mai des Folgejahres vor dem Museum stehen würden. Peenemünde hatte etwa ein halbes Jahr zuvor den Zuschlag für eine internationale Konferenz über Stätten der Raumfahrt und ihre Präsentation in der Öffentlichkeit erhalten.
Petersen blickte aufmerksam in die Runde. „Die Welt schaut auf uns, auf diesen Ort von Weltgeschichte. Ihnen brauche ich die Brisanz des Themas nicht erklären, den Spagat zwischen den Begriffen Technik und Verbrechen.“
In der Öffentlichkeit setzte sich zunehmend die Tendenz durch, Peenemünde ausschließlich als Synonym von Vernichtungswaffen zu betrachten. Hier war jedoch auch der Ort vieler technischer Entwicklungen, die später Eingang in den Alltag der Menschen gefunden hatten. Das Thema war längst nicht so eindeutig geklärt, wie es sich Petersens Auftraggeber in Schwerin wünschten. Er vermied es, sich näher darüber auszulassen. Denn dadurch geriet man leicht auf ein Minenfeld.
Als Zeuge von Joachim Walters Konfrontation in Zinnowitz mit dem Thema Deich ging er in seiner Rede gleich in die Offensive, ehe ihm jemand aus dem Teilnehmerkreis zuvor kommen konnte.
„Ich möchte es nicht versäumen, meine persönliche Meinung zum Thema Deichrückbau anzufügen. Wer Hand an den Deich legt, würde nicht nur ein wichtiges Denkmal beschädigen, er würde auch die Zukunft des Museumsstandortes Peenemünde bewusst aufs Spiel setzen. Das ist ein bedeutender Schwerpunkt in der Förderpolitik der Landesregierung. Eine Schwächung Peenemündes würde dem klar widersprechen. Vom gesunden Menschenverstand ganz abgesehen.“
Auf die Befürchtungen des ebenfalls anwesenden Reinhard Henkelmann über die weit vorangeschrittenen Pläne dazu ging Petersen mit keinem Wort ein.
In diesem Moment öffnete sich leise die Tür. Das unvermeidliche Quietschen zog die Blicke aller auf die Person, die den Raum betrat.
Es war Pia Bergner, die mit schuldbewusster Miene einen freien Platz suchte und sich verlegen setzte. „Ich bitte um Entschuldigung, ich hatte einen kleinen Unfall mit dem Auto, deshalb diese Verzögerung.“
„Ich hoffe, Ihnen ist nichts passiert?“, erkundigte sich Werner Petersen und musterte die junge Frau.
„Nein, nein, nur ein Blechschaden, aber die Polizei musste alles aufnehmen, ich bin ja keine deutsche Staatsbürgerin.“
„Stimmt, war mir gar nicht mehr bewusst, im heutigen Europa der Regionen“, gab Petersen zurück.
Pia hatte sich immer noch nicht ganz von dem Zwischenfall erholt. Zunächst war sie jedoch gespannt darauf, sich die Redebeiträge der Tagungsteilnehmer anzuhören. Doch sie wurde enttäuscht davon, dass die Komplexität des Themas von politisch korrekten und austauschbaren Aussagen zur Bedeutung Peenemündes als Ort von Kriegsverbrechen überdeckt wurde. Sie sah es jedoch als Herausforderung für die eigene Beschäftigung mit diesem interessanten Thema.
Ihre Gedanken gingen auf Wanderschaft. Berührten die Kindheit in der Kleinstadt nahe der Ostseeküste, das Verhältnis zu ihrer Mutter, den allmählichen Übergang von der schutzbedürftigen Schülerin bis zum schützenden jungen Mädchen, die Einsicht, dass die Mutter mit dem Leben immer weniger zurechtkam, ihre Entscheidung, sie in einem wichtigen Augenblick allein zu lassen.
In einem für Pia wichtigen Augenblick.
Und schließlich zum Sterbebett ihrer krebskranken Mutter zu Beginn dieses Jahres, in der Heimat, viel zu früh für beide. Zumindest nutzten sie die Chance zur Versöhnung zweier Lebenden, die beide jahrelang vor sich hergeschoben hatten.
Pia erinnert sich an die beiden kleinen Schwarz-Weiß-Fotos von ihrer Mutter. Erst in ihren letzten Stunden hatte sie sich offenbart und ihr lange gehütetes Geheimnis preisgegeben.
Eines der Fotos zeigte ihre Mutter im Alter von siebzehn Jahren, das andere einen jungen Mann in der Uniform der Nationalen Volksarmee der DDR, dessen Gesicht aber nur undeutlich zu erkennen war. Auf der Rückseite des Fotos stand ein Name.
Von diesem Tag an hatte sich der Name in Pias Gedächtnis verankert. Sie wollte sich nicht mit der Tatsache abfinden, dass sie mit dem Tod der Mutter nun allein in der Welt wäre. Pia hatte sich ganz fest vorgenommen, ihren Vater zu finden. Überrascht bemerkte sie danach außerdem eine fast unmerkliche emotionale Wiederannäherung an ihre deutsche Heimat. Den Hauptgrund für ihre Flucht nach Schweden gab es nicht mehr – die gewollte Distanz zu ihrer Mutter. Eine Internetrecherche nach dem Namen auf der Rückseite des Fotos ergab eine Vielzahl von Treffern, allerdings war bei den wenigsten die Altersangabe dabei, als wichtigstes Kriterium für den Erfolg der Suche. Unter den Orten mit einer Person dieses Namens war auch das Ostseebad Karlshagen, südlicher Nachbarort von Peenemünde. Pia sah das als zusätzliche Motivation für ihren Aufenthalt.
Als sie ankam, wurde sie schon nach kurzer Zeit mit dem gesuchten Namen konfrontiert. Er war in der Region allgegenwärtig, wie Pia dem Studium der lokalen Presse entnehmen konnte. Weil es aber ein weit verbreiteter Name war, behielt Pia ihre Skepsis. Zu hohe Erwartungen würden bei Nichteintreten zu großer Enttäuschung führen. Diese Erfahrung hatte ihr schon in mehreren Lebenssituationen geholfen.
Aber gegen die sich einschleichende Hoffnung war sie machtlos. Nicht zuletzt, weil das Alter, das aus einem unerfindlichen Grund in der deutschen Presse zu allen genannten Personen angegeben wird, ziemlich genau passte.
Die markante Stimme von Werner Petersen ließ Pia aufschrecken. Ihre geistige Abwesenheit war aber wohl verborgen geblieben. Nach den folgenden Worten des Direktors richteten alle Teilnehmer ihre Blicke voller Spannung nach vorn.
„Zum Abschluss noch ein offenes Wort zum Zeitpunkt der Konferenz. So mancher hätte sich vielleicht einen Termin in der Nähe eines Jubiläums gewünscht.“ Petersen unterbrach seine Rede und blickte prüfend in die Runde. Nachdem er wissendes Schweigen konstatierte, setzte er fort. „Wie ich sehe, ist Ihnen die Reaktion rund um den 3. Oktober 1992 noch geläufig und ich brauche nichts hinzuzufügen.“
Nach wenigen weiteren Worten beendete der Direktor die Veranstaltung. Die damaligen Pläne einiger Politiker, den 50. Jahrestag des ersten Raketenstarts mit einer großen Jubelfeier zu begehen, waren national und international ganz überwiegend auf Empörung gestoßen und fallen gelassen worden.
Und jetzt, 20 Jahre später, wollten die Gerüchte nicht verstummen, dass es wenige Wochen zuvor, am 3. Oktober, eine heimliche Feier am Ort des Geschehens stattfand. Werner Petersen rief sich den persönlichen Bericht eines Teilnehmers ins Gedächtnis, den er aber aus nachvollziehbaren Gründen für sich behalten hatte.
Es war am späten Nachmittag. Die kleine Gruppe stand auf einem der vielen Nebenflächen des großen Flugplatzes von Peenemünde, vor ungewollter Entdeckung durch Erdwälle, alte Flugzeughangars und Wald geschützt. Wenige Meter neben ihnen verliefen die Reste metallener Schienen auf dem alten Beton. Von hier aus wurden vor Jahrzehnten Probeschüsse mit der so genannten Fieseler Fi 103 abgegeben, einem gelenkten Flugapparat, dem Vorläufer heutiger Marschflugkörper. Ab 1944 wurde sie auch als Vergeltungswaffe V 1 bezeichnet.
Etwa zwanzig Herren unterschiedlichen Alters, aus verschiedenen Ländern, Techniker, Politiker, Historiker waren zeitlich verteilt im Laufe mehrerer Stunden auf verdeckten Wegen an diesen Platz gelangt. Sie alle einte ein Ziel: Peenemünde darf nicht vergessen werden.
Allerdings hatte der Begriff Peenemünde für sie eine ganz besondere, weit über das Geographische hinausgehende Bedeutung.
Bernwart Hornburg ergriff das Wort. Der hagere, weißhaarige Mann strahlte nur eines aus: Würde. Bevor er begann, schweifte sein Blick demonstrativ in die Umgebung. So als wenn er sagen wollte: Das alles gehört eigentlich uns!
Er erinnerte in gesetzten, sorgfältig formulierten Worten an die große Mission Weltraum, die hier auf den Tag genau sieben Jahrzehnte zuvor mit dem Start der ersten Rakete in knapp 90 Kilometer Höhe ihren ersten gelungenen Test bestanden hatte.
Hornburg fuhr fort. „Mein alter Herr war dabei, als hier an dieser Stelle – streng genommen unweit von hier im Wald, wie Sie wissen, liebe Freunde – Weltgeschichte geschrieben wurde. Das Tor zum Weltraum war seitdem nicht mehr unüberwindlich. Einige aus unserer Runde, zumindest aber ihre direkten Vorfahren, waren unmittelbar daran beteiligt. Sie haben ihr Herzblut in eine Vision fließen lassen, die wenige Jahre später auch den Menschen seine bis dahin bestehenden Grenzen überwinden ließen. Keine Macht der Welt, kein Politiker, kein Schreiberling, keiner aus der heutigen Generation der Beliebigkeit kann ungeschehen machen, dass hier der erste Schritt auf einem Wege getan wurde, der längst nicht zu Ende ist.“
Starker Beifall erhob sich, der nun nicht mehr verborgen bleiben musste.
Bernwart Hornburg blickte, als auf sein Handzeichen wieder Ruhe eingekehrt war, genau nach Osten, zu einer etwas abseits stehenden Gruppe von drei Personen. Einer von ihnen hob eine grüne Flagge.
„Start!“ Lautstark tönte der Ruf. Sofort erklang aus einem Radiorekorder der bei Raketenstarts übliche Countdown.
„Zehn, neun, acht…“
Fast gleichzeitig mit dem letzten Wort „Zero“ ertönten Kommandos und andere Geräusche aus einem Lautsprecher. Es war eine Tonaufnahme vom ersten Raketenstart am 3. Oktober 1942. Überwältigt ließ die Gruppe von Menschen die Zeugnisse dieses einzigartigen historischen Ereignisses auf sich wirken.
Rune Alfredsson aus dem schwedischen Linköping stand ergriffen inmitten der kleinen Schar. Er dachte zum Schluss auch an die junge Pia Bergner, die unweit von hier bald ihre besonderen Aufträge erfüllen würde.