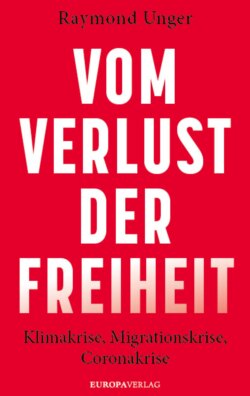Читать книгу Vom Verlust der Freiheit - Raymond Unger - Страница 18
Kalifornische Ideologie
ОглавлениеUm die kuriose Melange aus kapitalistischer Gewinnabsicht gepaart mit sozialistischer Gutmenschenattitüde zu verstehen, muss man in die 1960er- und 1970er-Jahre der USA zurückgehen. Tiefenpsychologisch ist eine Ideologie der Eier legenden Wollmilchsau keineswegs widersinnig, und vermutlich gibt es keinen besseren Ort, an dem diese Ideologie zur Blüte gelangen konnte, als in Kalifornien. Warum sollte man den amerikanischen Traum nicht leben, persönlich reich werden und sich gleichzeitig gut dabei fühlen, weil man nebenbei auch noch die Welt verbessert? Die »Kalifornische Ideologie« ist demnach fast identisch mit dem US-amerikanischen Mainstream. Seit jeher zählt hier die Bejahung der freien Märkte, und schon immer gab es ein tiefes Misstrauen gegen den Staat. Zudem ist Kalifornien das Eldorado freiheitsliebender Individualisten, die sich gegen die Konventionen der alten Welt gestellt haben. Die klassische Aufspaltung in »böse Kapitalisten« und »gute Sozialisten« hat es im Westen der USA nie gegeben. Sowohl linke wie rechte Kräfte schauten skeptisch auf einen zu starken Staat, und beide Seiten eint ein liberaler Grundgedanke.
»Dieser neue Glaube entwickelte sich aus einer seltsamen Verschmelzung der kulturellen Boheme aus San Francisco mit den High-Tech-Industrien von Silicon Valley. Von Zeitschriften, Büchern, Fernsehprogrammen, Websites, News-Groups und Netzkonferenzen unterstützt, verbindet die kalifornische Ideologie klammheimlich den frei schwebenden Geist der Hippies mit dem unternehmerischen Antrieb der Yuppies. Diese Verschmelzung der Gegensätze wurde durch einen tief reichenden Glauben an das emanzipatorische Potenzial der neuen Informationstechnologien bewirkt. In der digitalen Utopie wird jeder gut drauf und reich sein. Diese optimistische Vision wurde, keineswegs überraschend, begeistert von Computer-Enthusiasten, faulen Studenten, innovativen Kapitalisten, sozialen Aktivisten, modischen Akademien, futuristischen Bürokraten und opportunistischen Bürokraten überall in den Vereinigten Staaten angenommen. Wie immer beeilten sich die Europäer, den letzten Schrei von Amerika nachzuahmen. […] Wer hätte gedacht, dass eine solch widersprüchliche Mischung aus technologischem Determinismus und liberalem Individualismus zur hybriden Orthodoxie des Informationszeitalters würde? Und wer hätte vermutet, dass es mit der zunehmenden Verehrung der Technologie immer weniger möglich würde, irgendetwas Sinnvolles über die Gesellschaft zu sagen, in der sie eingesetzt wird? […] Die kalifornische Ideologie spiegelt daher gleichzeitig die Disziplin der Marktökonomie und die Freiheiten des künstlerischen Hippietums wider. Diese bizarre Mischung wurde nur durch einen fast universellen Glauben an den technologischen Determinismus möglich. Seit den 60er-Jahren haben die Liberalen – im gesellschaftlichen Sinne des Begriffs – darauf gehofft, dass die neuen Informationstechnologien ihre Ideale verwirklichen würden.« 35
Um die kalifornische Ideologie zu verstehen, muss man bedenken, dass sowohl linke als auch rechte Liberale in der Revolution der medialen Vernetzung per se ein Instrument der Freiheit gesehen haben. Man glaubte fest daran, dass neue Software, Apps und Gadgets die Welt automatisch freier, gerechter und besser machen würden. Wie radikal sich dabei gleichzeitig die Möglichkeiten von Kontrolle und Unterdrückung einstellen würden, sah man hingegen kaum. Dabei ist der »reiche Hippie« im Grunde Sinnbild für einen Typus des linken Abspalters, den ich bereits weiter oben beschrieben habe. Sozialistische Ideale der Gleichheit verkommen zur Attitüde.
»Apple-Gründer Steve Jobs trat stets bescheiden im schwarzen Rolli auf, hörte Bob Dylan, hatte einen Sommer im Ashram verbracht, baute gleichzeitig eine Weltfirma auf, ließ in Shenzhen bei Foxconn unter miserablen Arbeitsbedingungen produzieren, beutete staatlich finanzierte Forschungsergebnisse aus und vermied mit allerlei Tricks, Steuern zu zahlen. Somit kann er als Personifizierung des Amalgams zwischen Kalifornischen Hippies und Rand’schen Techno-Unternehmerpersönlichkeit gelten. Hippies, die in Privatjets kommen: Hier kommen sie alle einmal im Jahr zusammen, die Alt-Hippies aus der ›Bay Area‹ und die CEOs aus dem Silicon Valley: Das in der Wüste von Nevada stattfindende ›Burning Man Festival‹ ist eine aus der Zeit gefallene Reminiszenz an das Kalifornien der Blumenkinder-Zeit. Ideale von Nachhaltigkeit, Selbstverwirklichung, freier Liebe, Gesetzlosigkeit und alternativer Ökonomie werden durch eine logistische Maschinerie als Illusion aufrechterhalten. Tatsächlich erinnert das Festival im Wüstensand an eine Mad-Max-Dystopie: Die CO2-Bilanz ist katastrophal, die Besucher kommen in Privatjets, die Zugriffsmöglichkeiten der Polizei sind umfassend, und das Publikum ist alles andere als divers. Und doch wird etwa Googles Motto ›Don’t Be Evil!‹, der Versuch, Menschheitsaufgaben zu lösen und die Welt mit ›guten Produkten‹ zu beglücken, nur vor dem Hintergrund von ›Whole Earth Catalog‹ und ›Burning Man‹ verständlich: Tue Gutes mit gutem Karma und guten Tools und verdiene dabei einen Haufen Geld: That’s the spirit!« 36
Kennzeichnend für die Kalifornische Ideologie sind die Hybris und die Arroganz, zu einer Elite zu gehören, die nicht nur einfach reich werden will, sondern der die Mission zukommt, die ganze Welt zu verbessern. Machbarkeitswahn, Technikgläubigkeit und Paternalismus gehen fatale Verbindungen ein. Der Größenwahn einer Pseudoelite wird ohne sittliche und ethische Reife jedoch brandgefährlich, wenn es zu einer monströsen Massierung von Kapital kommt. Völlig im mechanistischem Denken und technischem Machbarkeitswahn gefangen, kommen Silicon-Valley-Milliardäre dann schon mal auf die Idee, das Genom von sieben Milliarden Menschen zu »verbessern«.
»Gesellschaftssteuernde Maßnahmen und Technologien werden zunehmend weltumspannend und zentral koordiniert wirksam. Einflussreiche Privatleute entwerfen Pläne für die ganze Welt, die in wachsendem Umfang auch global umgesetzt werden. Das Heil liegt dabei oft in menschenfernen, leblosen und automatisierten Prozessen, die Hilfe und Annehmlichkeit versprechen, zugleich aber zentrale Herrschaft und Kontrolle ermöglichen – sowie außerordentlichen Profit. Am Ende dieser Entwicklung steht eine große Vereinheitlichung. Spezielle Technologien und Programme, vorangetrieben von einigen Oligarchen, sollen für alle Menschen auf der Welt bindend werden – ohne jede demokratische Debatte. Das Problem reicht weit über die aktuelle [Corona-]Krise hinaus. Eine Art Autopilot scheint vieles zu steuern, ob in der Politik, der Wirtschaft oder auch im Denken ganz allgemein. Die Verantwortung für Entscheidungen verliert sich immer öfter im Nebel internationaler Organisationen oder wird gleich ganz auf Algorithmen übertragen und damit von individuellen, persönlichen Erwägungen losgelöst. Die populäre Annahme, einige Superreiche würden sich zu neuen Weltherrschern machen, ist naheliegend, erklärt die Situation aber nur unzureichend. Es scheint, als wären auch diese Einflussreichen geblendet von einer Ideologie, die sich immer mehr verselbstständigt. Es ist, als ob der Prozess des Nachdenkens selbst, das individuelle Abwägen, Zweifeln und Hinterfragen, zunehmend verlöscht und einem Vertrauen in automatisierte Effizienz Platz macht.« 37
Was der Autor Paul Schreyer hier feststellt, ist wesentlich. Tatsächlich geht es nicht allein um oligarchische Machtstrukturen, sondern um einen Paradigmenwechsel, bei dem die Achtung vor dem Mysterium des Lebens durch eine mechanistische, technikgläubige Weltsicht ersetzt wurde (mehr dazu im letzten Buchteil). Zunächst zurück zur Kalifornischen Ideologie: Ungeachtet rudimentären Hippiekultes und linker Attitüde – vermutlich sind die zehn größten Firmenkonsortien, als eigentlicher Taktgeber einer neuen Weltordnung, tatsächlich kapitalistisch orientiert. Trotzdem zeigen die Agenden der supranationalen Organisationen, die in Wirklichkeit von Milliardären wie Bill Gates abhängig sind, unverkennbar sozialistische Züge. Man könnte auf die Idee kommen, dass die wirklich Mächtigen die Dekonstruktion der bestehenden Ordnung Leuten übertragen, die sich bestens damit auskennen. Um die Gesellschaft zu atomisieren, alle haltgebenden Strukturen abzubauen und die erforderlichen Brandrodungen bestehender Institutionen vorzunehmen, werden Kulturmarxisten instrumentalisiert. Zumindest klingen die Grundsatzpapiere zur Umsetzung einer neuen Weltordnung wie sozialistische Pamphlete. Die für eine linke Argumentation unabdingbaren Ingredienzien sind natürlich wie immer hypermoralisch, unverzichtbar sind Postulate von Gleichheit, Diversität und Umverteilung.
So machen der »Gesellschaftsvertrag für eine Große Transformation« (WBGU), der »Global Compact for Migration« sowie das Strategiepapier »Gemeinsame Verantwortung, globale Solidarität – Bewältigung der sozioökonomischen Auswirkungen von COVID-19« keinen Hehl daraus, was in Kürze geschehen soll. Das Kuriose: Etablierte Medien berichten kaum über deren Inhalte. Sobald diese Aufgabe aber von freien Journalisten übernommen wird, werden diese als Spinner und Verschwörungstheoretiker diffamiert. Tatsächlich wird aber meistens nur aus den offiziellen Agenden der supranationalen Organisationen zitiert, ich werde dies ebenfalls tun. Zunächst gebe ich kurze Einblicke in das Hauptgutachten des wissenschaftlichen Beirates der Bundesregierung mit dem Titel: »Welt im Wandel – Gesellschaftsvertrag für eine Große Transformation«. Auf die Bedeutung des UN-Strategiepapiers zu COVID-19 komme ich zurück. Für alle Grundsatzpapiere gilt: Wer es nervlich verkraftet, möge bitte die Originaldokumente einsehen. Das über 400 Seiten starke Grundsatzpapier zur »Großen Transformation« beginnt jedenfalls mit einer hypermoralischen Keule:
»Das kohlenstoffbasierte Weltwirtschaftsmodell ist auch ein normativ unhaltbarer Zustand, denn es gefährdet die Stabilität des Klimasystems und damit die Existenzgrundlagen künftiger Generationen. Die Transformation zur Klimaverträglichkeit ist daher moralisch ebenso geboten wie die Abschaffung der Sklaverei und die Ächtung der Kinderarbeit.«
Damit ist der hypermoralische Rahmen schon einmal wirksam gesetzt: Klimaschutz ist ebenso notwendig wie der Kampf gegen Sklaverei und Kinderarbeit. Oder umgekehrt gedacht: Typen, die den Klimaschutz missachten, also Dieselfahrer, Fleischesser und Flugzeugnutzer, billigen wahrscheinlich auch Sklaverei und Kinderarbeit. Abgesehen von diesem Framing, ist der sozialistische Grundansatz unverkennbar: »Die kohlenstoffbasierte Weltwirtschaft ist ein unhaltbarer Zustand.« Als kurze Slogans formuliert, und damit wesentlich bannertauglicher, wären auch »Kampf dem Kapitalismus« und »Klimakampf ist Klassenkampf« denkbar. Doch weiter im Text:
»Langzeitstudien zeigen eindeutig, dass sich immer mehr Menschen weltweit einen Wandel in Richtung Langfristigkeit und Zukunftsfähigkeit wünschen. Überdies verdeutlicht das atomare Desaster in Fukushima, dass schnelle Wege in eine klimaverträgliche Zukunft ohne Kernenergie beschritten werden müssen. Es ist jetzt eine vordringliche politische Aufgabe, die Blockade einer solchen [Großen] Transformation zu beenden und den Übergang zu beschleunigen. Dies erfordert nach Ansicht des WBGU die Schaffung eines nachhaltigen Ordnungsrahmens, der dafür sorgt, dass Wohlstand, Demokratie und Sicherheit mit Blick auf die natürlichen Grenzen des Erdsystems gestaltet und insbesondere Entwicklungspfade beschritten werden, die mit der 2°C-Temperaturleitplanke kompatibel sind. Auf letztere hat sich die Weltgemeinschaft 2010 in Cancún verständigt. Die Weichenstellungen dafür müssen im Verlauf dieses Jahrzehnts gelingen, damit bis 2050 die Treibhausgasemissionen weltweit auf ein Minimum reduziert und gefährliche Klimaänderungen noch vermieden werden können. Der Zeitfaktor ist also von herausragender Bedeutung.«
Übersetzt heißt das: Liebe Politiker, die meisten Menschen wollen die »Große Transformation«. Blockierende Kräfte, zu denen bürgerliche, liberale und konservative Teile der Gesellschaft zählen, müssen angesichts des Zeitdruckes unbedingt überwunden werden. Hierfür muss die Politik einen neuen, robusten »Ordnungsrahmen« schaffen, der nicht mehr länger partikuläre Interessen berücksichtigt, sondern vorrangig die Bedürfnisse des globalen Erdsystems.
»Fasst man diese Anforderungen an die vor uns liegende Transformation zusammen, wird deutlich, dass die anstehenden Veränderungen über technologische und technokratische Reformen weit hinausreichen: Die Gesellschaften müssen auf eine neue ›Geschäftsgrundlage‹ gestellt werden. Es geht um einen neuen Weltgesellschaftsvertrag für eine klimaverträgliche und nachhaltige Weltwirtschaftsordnung. […] Ein zentrales Element in einem solchen Gesellschaftsvertrag ist der ›gestaltende Staat‹, der für die Transformation aktiv Prioritäten setzt […] Auf den genannten zentralen Transformationsfeldern müssen Produktion, Konsummuster und Lebensstile so verändert werden, dass die globalen Treibhausgasemissionen im Verlauf der kommenden Dekaden auf ein absolutes Minimum sinken und klimaverträgliche Gesellschaften entstehen können. Das Ausmaß des vor uns liegenden Übergangs ist kaum zu überschätzen. Er ist hinsichtlich der Eingriffstiefe vergleichbar mit den beiden fundamentalen Transformationen der Weltgeschichte: der Neolithischen Revolution, also der Erfindung und Verbreitung von Ackerbau und Viehzucht, sowie der Industriellen Revolution, die von Karl Polanyi (1944) als ›Great Transformation‹ beschrieben wurde und den Übergang von der Agrar- zur Industriegesellschaft beschreibt. Die bisherigen großen Transformationen der Menschheit waren weitgehend ungesteuerte Ergebnisse evolutionären Wandels. Die historisch einmalige Herausforderung bei der nun anstehenden Transformation zur klimaverträglichen Gesellschaft besteht darin, einen umfassenden Umbau aus Einsicht, Umsicht und Voraussicht voranzutreiben. Die Transformation muss auf Grundlage wissenschaftlicher Risikoanalysen zu fortgesetzten fossilen Entwicklungspfaden nach dem Vorsorgeprinzip antizipiert werden […].«
Da haben wir es also wieder, das »Demokratie neu denken«. Im Grundsatzpapier heißt dieser Ansatz euphemistisch »neue Geschäftsgrundlage«. Diese muss selbstverständlich durch einen starken, »gestaltenden Staat« umgesetzt werden. Man könnte auch sagen, eine Prise Totalität wäre hilfreich. Eine Denkrichtung, die Robert Habeck sicherlich nicht allzu fremd sein dürfte, immerhin betont er die politische Effizienz der Volksrepublik China. Hinzu kommt, die »klimaverträgliche Gesellschaft« muss bezüglich ihrer Wirtschaft mit »Voraussicht« und einem »Vorsorgeprinzip antizipiert werden«. Das ist eine nette Umschreibung für Planwirtschaft. Die »Große Transformation« verwirft damit sämtliche autonomen, kybernetischen Steuerungsmechanismen, die für die weltweite Steigerung des Wohlstandes verantwortlich sind. Freihandel und die evolutionäre Entwicklung von Preisen für Güter aller Art sollen einmal mehr durch eine sozialistische Planwirtschaft ersetzt werden. Als hätten sämtliche Panwirtschaften der Welt nicht eindeutig gezeigt, dass der Mensch ein hyperkomplexes System wie die Wirtschaft nicht vorausschauend steuern kann, halten die Strategen der »Großen Transformation« ihre Idee sogar noch für ein Novum. Die Inbrunst, mit der linke Ideologen als Verfasser der »Großen Transformation« auftreten dürfen und dabei tatsächlich an die Umsetzung einer sozialistischen Agenda glauben, zeigt, dass ihnen nicht einmal im Ansatz bewusst ist, wie sehr sie instrumentalisiert werden. Man lässt nützliche Idioten in höchsten Ämtern der UN gewähren und stellt in Aussicht, die neue Welt könnte entgegen der wirklichen Machtverhältnisse tatsächlich sozialistisch werden. Dass allerdings jede Generation unerschütterlich glaubt das krumme Rad des Sozialismus immer wieder neu erfinden zu müssen, hat eine tiefenpsychologische Dimension.