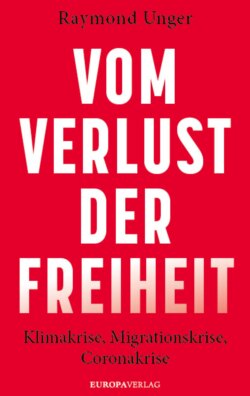Читать книгу Vom Verlust der Freiheit - Raymond Unger - Страница 19
Archetyp Sozialismus
ОглавлениеDer russische Mathematiker und Philosoph Igor Schafarewitsch, ein enger Freund von Alexander Solschenizyn, stand zur Zeit des Kalten Krieges den russischen Dissidenten nahe. Der einzig plausible Grund, warum Schafarewitsch nicht selbst verhaftet wurde, lag vermutlich in seiner frühen Berühmtheit begründet. Der Mathematiker war international überaus anerkannt und geschätzt. Der Schaden für das kommunistische Regime wäre zu groß geworden, wenn Schafarewitsch sang- und klanglos in einem Gulag verschwunden wäre. Abgesehen von Schafarewitschs herausragenden Leistungen auf dem Feld der algebraischen Geometrie, ist es dem russischen Genie zu verdanken, den zeitlosen und grundsätzlichen Charakter des Sozialismus herausgearbeitet zu haben. In seinem bereits 1975 geschriebenen Buch »Der Todestrieb der Geschichte«38 stellt der Mathematiker und Philosoph heraus, dass sich die Grundzüge des Sozialismus durch alle Zeitalter der Geschichtsschreibung zurückverfolgen lassen. Ob im Inkareich, in Mesopotamien, in China oder Ägypten oder schließlich in den ersten Ketzerbewegungen des Christentums – die Geschichte einer sozialistischen Grundstruktur ist weitaus älter und universeller als die Lehre eines gewissen Karl Marx. Der Psychologe C. G. Jung würde vermutlich von einem »Archetyp« sprechen, eine Art Urgedanke oder universelles Grundmuster der menschlichen Seele. Sozialismus ist demnach keine intellektuelle und am Reißbrett ersonnene politische Ideologie, die sich kurzerhand an ihrem historischen Scheitern widerlegen ließe. Sozialismus ist vielmehr ein zu allen Zeiten und an verschiedenen Orten dieses Planeten immer wieder neu entstehendes, hartnäckiges Gedanken-Mem – und damit ziemlich resistent gegen seine faktische Widerlegung. Objektiv betrachtet, sollte ein toxisches Gedankengut wie der Sozialismus in der zeitgenössischen Politik ebenso wenig Chancen haben wie der Faschismus. Immerhin endeten alle sozialistischen Gesellschaftsversuche, einschließlich des nationalsozialistischen, in Unfreiheit, Armut, Krieg, Massenmord und Folter. Unverkennbar ist diesem Archetyp über Verstand und Logik dennoch kaum beizukommen. Die innerpsychische Notwendigkeit, unter gewissen Umstanden sozialistische Grundstrukturen immer wieder neu zu ersinnen, ist weitaus stärker, denn: Sozialismus ist der direkte Versuch der menschlich brüskierten, verängstigen und entwurzelten Seele, aus eigener Kraft so etwas wie Schutz, Struktur und Ordnung zu konstruieren. Sozialistische Grundelemente entstehen wie von selbst, sobald dem Menschen spirituelle Sinngewissheiten, soziale Geborgenheit, Identität und Rückverbindungen an das Sein verloren gehen. Als religiöse Sublimation kann der sozialistische Grundaufbau seine ehemals spirituelle Herkunft natürlich kaum verleugnen. An die Stelle einer wie auch immer gearteten göttlichen Entität außerhalb des Menschen tritt lediglich der Mensch selbst. Die Grundelemente eines verlorenen Paradieses, der an sich verdorbenen Welt und dem Weg zur Erlösung, bleiben unverkennbar erhalten.
»Die sozialistischen Lehren behalten die Vorstellung der mittelalterlichen Mystik von drei Stufen des historischen Prozesses bei, ebenso wie das Schema vom Fall der Menschheit und ihrer Rückkehr in den Urzustand in vollkommenerer Form. Folgende Bestandteile machen diese Lehren aus:
1.Der Mythos vom ursprünglichen glücklichen ›Naturzustand‹, dem ›Goldenen Zeitalter‹, das durch den Träger des Bösen, das Privateigentum, zerstört worden sei. [Jean-Jacques Rousseau, der ›edle Wilde‹]
2.Die Entlarvung der Gegenwart. Die zeitgenössische Gesellschaft wird als unheilbar sündhaft, ungerecht, unsinnig, nur zur Zerschlagung tauglich dargestellt. Erst auf ihren Trümmern könne ein Gesellschaftssystem geschaffen werden, das den Menschen das Höchstmaß von Glück bereite, das zu erleben sie fähig seien.
3.Die Prophezeiung einer neuen, auf sozialistischen Prinzipien aufgebauten Gesellschaft, in der alle Nachteile der Gegenwart verschwinden. Dies sei der einzige Weg, um die Menschheit zum ›Naturzustand‹ zurückkehren zu lassen, wie Morelly sagt, der Weg vom unbewussten zum bewusst erlebten Goldenen Zeitalter.
4.Die Idee der ›Befreiung‹, die von den mittelalterlichen Ketzerlehren spirituell als Erlösung des Geistes von der Macht der Materie verstanden wurde, verwandelt sich in den Aufruf zur Befreiung von der Moral der zeitgenössischen Gesellschaft, von ihren sozialen Einrichtungen und vor allem von Privateigentum. Als Triebkraft dieser Befreiung wird zunächst die Vernunft anerkannt, doch allmählich nimmt das Volk, die Armen, [heute: Minderheiten, Moslems, Flüchtlinge …] ihre Stelle ein. In der Weltanschauung, die von den Teilnehmern an der ›Verschwörung der Gleichen‹ vertreten wurde, erkennen wir dieses Konzept in schon vollständiger Form. Im Zusammenhang damit werden auch neue konkrete Züge für den Plan zur Errichtung der ›Zukunftsgesellschaft‹ ausgearbeitet: Terror, Einquartierung der Armen in die Wohnungen der Reichen, Beschlagnahme des Mobiliars, Befreiung von Schuldverpflichtungen und so weiter.« 39
Die »Große Transformation« geriert sich als innovativ und modern, in Wirklichkeit kopiert sie lediglich die ewige sozialistische Grundkonzeption: Erst »die Natur wäre ohne den Menschen und seine Bedürfnisse besser dran«, über »so kann es nicht mehr weitergehen«, gefolgt von »bestehende Strukturen müssen zerschlagen werden«, um schließlich die Verheißung auszusprechen: Eine vor dem Klimakollaps gerettete neue Weltordnung, in der »klimaverträgliche Gesellschaften ihren Konsum auf ein absolutes Minimum reduziert haben«. Zum letzten Satz drängen sich mir Assoziationen einer Kommune auf, ohne persönlichen Besitz, ohne Ehepaare und ohne festgelegte sexuelle Orientierungen. Alles gehört allen, auch die Kinder, und niemand wird mehr sinnlos konsumieren, weil alle so glücklich sind. Dann wird endlich alles gut sein …
Doch erst, wenn man das sozialistische Konzept als Archetypen der Seele erkennt, die zweifellos spirituellen Charter haben, kommt man der Sache näher. Trotz der Vielzahl philosophischer Weltbilder lassen sich prinzipiell zwei grundverschiedene Positionen oder Gewissheiten ausmachen, von denen aus der Mensch das Sein in der Welt verortet. Zugespitzt und grob vereinfacht, könnte man auch von einer grundsätzlich »spirituell-transzendenten« und einer grundsätzlich »materialistisch-sozialistischen« Weltsicht sprechen. Die transzendente Position geht von folgender Grundannahme aus:
1. Es gibt einen Gott – und ich bin es nicht.
Die sozialistische Sicht ist diametral anders:
2. Es gibt keinen Gott – oder falls doch, könnte es ebenso ich selbst sein. Die zweite Position geht davon aus, dass kalte Materie ohne Ziel, Plan oder Sinn zufälligerweise Bewusstsein entwickelt hat – den Menschen als höchstes, bewusstes Wesen. Ob Agnostizismus, Atheismus, Theismus (Monotheismus oder Polytheismus), Pantheismus oder Materialismus – im Prinzip lassen sich die unterschiedlichen Weltbilder grob der einen oder anderen Grundannahme zuordnen. Die Erzfeindschaft zwischen Sozialismus und Religion ist daher logisch und folgerichtig. Nichts ärgerte Denker wie Karl Marx mehr als Menschen, die ihre Sinngewissheiten in der Transzendenz verorten. Was Marx als Phlegma und »Opium fürs Volk« ansah, war der Umstand, dass spirituell verwurzelte Menschen ihr Dasein in einen höheren Sinnkontext einpassen. Dieser besteht im Wesentlichen daraus das Paradox menschlicher Freiheit vs. Unverfügbarkeit anzuerkennen. Bei diesem Weltmodel ist der Mensch einerseits ein freies und für sein Handeln verantwortliches Wesen – dennoch ist er zugleich in ein gegebenes Schicksal gestellt, das sich seinem Machtbereich entzieht. Kurz gesagt: Etwas ist größer. Einem Menschen mit diesem Weltbild ist bewusst, das ihm wesentliche Dinge unverfügbar bleiben. Der Widerspruch, einerseits handeln zu müssen und andererseits dennoch die begrenzte Wirkmächtigkeit des eigenen Handels anzuerkennen, erfordert Demut und Reife. Viele Philosophen haben sich an diesem Dilemma abgearbeitet. Immerhin gilt es, bei jedem der mannigfaltigen Alltagsprobleme unterscheiden zu können, was verfügbar ist und was nicht. Das sogenannte »Gelassenheitsgebet« bringt die Schwierigkeit des menschlichen Handelns auf den Punkt:
»Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.«
In jedem Fall stellt die faktische Unverfügbarkeit über die elementarsten Dinge des Lebens – Gesundheit, Liebe und Tod – eine unfassliche Brüskierung der menschlichen Seele dar. Die wesentlichen Dinge des Lebens sind gegeben und lassen sich auch mit der vegansten, sportlichsten, ökologischsten und geimpftesten Agenda weder herbeiführen noch garantieren. Über die Fragen, ob man gesund bleibt, geliebt wird, einen Partner verliert oder wann man stirbt, kann kein Mensch verfügen. Würde man in der christlichen Terminologie bleiben, ist der Sozialismus die Sprache der Schlange, die dem Menschen einredet, er selbst sei Gott und könne allein über sein Schicksal bestimmen. Das Bemühen, aus eigener Kraft Glück, Sicherheit und Gesundheit zu erschaffen, sind folglich die nächsten Schritte. Die Hybris des säkularen Menschen gegebene und elementare Strukturen beherrschen zu wollen, zeigt sich in allen Lebensbereichen. Das Zweckbündnis mechanistisch denkender Silicon-Valley-Milliardäre mit sozialistischen Weltverbesserern wird zumindest vom selben weltanschaulichen Unterbau getragen: Der Mensch allein gestaltet sein Schicksal und das der Welt. Dies zeigt sich im infantilen Postulat der Beherrschung des Klimas, im Wahnwitz der Pandemie-Kontrolle durch Lockdown, im Umgang mit natürlichen Alters- und Sterbeprozessen oder in der Neukonzeption des menschlichen Genoms. 95-Jährige werden mit den kompliziertesten Operationen gequält, um »den Tod zu besiegen«, anstatt in Würde sterben zu dürfen. Auch hier zeigte die Coronakrise die dramatischen Folgen einer spirituell entwurzelten Gesellschaft. Im Kampf gegen das »Killervirus« wurden alte Menschen mitten in ihrem natürlichen Sterbeprozess in ein künstliches Koma versetzt, zwangsbeatmet und mit allen nur erdenklichen technischen Mitteln am Leben erhalten. Schlussendlich starben sie dann trotzdem, nur zusätzlich noch einsam und fern von ihren Liebsten. Auf Naturkatastrophen, zu denen Virus-Epidemien ebenso gehören wie Vulkanausbrüche, reagiert die säkulare Gesellschaft mit einem Höchstmaß an Entrüstung und der Suche nach »Verantwortlichen«. Der Tagesspiegel stellt bezüglich der Bedrohung durch das Coronavirus gar die »Systemfrage«:
»Das Coronavirus stellt auch die Systemfrage. Man kann Covid-19 als prototypisches Problem des 21. Jahrhunderts betrachten: Es ist global. Es ist mit Wissenschaft, Technologie, Kooperation, menschlichem Verstand und der Bereitschaft, Verhalten zu ändern, wahrscheinlich lösbar – so wie die Folgen des Klimawandels, des Artenschwundes, der Migration, der Mikroplastik-Verschmutzung, der Medikamenten-Resistenzen, der Digitalisierung oder des Wandels der Arbeitswelt. Der Unterschied ist die Unmittelbarkeit. Sie macht das Virus zum Testfall: Sind wir als freie, aufgeklärte, über unbeschränkten Zugang zu Informationen verfügende verantwortliche Einzelbürger, sind wir als Gemeinwesen, sind unsere Institutionen und unsere Volksvertreter, ist unser Gesundheits- und Wirtschaftssystem in der Lage, jetzt das Notwendige zu tun?« 40
Oder wäre eine totalitäre Regierung nach chinesischem Muster nicht eine weitaus bessere Lösung?
Allem voran sind Jungend und unablässige Aktivität recht brauchbare Schutzmechanismen gegen die Bewusstwerdung der prinzipiellen Unverfügbarkeit des Lebens. Doch je älter man wird, desto näher kommen auch die existenziellen Schrecken. Geliebte Menschen sind bereits gestorben. Man hat eine oder mehrere schmerzhafte Trennungen hinter sich bringen müssen. Man wurde mit einer lebensbedrohenden, medizinischen Diagnose konfrontiert … Der Mensch ist das einzige, bewusste Lebewesen, das in die Zeit gestellt wurde, anders gesagt: Der Mensch muss täglich sein Leben gestalten, obgleich er weiß, dass er sterben muss. Wen dies kalt lässt, oder wer angesichts seines eigenen Todes zynisch reagiert, hat schlichtweg nicht begriffen, was dies bedeutet. Man könnte auch sagen, hier ist ein menschlicher Reifegrad noch nicht erreicht.
Wer aber das Schicksal des Menschseins im Angesicht des Todes begriffen hat, versteht auch den Ur-Schmerz, der nach Antwort verlangt. Bei allen schicksalhaften Erfahrungen stellt sich die Frage nach der persönlichen Resilienz. Relativ gefeit gegen die Schrecken der Unverfügbarkeit sind Menschen, welche die Erfahrungen von Liebe, Halt und Geborgenheit machen konnten. Die frühe Gewissheit, gewollt und geliebt zu werden, legt den alles entscheidenden Grundstein für den Blick auf die Welt. Urvertrauen in das Sein wurde einem entweder in den ersten Lebensjahren geschenkt – oder man ist zu einer lebenslangen Kompensation einer tiefen Verunsicherung gezwungen. Unbehandelt bildet letzteres Schicksal eine ungesunde Melange von Infantilität und Kontrollzwang aus – die Ingredienzien sozialistischer Ideologie.
Nur bei genügend Urvertrauen und Liebe kann sich ein gesundes Ich mit einer gesunden Identität herausbilden, das sich später, als Ich-Erweiterung, auch in einem kollektiven Zugehörigkeitsgefühl spiegelt. Die gelungene Menschwerdung und ein wirkliches Erwachsenwerden bedeuten Liebes- und Bindungsfähigkeit, wobei echte Liebe und Bindung niemals beliebig sein können. Vorrausetzung für freie Beziehungen ist eine gesunde Eigenliebe, dazu wiederum gehört Abgrenzungsvermögen, Unterscheidungsvermögen von mein und dein, eigen und fremd. Erst wenn diese Fähigkeiten ausgebildet sind, man also weiß, was man möchte und was nicht und wo man selbst aufhört und der andere anfängt, können Beziehungen gelingen. Alles andere sind abhängige Beziehungen oder taktische Manöver, weil man etwas braucht oder haben will. Etwas provokant ausgedrückt könnte man sagen, ein beziehungs- und liebesfähiger Mensch muss zunächst einmal lernen zu diskriminieren:
»Der Begriff Diskrimination (von lateinisch discriminare = ›trennen‹, ›absondern‹, ›unterscheiden‹) beschreibt die Unterscheidung, den Unterschied oder das Unterscheidungszeichen. Die Diskriminationsfähigkeit ist dementsprechend die Fähigkeit zur Unterscheidung.« 41
In seinem Artikel »Warum Diskriminierung unvermeidlich ist« untersucht der Wirtschaftsphilosoph Prof. Gerd Habermann die Notwendigkeit der Diskriminierung. Zunächst betont Habermann, wie wichtig das Diskriminierungsverbot im Kontext der Gesetzgebung ist. Niemand darf vor dem Gesetz bevorzugt oder benachteiligt werden:
»Ein folgenreicher Fehlgriff ist es nun, dieses Unterscheidungsverbot auf das Privatrecht anzuwenden. Für das Privatleben ist das Unterscheidungsrecht konstitutiv. Es ist der Kern der Vertrags- und Meinungsfreiheit. Ich darf nicht nur, ich muss täglich ›diskriminieren‹, indem ich nach meinen nicht weiter hinterfragbaren Präferenzen mit bestimmten, ausgewählten Menschen zusammenarbeite (im Arbeitsrecht), Handel treibe, bestimmte Produkte kaufe, mich bestimmten Meinungsrichtungen, Parteien, Religionen oder politischen Gemeinschaften anschließe, einen Verein mit einem exklusiven Spezialzweck gründe, eine bestimmte Person – besonders exkludierend – heirate oder mich mit ihr innig befreunde. Fast jede Wahlhandlung ist in diesem Sinne ›diskriminierend‹ oder ›exkludierend‹ und unterscheidet logischerweise zwischen denen, die dazugehören und anderen, die nicht dazugehören. So schließt ein Kaninchenzüchterverein satzungsmäßig Schweinezüchter aus: Es ist offenbar sinnlos, den speziellen Zweck des Vereins offenzuhalten.« 42
Sozialistische Bestrebungen zur »Antidiskriminierung« in den privaten Raum hinein haben jedoch nichts Geringeres zum Ziel, als die Verhinderung von Wahlfreiheit, Individuation und Identität. Die Aufzählung der Bedingungsstrukturen gesunder Individuen lässt bereits erahnen, wo die zentralen Angriffspunkte sozialistischer Ideologie liegen. Liebesfähige Menschen, die gelernt haben zu unterscheiden, was sie wollen und was nicht, wünschen sich für ihre Beziehungen, die naturgemäß andere ausschließen, Kontinuität. Obgleich in der Praxis vielfach gescheitert und allem Gender-Nudging zum Trotz, sind die Ideale Monogamie und Treue zwischen Frau und Mann immer noch Kassenschlager in Filmen und Romanen. 99 Prozent aller Menschen fühlen sich klar einem Geschlecht zugeordnet. Vermutlich 95 Prozent aller Menschen, und nicht wie immer wieder behauptet 90 Prozent, sind heterosexuell. Die verbindliche Ehe, als Grundlage der Gesellschaft, hat keineswegs ausgedient. Spätestens wenn aus dieser Verbindung Kinder hervorgehen, entsteht bei Eltern ein starkes Schutzbedürfnis. Der Wunsch nach Eigentum, Besitz und damit Sicherheit sind folgerichtige Ziele, um die eigene Familie zu schützen. Bindungsfähige, erwachsen gewordene Menschen orientieren und definieren sich also natürlicherweise über sozial gewachsene Strukturen wie Ehe, Familie, Eigentum, Beruf, Kollegen, Freunde und Individualität. Sämtliche dieser Identifizierungen stellen Ich-Erweiterungen dar und geben dem Menschen Halt, Sicherheit und Geborgenheit. Für eine lange Zeit, oft bis über die Lebensmitte hinaus, reichen diese sozial verlässlichen Bindungen aus, um die elementaren Unverfügbarkeiten, Trennung, Krankheit, Tod, erfolgreich zu kompensieren. Doch nach den Psychologen und Philosophen, wie Abraham Maslow oder C. G. Jung, müssen schlussendlich weitere Elemente hinzukommen, um die großen Sinnfragen des Lebens zu befrieden, nämlich Religion, Kunst und Kultur.
Nicht zufälligerweise sind alle eben genannten bürgerlichen Strukturen kardinale sozialistische Angriffspunkte. Sämtliche Bindungs- und Identitätsstrukturen wie Ehe, Familie, Eigentum, Individualität, Religion, Kunst und Kultur werden seitens sozialistischer Ideologie dekonstruiert. Etwas salopp könnte man auch sagen, diese Institutionen werden insbesondere von jenen dekonstruiert, die sie nicht haben können: narzisstische, verunsicherte, bindungsschwache Persönlichkeiten, denen obige Trauben zu sauer sind. Doch der Angriff auf alle Bindungsstrukturen geschieht heutzutage nicht mehr offen und direkt, sondern überaus geschickt und mithilfe der sozialistischen Trojaner Gender, Migration und Klima – und neuerdings Pandemie-Abwehr. Kulturmarxisten haben dazugelernt, der Kampf mit offenem Visier ist vorbei, inzwischen ist man nicht mehr rot, sondern grün. Die zeitgenössischen sozialistischen Projekte heißen »Fridays for Future«, »Seebrücke« und »Extinction Rebellion« und »Wir bleiben zuhause«. Und nur Unmenschen werden gegen derartig humanitäre Aktionen etwas einzuwenden haben …