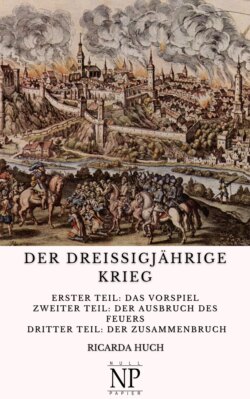Читать книгу Der Dreißigjährige Krieg - Ricarda Huch - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.
ОглавлениеIm Jahre 1585 wurde im Schlosse zu Düsseldorf die Hochzeit des jungen Herzogs Jan Wilhelm mit Jakobe von Baden so pomphaft und majestätisch gefeiert, wie es dem Ansehen des reichen Jülicher Fürstenhauses entsprach. Nachdem die Festlichkeiten abgelaufen waren, verabschiedete sich der Kurfürst von Köln, Ernst von Wittelsbach, der Bruder des Herzogs von Bayern, von der Braut, die seine Nichte war, und sagte zu ihr, er scheide leichteren Mutes, als er gekommen sei; denn es habe oftmals an seinem Gewissen genagt, ob die Heirat, zu der er sie in wohlwollender Meinung und Absicht auf ihr Glück überredet habe, sie auch zufriedenstellen werde. Nun habe er sich aber, da er während der Hochzeit ihr lächelndes Antlitz und auch die vielfache Pracht ihrer neuen Umgebung und die Höflichkeitsbezeigungen der Familie gesehen habe, darüber zur Ruhe begeben.
Jakobe lächelte mit Augen und Mund halb gutmütig, halb spöttisch und erwiderte: »Mich dünkt die Umgebung nicht so prächtig und die Familie nicht so höflich wie Euch. Alle Farben erscheinen mir hier aschenfarben und alle Kurzweil wie Langeweile und Trübsal. Mein Schwiegervater, der alte Herzog, den Ihr mir als den verständigsten und stattlichsten Herrn im Reiche geschildert hattet, ist ein alberner Greis, der den Löffel Suppe verschüttet, den seine zitternde Hand zum Munde führt. Meine fromme Schwägerin Sibylle hat mich mit kalten, trocknen Lippen geküsst und die Augen jämmerlich verdreht, als ob ein Leichenbegängnis gefeiert würde.«
Ja, sagte der Kurfürst ein wenig verlegen, er habe nicht gewusst, dass es so hässlich um den alten Herzog stehe; der Schlag, der ihn kürzlich getroffen, habe seinen Verstand geschwächt, doch sei ja zu hoffen, dass seine Ärzte ihm wieder einen Aufschwung gäben; andererseits sei er bei so hohen Jahren, dass man sich auf seinen Hintritt gefasst machen müsse, und dann werde sie die Herrin werden. Denn sie habe doch wohl Schönheit und Witz genug, ihren Gemahl, ein wie mächtiger Fürst er auch sei, ihrer noch mächtigeren Herrschaft zu unterjochen. Ihr heimliches Händedrücken und Auf-die-Füße-Treten bei der Tafel sei ihm nicht entgangen; sie solle nur bekennen, dass sie mit Jan Wilhelm wohlversehen sei. Dabei streichelte der Kurfürst ihre vollen, dunkelerröteten Wangen und ihren mit Perlenschnüren behängten Nacken.
Mit ihrem Gemahl sei sie zufrieden, sagte sie; sie hätte nicht geglaubt, dass er so hübsch und so artig sei. Der würde ihr gewiss nicht viel zu schaffen machen.
Der Kurfürst betrachtete sie unschlüssig und gab ihr dann noch eine Reihe guter Lehren und Ermahnungen. Zu leicht solle sie sich’s auch nicht vorstellen, sie sei am bayrischen Hofe zwischen frommen und liebevollen Verwandten aufgewachsen, hier in Düsseldorf seien große Aufgaben für sie, aber auch Gefahren, und es gelte Vorsicht und Misstrauen zu üben. Es wäre wohl schön, wenn sie die Kirche in diesen Landen wieder aufrichten könnte; aber die Stände seien meistenteils kalvinisch und hätten leider allzu viel Macht, sie müsse sich hüten, mit der Gewalt dreinzufahren, lieber Gelegenheiten abwarten und listig durchschlüpfen. Vor allen Dingen solle sie sich zurückhalten, bis sie ein Prinzlein geboren haben werde, das werde ihr Ansehen verleihen, und es werde jawohl nicht lange damit anstehen.
Ob er etwa meine, er könne ihr jetzt schon etwas anmerken, sagte die junge Frau lachend, indem sie sich seiner Abschiedsküsse zu erwehren suchte. Er solle nur ihretwegen ruhig sein, sie sei nun einmal hier, habe sich darein ergeben und wolle sich mit Gott so gut einrichten, wie es möglich sei.
Seine Ratschläge seien überflüssig, dachte sie, als er sie verlassen hatte; aber er meine es gut mit ihr und habe sie aufrichtig lieb. Warum sollte er sie auch nicht lieben, da sie doch ihr Angesicht so wonnevoll auf dem runden venezianischen Spiegel wie eine Wasserrose auf blanker Seefläche schwimmen sah. Nun wollte sie aber zeigen, dass sie mehr vermöge als Blicke werfen und Laute spielen; sie, die als Protestantin geboren und durch Gottes Fügung an den bayrischen Hof gebracht und zur Kirche zurückgeführt war, wollte im Jülicher Lande die Ketzerei ausrotten und sich dadurch der höchsten Ehre bei Papst und Kaiser, vor allen Dingen bei ihrem Pflegevater, dem Herzog Wilhelm von Bayern, wert machen.
Nach ihrer Meinung konnte es nicht so bleiben, dass Jan Wilhelm, ihr Mann, als ein Kind und fast als ein armer Tropf am Hofe galt; sie hatte den künftigen Herzog eines reichen Landes geheiratet, und als solcher sollte er sich öffentlich zeigen. Ihm kam es vor, als werde er zum ersten Male recht gewürdigt und in seiner Bedeutung erkannt, und er griff hastig nach den Zügeln der Regierung, um die er sich vorher niemals bekümmert hatte. Da es eben damals geschah, dass die Stadt Wesel, die als eine einhellig kalvinische, tapfere und wohlhabende Gemeinde bekannt war, einen katholischen Geistlichen hinausgeschafft hatte, machte sich Jan Wilhelm dahinter und ordnete an, die Stadt solle eine ihrer Kirchen dem katholischen Gottesdienst einräumen. Dagegen erhoben sich die Stände, die protestantisch waren, als gegen eine gewaltsame Neuerung, und auch der alte Herzog, nachdem er eine Weile erstaunt und misstrauisch zugesehen hatte, verbat sich das vordringliche Gebaren seines Sohnes. Darüber kam es zu bösen Auftritten in der Familie, wobei der alte Herzog vorzüglich Jan Wilhelm bedrohte, Sibylle hingegen Jakoben vorwarf, sie sei schuld an der Verwandlung ihres Bruders, der bis dahin ein frommer, gehorsamer Sohn gewesen sei. Mit dem Schwiegervater und der Schwägerin hätte sich Jakobe allenfalls fertig zu werden getraut; aber mächtiger als diese waren, wie sie allmählich bemerkte, einige Räte des Herzogs, vor allen Herr von Waldenburg, genannt Schenkern, der an Stelle des hinfälligen Alten nach seinem Gutdünken regierte. Dieser war es, dessen Befehlen der Hofstaat und die Dienerschaft gehorchten und der immer dahintersteckte, wenn ihre und ihres Mannes Wünsche auf Widerstand stießen.
Als sie eines Abends mit einigen jungen Herren und Frauen von Adel beim Brettspiel saßen und die Schatulle leer fanden, aus der sie das Geld zu einem neuen Einsatz nehmen wollten, wurde ihnen vom Zahlmeister, nach dem sie schickten, bedeutet, sie hätten mehr verbraucht, als ihnen zustehe, er wolle ihnen wohl für den Augenblick mit einer Kleinigkeit aus seinem Eigenen aushelfen, inskünftige möchten sie aber das Wams nach dem Stücke schneiden und die Schleppe ein wenig stutzen.
Es gelang Jakobe nicht, in ihrem Manne dieselbe Entrüstung zu erregen, die sich ihrer bemächtigt hatte, noch weniger, ihn zum Einschreiten gegen den Marschall Schenkern zu bringen, auf den der Zahlmeister sich berufen hatte. So zog sie denn den mächtigen Mann selbst zur Rechenschaft und hielt ihm vor, dass sie nicht etwa ihn um Geld bitte, vielmehr verlange, dass ihr unerbeten geliefert werde, was zur Bestreitung eines fürstlichen Hofhalts erforderlich sei.
Das sei ihnen geliefert worden, entgegnete Schenkern kalt, sie hätten es aber allzu schnell verbraucht.
Das Blut stieg der jungen Frau ins Gesicht. Nicht so viel sei ihr gereicht worden, wie sich zum Nadelgeld für eine unvermählte Prinzessin schicke. Was sie denn ausgegeben hätte? Gewänder und Kleinodien hätte sie mitgebracht, hier nichts dergleichen erhalten. Ob es ihr etwa verboten sein solle, bei ihrem täglichen Gang in die Messe Almosen auszuteilen? Oder ob ihnen das Brett- und Kartenspiel als ihre einzige Unterhaltung zu missgönnen sei? Es gebe Untertanen des Herzogs, die prächtiger als sie und ihr Herr aufzögen, ausreisten, so oft und wohin es ihnen beliebte, und Gnaden verteilten wie regierende Fürsten. Dabei lenkte sie das zornige Feuer ihrer dunkelblauen Augen gerade auf ihn.
»Ich genieße«, sagte Schenkern mit dreistem Lächeln, »was meine Ämter mir einbringen. Einem jeden das Seine. Ihre Gnaden müssen mit Ihrem Einkommen haushalten und sich in die Stellung Ihres Gemahls fügen lernen, die bescheidener ist als die hochfahrenden Mienen und Worte Eurer Gnaden. Denn bis jetzt ist der junge Herr nur der erste Untertan unseres regierenden Herzogs.«
»Der Rat, den Ihr mir gebt, ist gut für Euch«, rief Jakobe aufbrausend. »Wir werden sehen, wer sich eher in die Stellung bücken muss, die ihm zukommt, Ihr oder ich.«
Einstweilen freilich musste Jakobe das kärgliche Leben fristen, das ihr vorgeschrieben war, womit es eher schlimmer als besser wurde, umso mehr, als sie nach Verlauf einiger Jahre noch immer nicht schwanger geworden war. Die Sucht, sich hervorzutun, zu der sie Jan Wilhelm angespornt hatte, ließ gänzlich bei ihm nach und wich trüben Gedanken, wie dass Gott ihn mit Kinderlosigkeit für seine Sünden strafe, als welche er vorzüglich ansah, dass er seinem Vater getrotzt und dass er Elend über seine Untertanen gebracht habe. Es waren nämlich in die Stadt Wesel, die er zur Einführung eines katholischen Pfarrers hatte zwingen wollen, spanische Truppen eingelegt worden, die sich wegen des Krieges mit den niederländischen Staaten an der Grenze befanden, und er hatte eine Bittschrift der Stadt gelesen, in der sie über ihre Bedrängung Klage führte. Ein Satz, der darin vorkam, nämlich: ›Schreit es nicht zum Himmel, dass schutzlose Witwen und Waisen, die keines anderen Verbrechens schuldig sind, als dass sie in ihrem Glauben verharren wollen, von einer fremden, grausamen Soldateska unausstehliche Marter und Qual Leibes und der Seele erdulden müssen?‹, hatte sich ihm so eingeprägt, dass er durch nichts anderes zu verdrängen war. Weder Schelten noch Schmeicheln, wodurch Jakobe ihn wechselweise umzustimmen suchte, noch die sonst beliebte Zerstreuung des Brett- oder Ballspiels verfingen; ja, eines Tages kam es so weit, dass der Prinz sich aufzustehen weigerte, weil ihm die Lust am Leben vergangen sei.
Um diese Zeit starb Dietrich von Horst, der Jan Wilhelm erzogen hatte und dem er, obwohl er von ihm mit Strenge behandelt worden war, so zärtlich anhing, dass man sich nicht getraute, seine Schwermut durch die Todesbotschaft zu vermehren. Die Ärzte des alten Herzogs, unter denen ein sechzigjähriger Mann, der Doktor Solenander, das meiste Ansehen hatte, erteilten den Rat, den Kranken durch eine Reise zu entfernen; währenddessen könne der von Horst bestattet werden, und zugleich würden die neuen Eindrücke den jungen Herzog auf andere Gedanken bringen.
Jakoben, die ihren Gemahl begleiten wollte, riet Solenander freundlich davon ab; er ehre und verstehe ihre Liebe und Treue, urteile jedoch als Arzt, dass eine vollständige Veränderung der Umgebung dem Kranken am dienlichsten sei, besonders auch, weil es nicht anders sein könne, als dass die Nähe seiner jungen und schönen Frau ihn zu allerhand Zärtlichkeiten ehelicher Liebe reize, wodurch er seine Kraft erschöpfe, und das müsse eben jetzt am allermeisten vermieden werden. Trotz ihres Vorurteils gegen den Arzt, der kalvinisch war, flößte sein redliches und würdiges Wesen ihr Vertrauen ein, sodass sie ihm mit kindlich huldvollem Lächeln erwiderte, sie wolle sich seinen Anordnungen fügen. Freilich war es ihr aufs bitterste zuwider, dass es Schenkern war, dem ihr Mann anvertraut wurde und der ihn wie einen Gefangenen mit sich führte; allein sie tröstete sich damit, dass Jan Wilhelm in einem leidlichen Zustande wiederkommen und dass sie zunächst einmal von dem Druck seiner seltsamen Melancholie frei sein werde.
So recht von Herzen frei und fröhlich, ob man das in dem weitläufigen Schlosse von Düsseldorf sein könne, daran zweifelte sie zwar. Oftmals stand sie vor dem Bilde der verstorbenen Herzogin Maria, der Mutter ihres Mannes, die, wie man ihr erzählt hatte, jahrelang voll irrer und trübseliger Gedanken, fast abwesenden Geistes gewesen war. Nicht ohne Grauen betrachtete sie die schmale, in sich zusammengekrochene Gestalt, die von dem scharlachfarbenen Brokatkleid erdrückt schien, das spukhaft bleiche, angstvolle Gesicht unter den gelblich-roten Haaren und die dünnfingrigen Hände, die sich wächsern um ein Andachtsbuch bogen. Auch ihr gefiel es, Schwiegertochter einer Tochter des hochseligen Kaisers Ferdinand I. und Tante des regierenden Kaisers Rudolf zu sein; trotzdem machte es sie ein wenig lachen, dass man sich hier auf diese missratene Person so viel zugute tat. Wie ein Gespenst vor der Morgenröte musste dies Jammerbild vor ihrer Kraft und Schönheit erlöschen! Verse aus einem Gedicht fielen ihr ein, das Graf Philipp von Manderscheid einst für sie gemacht hatte, ihr Geliebter, den ihre Heirat in Raserei und selbstmörderischen Tod getrieben hatte, und die lauteten: ›Königin Sonne, du leuchtest so! Ich und der Sommer, wir brennen lichterloh!‹
Ein tiefer Unmut stieg in ihr auf: während die Welt überall voll Lust und Prangen war, musste sie in diesem Schlosse eingesperrt sein, dessen Luft Gott weiß woher von verderblichen Übeln voll zu sein schien. Kaum war sie der düsteren Gesellschaft ihres Mannes ledig, so kam der alte Herzog und klagte sich unter Weinen und Seufzen an, er habe den einzigen Sohn, der ihm übriggeblieben sei, zur Verzweiflung getrieben, indem er ihn nicht zur Regierung habe zulassen wollen; das habe ihn mit argwöhnischen und widerwärtigen Gedanken erfüllt; er sei ein harter, ungerechter Vater gewesen, zur Strafe werde nun sein Haus aussterben und Unglück über sein Land kommen. Jakobe dachte bei sich, dass dem Alten recht geschehe; aber lange mochte sie ihn doch nicht weinen sehen und beschwichtigte ihn mit mitleidigen Worten und ausgelassenen Neckereien, sodass er sie zuletzt aus seinem Jammer kläglich anlachen musste. Er und Sibylle schrieben lange Briefe an Jan Wilhelm, er solle sich nur lustig machen, daheim gehe alles gut und nach Wunsch; denn Doktor Solenander hatte ihnen gesagt, es sei wichtig, dass der Kranke heitere Eindrücke erhalte.
Drei Tage später jedoch wurde der Reisende von Schenkern zurückgebracht, der erklärte, nach einer anfänglichen Besserung habe des Kranken Melancholie so zugenommen und ein so heilloses Ansehen gewonnen, dass er schleunig habe umkehren müssen; der Wunsch, zu Hause zu sein, sei der einzige Trieb gewesen, der noch einiges Leben in dieser armen Seele verraten habe. Eine gewisse Beruhigung schien der Kranke zu spüren, als er sich wieder in Jakobes Händen fühlte; allein wenn er auch allmählich zu einer Lebenstätigkeit zurückkehrte, so war diese doch unregelmäßig und ungeordnet und erweckte Grauen. Des Nachts besonders ruhte er nicht, sondern ging hin und wider in den langen Gängen des Schlosses und verlief sich wohl gar, und wenn der alte Herzog oder sonst jemand von der Familie ihm entgegentrat mit Beschwörungen, er solle sein Lager aufsuchen, so stierte er sie sinnlos an oder schrie und fuchtelte mit den Armen, bis sie zurückwichen und sich verbargen.
Einmal erwachte Sibylle in der Nacht durch ein absonderliches Krachen der Stiege unter dem Dache, und da sie, vorsichtig schleichend, dem Geräusch nachging, kamen ihr ihres Bruders Bedienstete verstört entgegen und meldeten, dass er in Begleitung eines einzigen Edelknaben auf die Zinne des Schlosses gestiegen sei, um nach dem Feinde auszulugen, und dass er gedroht habe, es dürfe ihnen niemand folgen. Sibylle weckte zitternd den Alten, kleidete ihn notdürftig an und zog ihn, der kaum verstand, was vorging, mit sich fort aus dem Tor hinaus auf den Schlossplatz. Es war November, und der Sturm heulte feucht von Westen her über den Rhein. Nach oben blickend, gewahrte Sibylle auf dem Dache eine schattenhafte Bewegung und unterschied zwei Gestalten, von denen die kleinere eine Fackel trug, deren Flamme die sausende Luft flackernd auseinanderbog; die andere, hoch und schmal, warf lange Arme in die Luft, bückte sich, kniete nieder und beugte sich weit zwischen den Zinnen vor in die Tiefe. Mit entsetztem Finger deutete Sibylle auf das herabhängende Haupt, dessen langes Haar der Wind hin und her blies; plötzlich erlosch die Fackel, die von dem Knaben gehalten wurde, worüber der in seinem Pelz schaudernde Alte erschrak und, beide Arme nach oben ausbreitend, den Namen seines Sohnes hinaufjammerte. Angstvoll drückte Sibylle ihre Hand auf seinen Mund, weil sie glaubte, es sei gefährlich, einen Nachtwandler anzurufen; ohnehin hatte der Wind die schwachen Greisenlaute verweht, und es schien nicht, als ob der irre Träumer sich der Gegenwart seiner Angehörigen bewusst geworden sei.
Jakobe war erwacht, als ihr Mann das Lager verließ; da sie aber daran gewöhnt war, hatte sie sich nicht darum bekümmert und war wieder eingeschlafen. Als Sibylle mit grämlich scharfen Worten darauf hindeutete, sagte Doktor Solenander, der Schlaf sei der armen Frau wohl zu gönnen, die tagüber Plage und Sorge vollauf habe. Vielleicht sei es ratsam, um verderbliche Zufälle zu verhüten, dass Jakobe künftig das Schlafgemach zuschließe und ihren Mann nicht hinausgehen lasse, vorausgesetzt, dass sie sich getraue, ihn zu bemeistern. Übrigens sei da nichts zu machen, als dass der Körper des Kranken verständig durch gute Luft und milde, bekömmliche Nahrung gepflegt werde, damit von dort aus das trübe Wesen nicht noch genährt werde; er habe auch erfahren, dass die absterbenden Monate November und Dezember Schwermütigen gefährlich wären, und vertröstete auf das neue Jahr, dessen wachsendes Licht Besserung bringen könne.
Diese Hoffnung versiegte in den Frühlingsmonaten, da sich in dem Zustande des Kranken nichts Wesentliches änderte, wie er auch wechselte. Jakobe vermochte ihn wohl nachts im Schlafzimmer festzuhalten, indem sie seinen Wutausbrüchen tapfer standhielt; nun aber weigerte er sich zu essen, weil die Speisen, die man ihm vorsetzte, vergiftet seien, und bezichtigte die kalvinischen Ärzte, dass sie ihm nach dem Leben stellten. Wenn der Alte, Sibylle oder Jakobe vor seinen Augen aus seiner Schüssel aßen, nahm er wohl auch ein wenig davon, aber mit Seufzen und Ekel, und wendete sich bald stillschweigend weg nach der Wand; denn er blieb meistens im Bett liegen und stand erst am späten Abend auf, um stundenlang im Gemach auf und ab zu gehen.
Die Kunde von der seltsamen Erkrankung des Erben von Jülich-Cleve war nicht geheimzuhalten und regte viele Höfe auf, indem die Fürsten das Anrecht und die Anwartschaft überlegten, die sie etwa an der beträchtlichen Erbschaft könnten geltend machen. Die schwächliche Leibesbeschaffenheit Jan Wilhelms hatte schon in seinen Knabenjahren allerlei besondere Gedanken in der Verwandtschaft aufkommen lassen; als jedoch der junge Herzog mannbar wurde und heiratete, hatte man es dabei bewenden und auf sich beruhen lassen. Wie nun die Nachkommenschaft ausblieb und ein Gebrechen um sich griff, das aller ärztlichen Kunst spottete, setzte man sich allerorten in Bereitschaft, um bei der ersten Gelegenheit zuzugreifen, ehe ein anderer zuvorkäme. Vollends als im Jahre 1592 der alte Herzog starb, dessen erloschener Geist dem Zusammenbruch noch gewehrt hatte, wie eine von Dünsten verhüllte Mondscheibe die Bilder der Erde trübe zusammenhält, die nach ihrem Untergange in Nacht versinken, nahm die Verwirrung und Entzweiung im Schlosse auf das ärgste zu und ebenso die Begier der beteiligten Anverwandten, sich einzumischen.
Sibylle und Jan Wilhelm hatten drei ältere Schwestern, die in der Zeit aufgewachsen waren, als der nun verstorbene Herzog, Wilhelm der Reiche, noch rüstig und seines Geistes mächtig gewesen war. Im evangelischen Glauben erzogen, waren sie froh, den Verfolgungen, die sie durch den wachsenden Einfluss der katholischen Räte erdulden mussten, zu entrinnen, indem sie sich mit protestantischen Fürsten vermählten, die älteste, Marie Eleonore, mit dem brandenburgischen Herzog von Preußen, die beiden anderen mit zwei Wittelsbacher Vettern, dem Pfalzgrafen Philipp Ludwig von Neuburg, der eine unerschütterliche Säule des lutherischen Bekenntnisses war, und dem Pfalzgrafen Johann von Zweibrücken, einem unerschrockenen Vorkämpfer des Kalvinismus. Als Marie Eleonore, von ihrem Vater selbst geleitet, in Preußen anlangte, ergab es sich, dass der Bräutigam blödsinnig und also keineswegs der stattliche Freier war, als welchen man ihn am Jülicher Hofe empfohlen hatte; allein die Braut, von deren Entscheidung abhängig gemacht wurde, was nun geschehen sollte, dachte an ihre trübselige Gefangenschaft im Schlosse zu Düsseldorf, wo ihr Vater, um sie zur Messe zu zwingen, sie an den Haaren geschleift hatte, und urteilte, dass sie es als Herzogin von Preußen eher besser als schlimmer haben und wenigstens in Sicherheit ihrem Glauben obliegen können werde. Demgemäß erklärte sie sich bereit, des Schwachsinnigen Frau zu werden und ihn treu und geduldig zu pflegen. Jetzt ließ sie es sich angelegen sein, ihr väterliches Land den Brandenburgern zuzuwenden, damit es nicht in die Gewalt der Katholiken käme.
Der Pfalzgraf von Zweibrücken, ein biederer, ungestümer Herr, der es nicht anders wusste, als dass die Protestanten Söhne des Lichts und die Katholiken Söhne der Finsternis wären, und die letzteren bekämpfte, wie und wo er vermochte, misstraute der Jakobe, die erst kürzlich vom Papst durch die Goldene Rose ausgezeichnet worden war; aber als er in das Treiben am Düsseldorfer Hofe mit eigenen Augen hineinsah, gewann es damit eine andere Gestalt. Es wurde deutlich, dass der erzkatholische Schenkern, der es mit Spanien hielt, und Sibylle, die täglich lange Briefe voll Heimlichkeiten an die jesuitischen Wittelsbacher in München schrieb, ihre Feinde waren und sie in allen ihren Rechten kränkten.
Die protestantischen Stände, Graf von Falkenstein, die Herren von Bongart, Orsbeck und Palland, mit denen der Pfalzgraf sich in Verbindung setzte, erzählten, die arme Herzogin sei übel daran; obwohl sie stolz und leidenschaftlich sei, vermöge sie allein nichts wider Schenkern, der keinen Zipfel der Macht aus den Händen lassen wolle. Deshalb bediene sie sich ihrer, der Stände, um ihren Willen durchzusetzen; sowie es sich aber darum handle, ihnen den Preis zu bewilligen, um den sie arbeiteten, nämlich die Duldung ihres Bekenntnisses, so weiche sie aus und zürne wohl gar, dass man ihr, der Herzogin, eine Rechnung mache, anstatt ihr umsonst zu dienen. Schenkern würde sich dem Teufel verschreiben, um die Macht zu behalten, ja hätte es eigentlich schon getan, da er mit den Spaniern im geheimen Bunde sei. Es sei weit und breit keine Hilfe für die Herzogin als bei ihnen, möchte sie es nur einsehen! Sie ihrerseits setzten ihre Hoffnung auf die protestantischen Erbansprecher, denen sie gern den Weg ins Land bahnen wollten.
Wie stürmisch des Pfalzgrafen Sinn auch war, wusste er doch, dass er sich einstweilen noch zurückhalten musste, besonders weil das Erbrecht seiner Frau durch einen Verzicht, den sie bei der Heirat getan hatte, zweifelhaft und sein Land zu klein und unausgiebig war, als dass er vereinzelt etwas hätte ausrichten können. Zunächst riefen die streitenden Parteien die höchste Macht des Kaisers an, und Gesandte und Bevollmächtigte reisten zwischen Prag und Düsseldorf ergebnislos hin und wider. Die Instruktionen Kaiser Rudolfs waren nämlich darauf zugerichtet, dass der Zustand womöglich erhalten bliebe, in dem alle Parteien sich die Waage hielten, und höchstens etwa Schenkern ein wenig geschützt würde, von dem man sich am ehesten Nutzen versprach; denn so blieb der Kaiser Schiedsrichter und konnte nach dem Aussterben der regierenden Familie desto besser die Beute an sich reißen.
Zuweilen war Jakobe niedergeschlagen und weinte verstohlen, um nachher desto fröhlicher zu sein. Es gehörte zu ihrem Hofstaat ein Narr, den sie wohl leiden mochte, weil er sie jederzeit zum Lachen brachte. Er hatte ein bartloses Gesicht, dem nicht anzusehen war, ob er jung oder alt sei, und eine jämmerliche Miene, obwohl er sich gewöhnt hatte, seinem Berufe gemäß beständig Späße zu machen, ja auch das Ernsthafte in alberner Form vorzubringen. Jakobe pflegte stundenlang tolles Zeug mit ihm zu schwatzen und lachte bis zu Tränen dabei, besonders wenn ihre Schwägerin Sibylle dazukam und scheele Blicke auf ihre Ausgelassenheit warf. Einmal beriet sie mit dem Narren, was sie anstellen könnten, um ihren schwermütigen Gemahl zu erheitern, und nach allerlei Vorschlägen, mit denen sie sich gegenseitig steigerten, kamen sie überein, der Narr solle Kleider und Kopfputz der Herzogin anlegen und so zu Jan Wilhelm gehen und ihm schöntun, wie wenn er Jakobe wäre, was sie auch ausführten. Durch eine Spalte der Tür sah Jakobe zu, wie der Narr, den sie selbst ausstaffiert hatte, seine weinerliche Stimme so süß anschlug, wie er konnte, um dem Kranken allerlei gezierte und freche Zärtlichkeiten vorzutragen, und ihn zuletzt zu einem Tänzchen bewog, wobei er sich absonderlich verdrehte und mit der schweren Schleppe ihres Gewandes scharwenzelte. »Gott steh mir bei«, sagte Jakobe, während sie den seufzenden Narren aus seiner Vermummung befreite, »was für ein Scheusal bin ich in meines Gemahls Augen! Mich nimmt wunder, wie er doch allewege so sehr in mich verliebt sein mag.«
Indessen musste Jakobe wahrnehmen, dass die Anhänglichkeit ihres Mannes, der sie sich nach fast zehnjähriger Ehe und nach so vielen Proben sicher wähnte, abnahm, ja zuweilen sich in das Gegenteil verkehrte. Meinte sie anfänglich, dass es sich nur um eine der sinnlosen Launen handle, wie seine Krankheit sie mit sich brachte, so überzeugte sie sich allmählich, dass etwas anderes dahintersteckte, und richtete ihren Verdacht auf Schenkern, der nebst seinen Anhängern den Herzog häufig besuchte und auf ihn einredete. Als sie nun den Dienern Befehl gab, niemanden mehr ohne ihr Wissen zu ihrem Gemahl zu lassen, kam eines Tages Herr von Ossenbruch, in allen Dingen Schenkerns Helfer und Geselle, das Kammerfräulein beiseite schiebend in ihr Gemach und beklagte sich, dass sie den Herzog absperre.
Wie er sich erdreisten könne, so gröblich zu ihr hereinzufahren, herrschte sie ihn an. Sie solle ihn doch nicht für ihren Feind ansehen, sagte nun Ossenbruch, sie sei ein viel zu schönes Weibchen, als dass ein Mann sie hassen könne. Sie stehe ja auch so verlassen da, und wenn sie des Trostes bedürfe, möchte sie sich doch an ihn halten, er sei ein Mann für zehn Männer, er sei ein Fels, sie solle es nur mit ihm versuchen, und so weiter. Wie er ihr dabei zudringlich näher kam und sein dunstiger Atem sie streifte, rief sie, er sei betrunken und solle sie auf der Stelle verlassen, was er aber nicht für Ernst nahm; so schlug sie ihn mit der Hand in das gedunsene Gesicht und gebot den Dienern, die inzwischen herbeigeeilt waren, ihn fortzuschaffen.
Hierüber kam es zu einem Streit mit Schenkern, der Genugtuung für den seinem Freunde zugefügten Schimpf forderte, während Jakobe verlangte, dass Ossenbruch bestraft und dass sie inskünftig vor ähnlicher Ungebühr gesichert würde. Es wundere ihn, sagte Schenkern, was für überspannte Prätentionen sie stelle, da sie doch ihre Pflichten als Gemahlin des Herzogs nicht erfülle, vielmehr ihren Mann einschließe, um allein zu herrschen, ihm auch nicht einmal einen Erben geboren habe, was ihn füglich veranlassen könnte, das unfruchtbare Bündnis aufzulösen, wofür es an Beispielen aus der alten und neuen Geschichte nicht fehle. Mit spöttischem Lächeln entgegnete Jakobe, er habe wohl vergessen, dass sie und ihr Gemahl der heiligen katholischen Kirche angehörten, welche die Ehescheidung nicht zulasse; solange sie am Leben sei, könne der Herzog nur Bastarde zeugen, wenn er überhaupt dazu fähig sei.
Schenkern antwortete darauf nicht; denn es traf ihn, dass sie recht haben könnte: solange sie am Leben sei, würde er nichts Durchgreifendes ausrichten können. Es war in der Tat unwahrscheinlich, dass der Papst sich zur Scheidung der Ehe bereitfinden lassen würde; wollte er, Schenkern, den Herzog anderweitig vermählen, so müsste Jakobe sterben. Nachdem er sich dies eine kurze Zeit hatte durch den Kopf gehen lassen, schrieb er an den Doktor Solenander, der mit Giften wie mit Heilmitteln Bescheid wusste, weil es zum gemeinen Nutzen notwendig sei, solle er die Herzogin Jakobe, die den Tod vielfach aus diesen und jenen Gründen verdient habe, ganz heimlich mit einem geeigneten Gifte, das etwa einer Arznei oder den Speisen beigemischt werden könne, vergeben; zugleich ihn mit nicht ausbleibender schrecklicher Strafe bedrohend, falls er von dem heiklen Geschäft etwas ruchbar werden ließe.
Solenander beantwortete dies Schreiben mit einem Briefe des Inhalts: Einem Arzte, der im Namen Gottes die Kunst, zu heilen und die Menschen an Leib und Leben zu fördern, ausübe, sei es desto schändlicher, seine Wissenschaft zum Zwecke des Mordes zu benützen, und weder die Furcht vor Rache noch die Gier nach Belohnung würde ihn je dazu bewegen, sich an irgendjemandem, geschweige an der Herzogin zu vergreifen. Habe dieselbe eine Schuld auf sich geladen, so sollten Richter, denen es zustehe, darüber erkennen; er sei aber der Meinung, wenn er auch den Staatsgeschäften fernstehe, dass sie sich kein so barbarisches Urteil mit Recht zugezogen habe, da vielmehr, selbst wenn sie aus Jugend und Unbedacht sich einmal verfehlt hätte, die traurige und höchst schwierige Lage, in die sie unvorbereitet geraten sei, sie von jedem Vorwurf freisprechen müsse.
Nicht ohne Besorgnis betrachtete Solenander seitdem die Herzogin, die er von dem Mordwillen eines fast allmächtigen Mannes umkreist wusste, und er sann vergeblich, wie sie aus dem Feuergürtel, der sie umzüngelte, zu retten sei. Das gefährliche Geheimnis jemandem anzuvertrauen, wagte er nicht; es hätte wohl auch nicht einmal ein Fürst den Gewalthaber, der den Kaiser und sogar den König von Spanien hinter sich hatte, auf das bloße Zeugnis eines an einen Arzt gerichteten Briefes zu stürzen unternehmen dürfen. Gelegentlich ließ er ein warnendes Wort gegen Jakobe fallen, sie solle doch Nachgiebigkeit und Vorsicht üben, da sie bei der traurigen und leider unheilbaren Krankheit des Herzogs einer Witwe gleichzustellen und schutzlos den grausamen Unbilden des Lebens preisgegeben sei; aber sie lachte ihn aus in der Meinung, Gott sei ihres Rechtes und ihrer guten Absicht bewusst und werde sie so oder so am Ende zum Triumphe führen.
Indessen hatte Schenkern beschlossen, da Solenander versagte, die Herzogin durch die Anklage auf ein Kapitalverbrechen zu stürzen, und war eifrig bemüht, den Stoff dazu zusammenzubringen. Deshalb näherte er sich allmählich der Sibylle, die kümmerlich und sorgenvoll als eine freiwillig Gefangene im Schlosse lebte und sich gegen jedermann beklagte, dass die Schwägerin sie nicht zu ihrem Bruder lasse und dass sie seit dem Tode ihres Vaters verachtet und verstoßen in steten Ängsten leben müsse. Er hinterbrachte ihr, wie das Unkraut der Ketzerei im Lande fortwuchere, da es nicht ausgereutet werde, sondern unter dem Schutze der Herzogin sich frech ausspreizen könne; wie die protestantischen Fürsten sich schon als Herren gebärdeten und wie man ihr, der Sibylle, zu guter Letzt auch noch einen ketzerischen Gemahl aufzwingen werde.
Das solle niemals geschehen, sagte Sibylle, lieber wolle sie unter ausgesuchten Martern sterben; sie habe es aber auch schon bemerkt, dass man sie herumzukriegen hoffe.
Wenn sie nur eine Stütze an ihrem Bruder hätte, sagte Schenkern. Es sei doch wunderlich, wie Jan Wilhelm vor der Hochzeit ein so gesunder, frommer und trefflicher Herr gewesen sei und wie mit dem Einzuge der Jakobe das Unwesen seinen Anfang genommen habe.
Niemals habe sie ihr trauen mögen, sagte Sibylle; schaurig sei es ihr über die Haut gelaufen, als sie sie zuerst erblickt habe, und auch ihr armer Bruder habe oft wunderliche Reden über sie geführt, wenn er sich auch nicht offen herausgetraut hätte, da er offenbar von ihr verstrickt und verzaubert gewesen sei. Dass sie ihm niemals mit rechter ehelicher Liebe zugetan gewesen sei, könne sie, Sibylle, genugsam beweisen; was für Teufeleien sie mit ihm und ihnen allen vorhabe, wisse keiner genau, und es sei wohl angezeigt, sich rechtzeitig in Defension zu setzen. Es hielt nicht schwer, die Prinzessin in der Überzeugung zu bestärken, es werde nicht eher gut, als bis Jakobe mit ihren Teufelskünsten fortgeräumt sei; dann erst werde es mit der Religion, dem Herzog und dem ganzen Lande wieder in den alten Flor kommen. Als eine fleißige Schreiberin setzte Sibylle die Punkte auf, durch welche ihre Schwägerin sich von Anfang an verdächtig gemacht habe, ging sie mit Schenkern durch, der noch dies und jenes hinzusetzte, und gab das Versprechen, vor Gericht alles mündlich zu wiederholen und zu bekräftigen, wenn der Prozess nur stracks angezettelt und eifrig gefördert würde.
Bald danach kam Herr von Bongart in großer Erregung zu Jakobe: Schenkern habe allen Ständen, Beamten und herzoglichen Dienern angezeigt, der Herzog werde unter dem Vorgeben, dass er krank sei, von seiner Gemahlin in gefängnishafter Einsperrung gehalten; niemand solle ihr bei Strafe Leibes und Lebens mehr dienen, er wolle den Herzog befreien, damit die Untertanen ihres rechtmäßigen Herrn wieder genießen könnten. Jakobe solle nicht meinen, dass dies nur leere Drohungen wären; man munkle schon, dass auf ein gegebenes Zeichen die Spanier einfallen und eine neue Bartholomäusnacht veranstalten würden, welcher keiner entrinnen sollte, der reformierten Glaubens sei oder sich Schenkern widersetzen würde. Die Herzogin müsse sich nun entscheiden, ob sie es mit ihnen halten wolle, so wollten sie auch Gut und Blut an ihre Rettung wagen. Sie solle ihrem Glauben in Frieden anhängen und ihn im Schlosse ausüben, ebenso sollten ihre Glaubensgenossen, sofern sie sich bescheiden hielten, vor gewaltsamer Bedrängung sicher sein; doch müsse sie ihrerseits den Reformierten ihren Glauben und sonstige Rechte verbürgen und ihnen Sicherheit gegen die Spanier und Jesuiten geben. Sie wollten sich jetzt mit ihrem fürstlichen Wort zufriedenstellen, weil Gefahr im Verzuge sei, später, wenn sie erst freie Hand vor den Tyrannen hätten, könne der Vertrag im einzelnen ausgemacht werden.
Nein, rief Jakobe aufflammend, sie kennten sie schlecht, wenn sie glaubten, dass sie etwas zur Verkleinerung ihrer Religion unternehmen würde. Dann würde Gott freilich die Hand von ihr abziehen, wenn sie Land und Leute den Ketzern auslieferte. Sie wolle mit Hilfe Gottes und auf seine Gerechtigkeit bauend aller ihrer Feinde Herr werden. Davon war sie nicht abzubringen, sodass Bongart nach langer vergeblicher Unterredung mit düsterer Miene das Schloss verließ.
Jakobe meinte im Schlosse sicher wie in einer Festung zu sein; als aber die Dunkelheit des Abends hereinbrach und sie vom Rhein her ein Plätschern und Rauschen zu hören glaubte, wurde ihr bange, und es fiel ihr ein, selbst an den Fluss zu gehen und den Fährleuten zu befehlen, dass sie während der Nacht niemanden, wer es auch sei, übersetzten. Sie legte ihren Pelz an, denn es war Winter, und ging, nur von einer ihrer Kammerfrauen begleitet, zu den Hütten der Fährleute, die ihr bereitwillig Gehorsam zusicherten. Über dem schwarzblanken Strome wogte kalter Dunst, und am Himmel glitzerten die Sterne mit Eisglanz. Es könnte leicht die kälteste Nacht des Winters werden, sagte ein Fährmann, indem er dem Rauch seines Atems nachblickte. Sie wolle ihnen einen guten Schlaftrunk hinunterschicken, sagte Jakobe munter; dann sollten sie sich aufs Ohr legen und ausruhen, denn in dieser Nacht sei ihr Dienst, keine Dienste zu leisten.
Wie ehrlich die Fährleute es auch im Augenblick meinten, stimmten sie doch die Versprechungen Schenkerns und noch mehr seine Drohungen rasch um; denn wer, dachten sie, würde sie hernach vor seinem Zorne beschirmen? und so setzten sie die Verschworenen mit ihren Knechten und Waffen nacheinander über den Strom. Auch im Schlosse fanden diese nur geringen Widerstand, besetzten es, quartierten Jan Wilhelm in die Gemächer seiner Gemahlin ein und führten Jakobe unter höhnischen Drohungen und anzüglichen Späßen in das Zimmer, das er seit drei Jahren nie verlassen hatte. Sie sei die Zauberin Circe und habe ihren eigenen Gemahl als ein verächtliches Schwein in einen Koben gesperrt; aber wie der rühmliche Held Odysseus die Listige überlistet habe, so müsse sie nun selbst in den unflätigen Käfig wandern, wo sie zuvor das Opfer ihrer Teufelskünste gehalten hätte.
Wie dann die förmliche Anklage ans Licht trat, in welcher Jakobe als eine Ehebrecherin und Zauberin abgeschildert war, die den Scheiterhaufen verdient habe, entsetzte und entrüstete sie sich zwar anfänglich; aber sie tröstete sich ihres Mannes, der sie, wie sie meinte, doch nicht ganz vergessen und verstoßen haben könnte, ferner des Kurfürsten Ernst, des alten Herzogs von Bayern, ihres Pflegevaters, und anderer Freunde, schließlich der Stellvertreter Gottes auf Erden, des Papstes und des Kaisers, welche beide oftmals ihr väterliches Wohlwollen für sie umständlich angezogen hatten.
Was Jan Wilhelm anbelangt, so bekam er krampfhafte Zufälle, wenn man nur den Namen seiner Frau nannte, und schimpfte sie Betrügerin, Zauberin und Hexe, die ihm zuerst mit gottlosen Ränken den Kopf krank gemacht und ihn dann für toll ausgegeben habe, um die Herrin zu spielen und seiner zu spotten. Als es ihr vermittelst ein paar treuer Diener gelang, ihm einen Brief zuzuspielen, in dem sie ihn an die eheliche Liebe und Treue mahnte und anflehte, sie im Unglück nicht zu verlassen, antwortete er ihr, er liebe sie zwar immer noch zärtlich, könne ihr aber wegen ihrer Untreue und Bosheit nicht mehr vertrauen und stelle alles der Zukunft anheim; und hernach noch einmal, er werde nun eine neue, hübsche und junge Gemahlin nehmen, bei der er es gut haben werde; mit ihr, Jakoben, habe er nichts mehr zu schaffen, und sie solle sich nicht unterstehen, wieder an ihn zu gelangen.
Trotz Schenkerns und Sibyllens Eifer schleppte der Prozess sich langsam hin; denn die kaiserlichen Abgeordneten waren beauftragt, nichts Endgültiges von sich zu geben, vielmehr die Sache hinzuspinnen, umso mehr, als Jakoben nichts nachzuweisen war, was ein Malefizurteil begründet hätte. Andererseits hätte ein Freispruch die Gegenpartei bloßgestellt und neue schwierige Knoten geschürzt. In allen Punkten vermochte sich Jakobe gut oder genugsam zu verteidigen. Sie gab zu, allerlei Mittel zur Heilung des Herzogs versucht zu haben, so habe sie Zettel mit Sprüchen in sein Wams eingenäht, um Zauber und schädlichen Einfluss von ihm fernzuhalten; aber die Gegenpartei, namentlich Sibylle, hätte dergleichen als etwas Übliches auch vorgenommen. Doktor Solenander gab das Urteil ab, solche Mittel seien zwar abergläubisch und könnten Krankheiten nicht überwinden, ebensowenig jedoch sie hervorrufen oder steigern. Dass sie Ehebruch begangen habe, bestritt sie, wenn sie auch zugestand, dass ein gewisser junger Edelmann ihr gern und häufig aufgewartet habe. Der freundliche Umgang mit ihm, sagte sie, könne ihr nicht als Sünde angerechnet werden, da sie so einsam und freundlos, einer Witwe gleich, gelebt habe. Am wenigsten ließ sich mit dem Verdacht der Ketzerei ausrichten, da sie die Anforderungen der protestantischen Stände niemals wirklich bewilligt hatte und viele Zeugen aussagten, wie fleißig sie nicht nur stets die Messe besucht, sondern auch die Andacht in ihrem Gemach verrichtet hatte. Als man ihr vorwarf, dass in dem fürstlichen Trauerhause, wo Gott, sei es zur Strafe oder zur Warnung, die Lichter ausgeblasen habe, sodass die Bewohner, voran Sibylle, in einem Labyrinth von Trübsal, Furcht und Grauen umhergeirrt wären, man sie allein, Jakoben, allezeit guter Dinge und zu Späßen aufgelegt gesehen habe, reckte sie sich ein wenig und sagte, man habe sie in ihrer Kindheit gelehrt, es sei fürstliche Pflicht und Tugend, den Kummer in sich zu verzehren und den Untertanen ein helles Antlitz zu zeigen, wie die Sonne von Gott bestellt sei, der Erde Licht und Wärme zu geben, deren sie bedürfe und von sich aus nicht mächtig sei.
An hilfsbereiten Freunden blieben Jakobe indessen doch nur zwei: der Kurfürst Ernst von Köln, ihr Oheim,1 und der Landgraf von Leuchtenberg, ihrer jüngeren Schwester Mann. Zwischen dem Kurfürsten und den Jülich-Cleveschen Räten, nämlich Schenkern und seinem Anhang, schwebte schon lange eine Streitsache, indem sie mehrere Ämter, die der Kurfürst als ihm zustehend in Anspruch nahm, dem protestantischen Grafen Bentheim verkauft hatten, was ihn darin bestärkte, sie für eigenmächtige, frevelhafte und nur den eigenen Nutzen bezweckende Leute zu halten. Sie ihrerseits sagten, man sehe wohl, warum er in Jakobens Angelegenheit ihr Widersacher sei; sie hätten ihn verhindert, sich auf Kosten von Jülich-Cleve zu bereichern, wobei ihm die Herzogin wohl gern behilflich gewesen wäre.
Dem Landgrafen von Leuchtenberg hätte in früherer Zeit Jakobe besser angestanden als ihre weniger schöne Schwester, und er hatte ihr eine gewisse Anhänglichkeit bewahrt, obwohl sie nun bald vierzig Jahre alt war und die Zauberei der Jugend nicht mehr ausstrahlte. Daneben war es ihm bange, die gewalttätigen und räuberischen Räte möchten sich des Juwelenschatzes der Jakobe bemächtigen, der nicht unbeträchtlich war und der, da sie keine Kinder hatte, nach seiner Meinung ihm zufallen musste, wenn sie etwa stürbe. In Anbetracht ihrer bedenklichen, unfreien Lage hätte er es angezeigt gefunden, dass sie ihm die Kostbarkeiten gleich jetzt in Verwahrung gäbe, und suchte eine Gelegenheit, die Übergabe heimlich zu bewerkstelligen. Der Landgraf konnte diesen Zuschuss gut gebrauchen, denn er watete bis zum Halse in Schulden und war oft nahe am Ertrinken. Indessen da er von Natur munter und umgänglich und dazu meistens betrunken war, erdrückte ihn die Sorge nicht, wenn er nur so viel auftrieb, um das Leben in seiner Art weiterzufristen. Sein gemütliches Wesen machte ihn geeignet, zwischen den streitenden Parteien im Reiche zu vermitteln, und so reiste er im Auftrage des Kaisers an den Höfen umher und erfüllte fröhlich seine Pflicht, indem er bei vollem Humpen den hadernden Fürsten gütlich zuredete.
Es war Mai, als der Landgraf mit seiner Frau in Düsseldorf ankam und zu seiner Schwägerin in das Schloss gelassen zu werden begehrte. Die Wachen jedoch gaben ihm zu verstehen, dass das nicht angehe, und trotz seiner Proteste musste er am Ende zufrieden sein, in einem Wirtshause vor der Stadt Quartier zu nehmen. Unter der Hand benachrichtigte er die gefangene Herzogin, dass er da sei und nachts in einem Boote vor ihr Fenster fahren und versuchen wolle, sich von dorther mit ihr zu besprechen. Jakobe, welche wenig Unterhaltung hatte, harrte willig vom Einbruch der Dunkelheit an im Fenster und vertrieb sich die Zeit mit bunten Erinnerungen aus ihrer schönen Jugend. Endlich weckte sie ein Glucksen und Rieseln des Wassers aus ihren Träumen, worauf sie bald die Umrisse eines näher gleitenden Nachens wahrnahm und das Zeichen eines wehenden Tüchleins, das ihre Schwester bewegte, ebenso erwiderte. Freudig erkannte sie den dicken Landgrafen und ihre zierliche Schwester, breitete die Arme aus, lächelte, dankte und erzählte flüsternd, sie sei wohlauf, es fehle ihr soweit an nichts, sie habe eine bescheidene Frau zur Bedienung, erhalte gut und reichlich zu essen, auch Wein zu trinken, freilich sei sie der Gefangenschaft müde, der Landgraf solle doch auf eine Zusammenkunft dringen; wenn sie seinen Ernst sähen, würden sie nicht wagen, ihm dauernd zuwider zu sein.
Sie solle nur getrost sein und ihm vertrauen, erwiderte der Landgraf, jedermann wisse, dass er ein besonders Vertrauter des Kaisers sei; wenn es nicht anders gehe, werde er stracks nach Prag reisen und sich strenge Befehle vom Kaiser selbst holen, die ihm schon den Weg zu ihr bahnen würden. Inzwischen solle sie auf der Hut sein und sich demütig und fügsam anstellen; denn wenn ein Lamm von einem grimmigen Hunde bewacht werde, dürfe es ihm keinen Vorwand oder Anlass geben, es zu zerreißen. Jakobe schüttelte lachend den Kopf und sagte, sie sei nicht als ein Lamm, sondern als eine Fürstin geboren.
Lange wagten sie die Unterredung nicht fortzuführen, und mit nassen Augen sah Jakobe das winzige Fahrzeug verschwinden, um das herum der breite Fluss rollte und der hohe Himmel flutete und dem der Mond als eine Fackel voranschwebte.
Der Landgraf machte sein Wort wahr und fuhr schleunig nach Prag, wo er zunächst durchsetzte, dass das Endurteil des Prozesses bis auf weiteres verschoben wurde. Wie er dies nun aber dem Kurfürsten von Köln mitteilte, meinte dieser, bedenklich seine große höckerige Nase reibend, damit sei mehr geschadet als gewonnen; denn nun würde Schenkern daran verzweifeln, mit dem Prozess sein Ziel zu erreichen, und würde auf andere Mittel denken, denen niemand begegnen könne. Er habe kürzlich vernommen, fügte er hinzu, dass Schenkern einen berühmten Arzt aus England habe kommen lassen, um den Herzog zu heilen, der so schwach im Kopfe sei wie je, mit dem er aber sicherlich etwas vorhabe, sei es, dass er ihn verheiraten oder dass er nur beweisen wolle, wie gesund er sei, seit ihn Jakobe nicht mehr verzaubern könne. Es sei zu fürchten, dass die Herzogin in den Händen der Räte nicht mehr sicher sei, und es handle sich darum, ihnen das Opfer zu entreißen. Sie durch Gewalt oder List selbst zu befreien, sei ein zweifelhaftes und hochgefährliches Werk, dessen sie sich nicht unterfangen dürften; dahingegen könne man den Kaiser vielleicht dahin bringen, dass er anordne, die Herzogin solle bis zum endlichen Austrage des Prozesses einem Unparteiischen, etwa dem Landgrafen von Leuchtenberg, zur Bewachung übergeben werden.
Das, sagte der erschrockene Landgraf, getraue er sich wohl auszurichten, und machte sich wieder auf die Reise, nachdem er Jakobe Nachricht hatte zukommen lassen, sie solle getrost sein, in Bälde werde sie aus dem Elend und der Unwürdigkeit hinausgeführt werden.
Während dieser Zeit hatte Schenkern viel Arbeit und Mühe mit Jan Wilhelm, der, da er sich vor Fremden fürchtete, in der Meinung, sie könnten ihm etwas antun, von dem englischen Arzt durchaus nichts wissen wollte. Auch Sibylle und einige von den Räten meinten, dass es eine verfängliche Angelegenheit sei, bei der man schrittweise und mit wohlüberlegten Kautelen vorgehen müsse, umso mehr, als der verschriebene Engländer ein Ketzer sei. So wurde verfügt, er müsse seine Kunst zunächst an einem anderen erweisen, wozu der Sohn einer Bürgersfrau ausersehen wurde, der nach einem schweren Fall blödsinnig geworden war und allen Besprechungen, Beschwörungen und Arzneien bisher getrotzt hatte. Es zeigte sich, dass das dem Burschen verabreichte Mittel ihm gut anschlug; ja seine Mutter und andere Zeugen fanden ihn aufgeweckter, als er jemals gewesen sei. So hinderte denn nichts mehr, es mit dem Herzog gleichfalls zu versuchen, dessen angstvollen Widerstand Schenkern dadurch überwand, dass er ihm die längst versprochene schöne Frau in Aussicht stellte, wenn er sich der Kur unterzöge, die ihn vollständig wiederherstellen würde. Doch verlangte seine Furcht noch allerlei Sicherheitsmaßregeln, worin ihn Sibylle schwesterlich unterstützte, dass nämlich der Arzt selbst, Schenkern und mehrere andere Räte zuerst von der Arznei tranken, die Jan Wilhelm einnehmen sollte. Nachdem sie sich durch Gebet und das heilige Abendmahl darauf vorbereitet hatten, würgte ein jeder seinen Anteil an dem Schleim, der widerlich schmeckte, hinunter, worauf Jan Wilhelm nach Verordnung des Arztes vierundzwanzig Stunden lang, soweit möglich ohne Ruhepause, im Zimmer auf und ab gehen musste. Auch hierbei mussten mehrere Ratspersonen gegenwärtig sein, teils um die richtige Ausführung des Geschäftes zu überwachen, teils um den Kranken durch Gespräch zu zerstreuen und durch ihr Beispiel zu ermuntern.
In dieser Arbeit war Schenkern begriffen, als das Gerücht zu ihm gelangte, der Kaiser habe befohlen, dass die Herzogin dem Landgrafen von Leuchtenberg übergeben werde, und derselbe sei schon unterwegs, um die seinem Schutz Empfohlene abzuholen. Dass er dies nicht geschehen lassen dürfe, stand Schenkern sogleich fest. Um Jakobe würden sich alle scharen, die Anspruch machten, ihm die Herrschaft zu entreißen, und vielleicht würde die Rachsüchtige ihm nun ihrerseits die Schlinge eines Prozesses drehen und um den Hals werfen. Dagegen musste er eine eilige Anstalt treffen.
Jakobe lebte unterdessen fröhliche Tage. Sie träumte davon, dass sie nun bald frei und unter Freunden sein, Neues und Schönes sehen und wieder die Huldigungen genießen würde, die einer hochgeborenen, regierenden Herrin und einem schönen Weibe gebührten. Sie malte sich auch aus, dass sie ihren Gemahl wiederhaben und ihm seine Untreue vorwerfen würde, wie sich allmählich Angst und Liebessehnsucht in seinem hübschen Gesichte ausprägen, wie er weinen, sie ihm endlich vergeben und sich von ihm liebkosen lassen würde. Oder aber es würden ihr andere, viel herrlichere Männer begegnen und ihr neue, große Beseligungen geben und ihr zu ihrem Recht und ihrer Rache verhelfen. Ungeduldig indessen war sie nicht, sondern ließ, mit Beten und Sticken beschäftigt, die feuerhellen Herbsttage mit den Fluten des Rheins unter ihrem Fenster vorbeifließen, ohne sie zu wägen oder zu zählen.
So war es denn eine nachdenkliche Sache, dass die Herzogin am Morgen des 3. September 1597 von ihrer Kammerfrau, die wie üblich in ihr Gemach kam, tot im Bette gefunden wurde; denn niemand hatte Zeichen eines Übelbefindens am vorhergehenden Abend an ihr wahrgenommen. Bevor das Ereignis noch recht bekannt wurde, ließ Schenkern das Begräbnis vornehmen, hastig und schändlich, wie es sich für geringe, namenlose Leute oder Armesünder geschickt hätte. Zweifelte nun auch niemand daran, dass es bei diesem Todesfall etwas gewaltsam zugegangen sei, so hütete sich doch ein jeder, den Verdacht öffentlich zu äußern oder gar den mutmaßlichen Mörder zur Rechenschaft zu ziehen; denn ohne Beweise hätte man sich damit in eine dornige Sache eingelassen.
Damit man ihm desto weniger anhaben könne, ließ Schenkern die Spanier ins Land, die unter ihrem Feldherrn Mendoza mehrere Plätze besetzten und sich dort als rechtmäßige Herren gebärdeten. Einen Grund zu diesem unerhörten Schritt zog Schenkern daraus ab, dass er einen Plan der protestantischen Erbansprecher, sich in Besitz des Landes zu setzen, entdeckt habe und diesen habe zuvorkommen müssen. Ein Geschrei der vergewaltigten Gegend erfüllte bald das Reich, dessen Glieder denn auch zu erwägen begannen, was bei einem derartigen feindlichen Einbruch durch die Reichsgesetze vorgesehen sei. Diese nun legten die Pflicht, den Feind abzuwehren, dem nächstgelegenen Kreise auf, welches in diesem Falle der westfälische war, und derselbe setzte sich demgemäß in Beratung, wie das Kreisheer und das Geld, es zu besolden, zusammenzubringen sei. Da jedoch mehrere Monate darüber verliefen, während welcher die Spanier nach ihrer Weise Stadt und Land verwüsteten, traten einige Fürsten zusammen, um etwa von sich aus der feindlichen Eigenmacht zu steuern, die dem Reich zur Unehre gereiche und ihnen gefährlich sei. Es waren dies der Landgraf Moritz von Hessen, der Herzog Heinrich Julius von Braunschweig und der Pfalzgraf Kurfürst Friedrich IV., deren Länder dem Herzogtum Jülich nahe lagen und die überhaupt gewohnt waren, bei allen vorkommenden Reichshändeln Partei zu ergreifen.
Pfalzgraf Friedrich IV. fühlte sich für seine Person nicht anders wohl als bei den fürstlichen Unterhaltungen der Jagden, Turniere und Trinkgelage; aber er war sich bewusst, der Träger eines ruhmvollen Namens und Erbe von Fürsten zu sein, die sich durch kampfbereites Einstehen für ihre religiöse Überzeugung angesehen und gefürchtet gemacht hatten, und hielt darauf, die Überlieferungen seines Hauses fortzusetzen. Die blühende Pfalz sollte die Vormacht und Stütze der Reformierten im Reiche und eigentlich der Evangelischen überhaupt bleiben, da Sachsen anfing, eine träge und zweideutige Politik zu befolgen, um es mit dem Kaiser nicht zu verderben. Deshalb umgab sich Friedrich IV. mit reformierten Räten, die an seiner Statt unternehmend, ehrliebend und fleißig waren, hing ihnen dankbar an und unterwarf sich ihnen in allen Stücken, mit der Einschränkung, dass er sich ihrer unbequemen Herrschaft nicht selten entzog, um an befreundeten Höfen beim vollen Becher sich ihrer Ratschläge und Grundsätze gänzlich zu entschlagen. Auch seine Gemahlin, die Oranierin Luise Juliane, deren Herkunft die Verbindung mit ihr zum Zeichen für kühne, kampfbereite reformierte Sinnesart machte, hatte er wegen ihrer Bildung, ihres beherrschten Wesens und tüchtigen Charakters anfänglich geliebt und verehrt; auf die Dauer aber vermochte er ihre Überlegenheit, da sie eine Frau war, nicht zu ertragen und zeigte ihr die seinige durch rohe Behandlung, die sie mit Geduld und Würde ertrug; diese Art und Weise schien ihm aber Verachtung auszudrücken und gab daher seiner Erbitterung stets neuen Stoff.
Anders geartet war Landgraf Moritz von Hessen, ein schlanker, stattlicher, überaus tätiger und kluger Mann, von einer gewissen Feinheit und Ehrlichkeit des Denkens, sodass er, wie er selbst durch Unrat und Unordnung gestört wurde und sich stets gedrängt fühlte, in dunkle Winkel hineinzuleuchten, überall unbequem empfunden wurde, wo schmutzige oder stumpfsinnige Behaglichkeit waltete. Er war seit dem Jahre 1593 mit Agnes aus dem gräflichen Hause Solms-Laubach verheiratet, die wegen ihrer Schönheit mit der Göttin Venus verglichen wurde und diese Gabe den Kindern vererbte, die sie ihm gebar.
Dagegen hielt der Herzog von Braunschweig am Alten fest, aber wie der Landgraf war er dem Müßiggang feind und dazu von so ausgezeichneter Gesundheit, dass das Trinken ihn nicht vom lebhaften Betrieb und vielfacher Tätigkeit abhielt. Diese beiden Herren gerieten leicht aneinander, weil ein Streit zwischen ihnen schwebte, indem der Herzog auf mehrere Ämter Anspruch erhob, die der Landgraf als sein Eigentum ansah und stets angesehen hatte und in deren Besitz er sich, rechtlicher Entscheidung vorgreifend, gewaltsam gesetzt hatte. Davon abgesehen, reizten den Landgrafen des Herzogs breite Gemütlichkeit, sein selbstgefälliges Behagen, seine altväterischen Sitten und die Langsamkeit seines Verstandes; den Herzog dagegen ärgerte das neuerungssüchtige Wesen des Landgrafen, das er unfürstlich fand, seine Redefertigkeit und Überlegenheit, wie er denn das Gefühl hatte, als schlage der Landgraf seine, des Herzogs, weltberühmte Gelehrsamkeit gering an. Allerdings dachte der Landgraf diesbezüglich, der Herzog sei ein Fass voll Sauerkraut, es sei wohl viel darin, aber geringe, grobe Nahrung. In der Politik war Herzog Heinrich im Grunde der Meinung, die Dinge wären gut, wie sie eben wären, und das alte Römische Reich, wie es nun einmal sei, dürfe durchaus nicht angetastet werden; da er aber darauf erpicht war, die Stadt Braunschweig, die sich als Reichsstadt gebärdete, sich untertänig zu machen, und der Kaiser in diesem Zwist kürzlich gegen ihn und zugunsten der Stadt entschieden hatte, schloss er sich mit zähem Nachdruck den Fürsten an, die es antikaiserlich trieben.
Bevor es zu einer gemeinsamen Beratschlagung kommen konnte, musste der zwischen dem Landgrafen und dem Herzog schwebende Streit wegen der Ämter in etwas beigelegt werden, was der Pfalzgraf über sich nahm; dann traten die Herren der Sache näher unter einer starken Rede des Herzogs Heinrich Julius, wie schimpflich der spanische Einfall für das Reich sei. Wenn es nicht Spanien wäre, meinte Hessen, würde der Kaiser sich eher rühren, wie träge er auch sei. Nun, man müsse eben selbst handeln, sagte Heinrich Julius, und da sie einmal so weit einig wären, solle das Unwesen bald ein Ende nehmen. Als es daran ging, das Heer zusammenzubringen, das die Spanier vertreiben sollte, zeigten sich jedoch vielerlei Schwierigkeiten in Bezug auf die Anzahl der Truppen und wie sie auf jeden zu verteilen wären; denn es wollte jeder so wenig wie möglich besolden. Am Ende, meinte Moritz von Hessen, könne man sich so helfen, dass man es den Holländern überlasse, die Spanier zu vertreiben, und sie nur mit Geld dabei unterstütze. Die Holländer hätten sowieso Soldaten auf den Beinen und hätten ebenso viel Interesse daran wie das Reich selbst, dass die Spanier sich nicht im Cleveschen festsetzten. Was? rief der Herzog von Braunschweig entrüstet, mit den Holländern wolle man gemeine Sache machen und ihnen gar noch Dank schuldig werden? Mit den Rebellen und Trotzköpfen, die es den Fürsten gleichtun wollten? Lieber wolle er spanisch oder türkisch werden, und es solle keiner mehr mit einem solchen Vorschlag seiner fürstlichen Ehre zu nahe treten. Dies war eine besondere Kränkung für Moritz von Hessen, der mit den holländischen Staaten in einem freundschaftlichen Verhältnis stand, so viel wie möglich Holländer nach Hessen zu ziehen und die dort herrschende Blüte an Kunst und Gewerbe in sein Land zu verpflanzen suchte.
Nach Verlauf einiger Wochen, während welcher die Spanier ernstlich verwarnt worden waren, sich aus dem Reich zurückzuziehen, einigte man sich über die Zahl der zu werbenden Truppen; nun aber erklärte Christian von Anhalt, er wolle den Oberbefehl, worauf man sich doch verlassen hatte, nicht übernehmen. An seinem Mut und guten Willen werde man nicht zweifeln, sagte Anhalt, es sei ja bekannt, unter welchen Schwierigkeiten er seinerzeit dem König von Frankreich zu Hilfe gekommen sei; aber seine Ehre sei ihm zu lieb, als dass er sie bei einer zweifelhaften Sache aufs Spiel setzen möchte. Er habe von Anfang an gesagt, dass man mehr Mittel an das Unternehmen wenden müsse, wenn etwas dabei herauskommen solle, und wenn man nicht auf ihn höre, wolle er auch keine Rolle dabei spielen.
Zwar verdachten die Fürsten dem Anhalter dessen Entschluss, aber er brachte Moritz von Hessen auf den Gedanken, dass er an seiner Stelle das Amt des Feldherrn übernehmen und auf diesem Felde Lorbeeren gewinnen könne. Es bemächtigte sich seiner bei der Vorstellung eine gewisse Unruhe, und er wusste selbst kaum, ob seine Lust oder seine Bedenken größer wären. Gefahren und Strapazen fürchtete er nicht; und doch fühlte er sich des Erfolges nicht so sicher, wie wenn er ein mathematisches Problem hätte lösen oder eine theologische Disputation hätte halten sollen. Indessen gerade diese Unsicherheit spornte ihn an; es war ihm, als ob jeder die Zweifel hege, die in ihm selbst aufstiegen, und als müsse er sie durch die Tat entkräften.
Kaum war Landgraf Moritz mit seinem Anerbieten hervorgetreten, als der Herzog von Braunschweig erklärte, er habe sich bereits zum Direktorium des Krieges entschlossen und wolle nun nicht davon zurücktreten. Er dachte bei sich, es sei ein lächerlicher Anspruch von Moritz, der doch nur ein Maulheld sei, den Feldherrn spielen zu wollen, während der Landgraf fand, nachdem Heinrich Julius erst kürzlich vor Braunschweig abgeblitzt sei, täte er besser, hinter seinem Bierkrug sitzen zu bleiben. Hierüber zerschlug sich der Feldzug der verbündeten Fürsten; die Truppen, die sie schon geworben hatten, übernahmen die benachbarten Kreise; da diese aber kein Geld hatten, sie ordentlich auszurüsten und zu unterhalten, verlief sich das Heer, bevor etwas Eigentliches unternommen war, und die Festung Orsau blieb einstweilen im Besitze der Spanier.
1 Onkel <<<