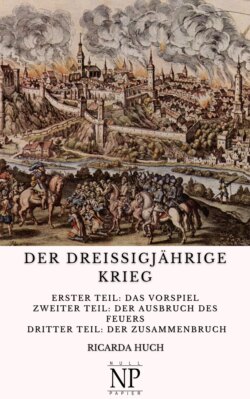Читать книгу Der Dreißigjährige Krieg - Ricarda Huch - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5.
ОглавлениеAm pfälzischen Hofe war man der Meinung, dass die Katholiken zu einem großen Schlage ausholten, um die Protestanten zu vernichten; dafür sprachen allerlei bedenkliche Zeichen. Schon im Jahre 1601 war ein Reisender durch Heidelberg gekommen, der sich Brocardo Baronio nannte und ein Italiener zu sein vorgab, der zum protestantischen Glauben übergetreten sei und deshalb verfolgt werde, und da er sich ansehnlich und wohlredend zeigte, hatte man ihn im Schlosse empfangen. Dieser hatte allerlei hässliche Eröffnungen gemacht, wie dass eine Verschwörung unter den Katholiken bestehe mit dem Papst an der Spitze, dass eine ungeheure europäische Bartholomäusnacht vorbereitet und ein unauslöschlicher Blutstrom sich durch alle Länder ergießen werde. Die Schrift ›De autonomia‹, die von der Notwendigkeit, die Ketzer auszurotten, handelte, weil es nur eine Wahrheit gebe, und diese sei bei den Katholiken, bewies, wie sicher die Feinde sich fühlten. Denn wie hätten so unumwundene Gesinnungen und Drohungen sonst gedruckt und veröffentlicht werden können? Den Räten, Lingelsheim, Loefenius, Schug, Camerarius, stieg das Blut heiß zum Kopfe, wenn sie sich vorstellten, in welcher Verfassung diese Gefahren die protestantische Partei antrafen. Während das Heer der Jesuiten und Kapuziner in zahllosen Wellen, Rinnsalen und Bächen zusammenfloss und mit einem Male alles Land überschwemmen konnte, blieben die Protestanten vereinzelt, untereinander entzweit, kaum auf Verteidigung bedacht, geschweige denn, dass sie den Angriff wagen könnten. Soeben kam Loefenius von Stuttgart zurück, wo eine Vermählung stattgefunden hatte, zu der der Kurfürst geladen war, was man hatte benutzen wollen, um eine Vereinigung mit dem Herzog von Württemberg zu erzielen und dadurch die Grundlage zu einer weiteren Union zu gewinnen. In Lingelsheims Bibliothek berichtete er seinen Kollegen von dem Misserfolg seiner Sendung. Ihr Herr sei entweder auf der Jagd oder bei Tafel gewesen oder habe seinen Rausch ausgeschlafen. Einmal habe er ihn allein gesprochen, da habe er geweint, weil er wegen der Gliederschmerzen am letzten Turnier nicht habe teilnehmen können. Es sei aus mit ihm, er könne nie mehr gesund werden, er, Loefenius, solle ihn trinken lassen, damit er sein Unglück vergäße; Geschäfte habe er das ganze Jahr, diese wenigen Tage sollte Loefenius ihm nicht vergällen.
»Die schwerste aller Lasten ist ein leichter Kopf«, sagte Lingelsheim in lateinischer Sprache, »das gilt für den einzelnen wie für den Staat.« Ob denn Loefenius nichts mit den Räten des Herzogs habe ausrichten können? Außer dem Enslin, sagte Loefenius, sei keiner, der ein klares Wort zu reden sich getraue, und Enslin sei ihm absichtlich ausgewichen. Er habe gehört, dass Enslin daran arbeite, die Lehensrechte, die Österreich über Württemberg habe, abzulösen, und dass er sich deshalb den Kaiser geneigt erhalten wollte. Bis das erledigt sei, werde Württemberg dem Kaiser in allen Dingen nachgeben und sich auf nichts Verdächtiges einlassen. Jammervoll sei es, wie am Hofe gehaust werde, in einem Freudenhause könne es nicht ärger zugehen. Mehr als fünfhundert Personen zähle der Hofstaat, und die Tafel sei immer voll gedeckt. Der Herzog wolle durchaus eine stattliche Hofhaltung führen, obwohl doch wenig Adel im Württembergischen vorhanden sei und das Land gedeihen könnte, wenn es nicht absichtlich verderbt würde. Geld fließe wie Wasser, und um es sich zu verschaffen, ließe der Herzog Goldmacher kommen und stecke ihnen Tausende von Talern in die Tasche, bevor eine Erbse groß Gold aus ihrem Tiegel komme. Schlau genug sei der Herzog, aber er kümmere sich nur noch darum, etwas ins Bett und in den Beutel zu bekommen, und der Enslin könne und wolle nicht über Württemberg hinausdenken.
Indessen hatte der Großhofmeister, Graf Solms, seine Not mit dem Kurfürsten, der, übellaunig von der Reise zurückkehrend, auf seine Gemahlin schimpfte, weil sie ihm nicht entgegengekommen sei, und in ihre Gemächer dringen wollte, um sie zur Rede zu stellen. Er sei eben nicht in dem Zustande, der hohen Frau aufzuwarten, sagte Graf Solms ernst; er habe getrunken und sei nicht Meister über seine Zunge. »Desto mehr über meine Faust«, stammelte der Kurfürst und rollte die Augen.
Wenn er ihn verhindern könne, seine edle Gemahlin zu beleidigen, so wolle er Leib und Leben daransetzen, sowohl ihretwegen wie seinetwegen.
»Warum verbirgt sie sich denn wie ein Weib, das seinem Eheherrn übelgesinnt ist?« schrie der Kurfürst. »Hätte sie mich geliebt, wie es sich gebührt, so hätte sie einen guten Mann an mir gefunden. Willst du leugnen, dass ich ein gutherziger, nachgiebiger Mensch bin? Ich will doch sehen, ob ich ihren Stolz und Trotz nicht beugen kann! ob sie mit ihrem Latein und Französisch einen Ausweg vor meinen Fäusten findet!«
Der Graf stemmte sich gegen die Tür und sagte ruhig: »Der Leib Eures Dieners ist Euer Schild, er schützt Euch gegen Tod und gegen Schande.« Diese Worte und der vorwurfsvolle Blick des Grafen wendeten Friedrichs Sinn augenblicklich; er warf sich, in Tränen ausbrechend, an seine Brust und rief: »O mein Herz, mein treuester Johannes, ich tötete ja mich selbst in dir! Verlass mich nicht! Denn was wäre ich ohne dich! Was habe ich dir getan, dass du mir die kaltherzige, ungehorsame Frau vorziehst und mich um ihretwillen deiner Liebe beraubst?«
»Weil ich Euch liebe«, sagte Solms traurig, »will ich nicht, dass Ihr eine hohe Dame beleidigt, die Ihr vielmehr beschützen solltet«, und fuhr fort, ihm in dieser Weise zuzusprechen, worüber er schläfrig wurde und zu Bett gebracht werden konnte.
Bei wiedererlangter Nüchternheit pflegte der Pfalzgraf Anwandlungen von Reue über die verübten Exzesse zu haben, besonders seit er dem vom Landgrafen Moritz bei Gelegenheit eines Familienfestes in Heidelberg gegründeten Mäßigkeitsorden beigetreten war. Moritz hatte es damals ärgerlich empfunden, dass der Stumpfsinn der Betrunkenen nicht die Art der Unterhaltung aufkommen ließ, die er liebte, und hatte den Vorschlag gemacht, man solle sich eine gewisse Beschränkung im Essen und Trinken auferlegen und zu diesem Zweck einen Verein stiften. Der Mensch sei zum Ebenbilde Gottes, nicht zum Ebenbilde von Affen und Schweinen geschaffen, denen er im Rausch ähnlich werde.
Es sei gar zu anstrengend, Mensch zu sein, sagte der Herzog von Württemberg, man müsse sich von Zeit zu Zeit in der Säuerei davon erholen. – So? sagte Moritz höhnisch, das sei je nachdem: ein Vierfüßler könne nicht lange aufrecht gehen, ihm würde es Mühe machen, auf allen vieren zu laufen. Gott habe den Menschen ja ein Bad der Erquickung gerichtet in der Betrachtung seiner Vollkommenheit und in der Erforschung der Weltwunder. Da der Mensch aus Gottes Geist geschaffen sei, könne ihm auch nur durch den Geist Leben zufließen. Freilich müsse man essen und trinken, um den Körper zu erhalten, mit dem der Geist verbunden sei; aber wenn man zu viel Holz in den Ofen schiebe, so ersticke das Feuer, um dessentwillen doch nur geheizt werde. Die Fürsten sollten dessen vor allen Dingen eingedenk sein, die ihren Untertanen ein Vorbild aufstellen sollten. Sie als christliche Fürsten möchten auch nicht einen Baal oder Moloch anbeten, der im eisernen Bauch Kinder verbrenne und sich mit Opferblut begießen lasse; so könnten sie auch christlichen Völkern nicht zumuten, Herren zu dienen, die im Sumpf der Völlerei heimisch wären. Wenn sie ihren Untertanen nicht das Beispiel eines edleren Lebens geben könnten, wozu wären sie dann da? Hätte Gott sie eingesetzt, damit sie sich desto besser besaufen könnten? Ein Fürst stehe auf beleuchteter Höhe, und sein Wandel müsse so sein, dass jeder ihn mit Lust betrachten und sich danach bilden könne.
Von solchen und ähnlichen Reden des Landgrafen Moritz wurde der Pfalzgraf endlich so erschüttert, dass er zu weinen anfing, dem Landgrafen um den Hals fiel und ihm sagte, er habe sein Gewissen geweckt, es sei alles wahr und richtig, er, der Pfalzgraf, wolle nun vom Saufen lassen und ein fürstliches Leben führen, damit die evangelische Wahrheit durch ihn offenbar werde. Es wurde demnach zur Einrichtung des Ordens geschritten, wonach niemand bei einer Mahlzeit mehr als sieben Becher Wein trinken durfte; zu einem kleineren Maße wollte der Herzog von Württemberg, der aber hernach wieder austrat, sich nicht verstehen, da er meinte, Gott könne es nicht darauf abgesehen haben, die Fürsten und Herren verschmachten zu lassen. Außer dem Landgrafen Moritz und dem Pfalzgrafen traten dem Orden bei der Landgraf Ludwig von Hessen-Darmstadt, Moritzens Vetter, der Markgraf von Jägerndorf und einige Grafen von Nassau, Solms, Erbach und Leiningen.
Als Erfolg und Zuwachs wurde es in Heidelberg begrüßt, dass Landgraf Moritz von Hessen im Jahre 1603 den reformierten Glauben annahm. Auf einer Reise durch die Schweiz und Frankreich hatte er die Einrichtungen der reformierten Kirche durch eigene Anschauung und ihre Leiter persönlich kennengelernt und einen Eindruck davon gewonnen, der seine schon bestehende Neigung verstärkte. In Basel, Zürich und Genf fand er Friedfertigkeit, Ordnung und Tüchtigkeit, sah er alle Kräfte des Gemeinwesens gesammelt, um eine harmonische Erscheinung hervorzubringen. Die Geistlichen, mit denen er sich unterhielt, schwärmten nicht in Geheimnissen, die sie allein besitzen wollten, vielmehr suchten sie die göttliche Vernunft allen zu entschleiern. Es schien ihm, als hätten die Menschen dort klarere und festere Gedanken, gesundere, regelmäßiger schlagende Herzen, und Ungeduld ergriff ihn, einen ähnlichen Zustand nach Deutschland, wenigstens nach dem ihm untergebenen Hessen zu verpflanzen. Den König von Frankreich, Heinrich IV., betrachtete er als noch der reformierten Religion zugehörig, soweit er ihn bewunderte; seine Fehler, die Ausschweifungen, die Liederlichkeit seines Ehelebens und allerlei Zweideutigkeiten und Unregelmäßigkeiten schrieb er seinem Zusammenhange mit der katholischen Kirche zu. Er war überzeugt, dass Heinrich IV. sich im Herzen mit den Bekennern seines alten Glaubens einig fühlte, die auf der Seite seines guten Genius ständen, und sie in etwaigen Kämpfen und Nöten unterstützen würde. Dazu kam, dass seine zweite Frau – denn die zarte Agnes war nach neunjähriger Ehe gestorben –, die sechzehnjährige, kluge Juliane, eine Oranierin war, reformierten Glaubens, eine Vertreterin des Geschlechtes, dessen Namen ein Meerhauch von Kraft und Freiheit umwitterte.
Mit einigen ergebenen Geistlichen arbeitete Moritz selbst die neue Verordnung aus, nach welcher vornehmlich die Änderung stattfand, dass alle Bilder aus der Kirche entfernt und beim Abendmahl das Brot zum Gedächtnis Jesu gebrochen und an die Gemeinde ausgeteilt werden sollte. Eines Sonntags trug ein Prediger in der Kasseler Hofkirche in einer größtenteils von Moritz selbst verfertigten Rede alle Gründe vor, die den Landgrafen zu der neuen Ordnung geführt hätten, forderte das Volk auf, sich damit bekannt zu machen, sie zu prüfen und etwaige Zweifel dem Landesherrn selbst vorzutragen, der bereit sei, jedem seiner Untertanen Antwort zu geben. Moritz war mit seiner Familie anwesend und folgte dem Vortrage aufmerksam und etwas ungeduldig; er hätte selbst zur Gemeinde gesprochen, wenn er es nicht für ziemlich gehalten hätte, an dem dem Gottesdienst geweihten Orte hinter dem dazu bestellten Geistlichen zurückzustehen. Seine hohe, elastisch aufrecht gehaltene Gestalt und sein Blick voll geistigen Feuers beherrschte die Zuhörer, sodass er den Eindruck gewinnen konnte, die Ausführungen seines Pastors hätten jedermann überzeugt.
Vor der Kirche blieb er im Gespräch mit seiner Frau und seiner ältesten Tochter aus erster Ehe stehen und sah freundlich in die Runde, um diejenigen zu ermutigen, die etwa eine Frage stellen möchten. Als er einige bemerkte, die sich nähern zu wollen schienen, winkte er mit der Hand und forderte den nächsten auf, sich ohne Scheu zu erklären. Der Mann, ein Buchdrucker, sagte unter vielen Bücklingen, dass er belehrt zu werden wünsche, warum es denn sträflich sei, sich an Bildern zu erbauen, wofern man sie nicht anbete, was ein evangelischer Christ doch ohnehin nicht tue. Offenbar erfreut, dass er Gelegenheit bekam, seine Ansichten zu erörtern, sagte Moritz lebhaft und mit lauter Stimme: »Möge sich ein jeder an Bildern erfreuen, wenn sie gut gemalt sind und etwas Gutes darstellen; aber nicht in der Kirche und beim Gottesdienste, denn ein anderes ist die Kunst und ein anderes die Religion. Wir sind schwache Menschen und wider unser Wissen und Wollen geneigt, das Bild für das Wesen zu halten. Es steht geschrieben: ›Gott ist Geist, und die ihn anbeten, sollen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten.‹ Das ist wohl zu begreifen, aber schwer ist es, danach zu leben. Wer möchte nicht vor bunten Bildern träumen und Gebete lallen? Wir sollen aber das Herz rein halten, die Gedanken hoch richten und nach Gottes Geboten tun.«
Der Mann wagte diesen entschieden gesprochenen Worten keins entgegenzusetzen; auch blickte der Landgraf schon auf einen anderen, einen alten Mann bäuerischen Ansehens, der, aufgefordert zu sprechen, mit verlegenem Lächeln sagte: »Der Herr Landgraf wird alles am besten wissen; aber unser Herr Pfarrer hat gesagt, wie der Luther das Abendmahl eingesetzt habe, so sei es gut, und dabei solle es sein Verbleiben haben.«
Diese Worte schienen den Landgrafen zu ärgern, aber er zwang sich, gelassen zu bleiben, und erwiderte: »Nun, mein Sohn, so vernimm meine Meinung gegen die deines Pfarrers. Gottes Allmacht kann Wunder tun, wenn er will, und ein Wunder ist es, dass ein im Fleische Geborener ohne Sünde war; aber Brot, das wir als Brot gebacken haben, bleibt Brot, denn Gott treibt keinen Schabernack mit uns. Glaubst du, er würde den himmlischen Leib seines Sohnes durch deinen schmutzigen Bauch gehen lassen? Wir sollen die Worte Gottes nicht nach unserer lockeren, schelmischen Fantasie auslegen, sondern sie so annehmen, wie er sie vor unseren Sinnen und unserem denkenden Geiste ausgebreitet hat.«
Damit ließ er den Bauern, der fortfuhr, dreist oder verlegen zu lächeln, stehen und entfernte sich mit so schnellen Schritten, dass ihm Frau und Kinder kaum folgen konnten. Der Anblick eines Elefanten, den ein fremdartig orientalisch gekleideter Mann, die Trommel schlagend, eben auf den freien Platz vor dem Schlosse führte, stellte seine Laune sofort völlig wieder her. Er ließ den Mann durch einen Diener in den Schlosshof holen und rief selbst seine Tochter, seine ältesten Söhne und deren Hofmeister, den Züricher Grob, herbei, um ihnen das fabelhafte Tier zu zeigen. Die Mittagssonne überstrahlte den steingrauen Koloß, auf dessen gewölbtem Rücken ein kleiner Affe saß und an einem Apfel knabberte. Zuerst ließ sich der Landgraf von seinen Kindern die deutschen und lateinischen Namen sowie die Heimat der Tiere sagen, und nachdem er befriedigende Antwort erhalten hatte, forderte er Grob auf, sie nach seinem Wissen weiter über den Elefanten zu belehren, worauf dieser einige Beispiele von seiner Klugheit gab und über Nutzen und Verwendbarkeit des Elfenbeins berichtete. In Nürnberg allein würden jährlich viele tausend Pfund durch geschickte Kammacher, Drechsler und Bildhauer verarbeitet. Auch das Äfflein, fügte er schmunzelnd hinzu, sei nicht durchaus zu verschmähen, wenigstens behaupteten einige Reisende und Kuriositätensammler, dass sich in seinem Leibe zuweilen ein köstlicher Stein, der Bezoar simiarum oder Affenstein, finde, den die Apotheker teuer verkauften. Wie der Elefant auf ein Zeichen seines Herrn die Knie bog, gleichsam als ob er eine Reverenz vor dem Landgrafen mache, sagte dieser lebhaft, nun sehe man, wie unwahr es sei, was viele behaupteten, dass der Elefant keine Gelenke in den Beinen habe; er hoffe, es werde sich ein Gelehrter in Gießen oder Marburg finden, der etwas Gründliches darüber schreibe, damit nicht Märchen statt Naturwissenschaft verbreitet würden. Gleichzeitig winkte er mehreren jungen Leuten von Adel, die auf dem Schlosshofe spielten, und fragte, als sie misstrauisch näher kamen, den einen von ihnen, ob er wisse, wie dies Tier heiße und woher es komme. Der Junge schüttelte verdrossen den Kopf, und auch die übrigen, die hinter ihm standen, schwiegen. Ob er wisse, wodurch sich der Mensch vom Tier unterscheide? Ob er wisse, zu welchem Zweck man die Natur und ihre Eigenschaffen studiere? Ob er wisse, wozu man überhaupt etwas lerne? fragte der Landgraf schnell hintereinander, wobei er spöttisch lachte, sodass seine langen, gelben, etwas schief stehenden Zähne sichtbar wurden. Anstatt aller Antwort warf der junge Mensch einen feindselig tückischen Blick auf Moritz, der eben den Führer durch Zeichen aufforderte, er möchte den Elefanten knien lassen, damit sie aufsitzen könnten. Ober er nicht Lust hätte, einen Ritt zu tun? fragte er dann den Jungen; er wisse ja gut mit Pferden umzugehen, so solle er wenigstens diese einzige Kunst, deren er mächtig sei, zeigen. Dieser erschrak und machte Miene davonzulaufen, als plötzlich der Affe mit seinem angefressenen Apfel nach ihm zielte und ihn gerade auf die Backe traf. Während der Landgraf und der Hofmeister in helles Gelächter ausbrachen, heulte der Getroffene, das sei der Teufel, der Teufel habe ihm den Hals umgedreht, er wolle es seinem Vater sagen, er sei verloren, und mehr dergleichen. Wieder ernst werdend, gebot ihm der Landgraf Schweigen und hielt eine Ansprache über die Unwissenheit und ihre Folgen, Aberglauben und Furchtsamkeit und dass gerade der adelige Stand, der über die anderen zu herrschen sich anmaße, diesen Vorzug durch Bildung zu verdienen suchen müsse. Es sei jetzt meistens so, dass ein gemeiner Bürgerknabe die Söhne der Adligen belehren könne, das müsse anders werden, angeborene Würde tauge nur, wenn sie durch Tugend und Wissen besiegelt werde.
Nachdem er geendet hatte, wandte er sich wieder an seine Kinder und forderte sie auf, den Elefantenführer aus ihrem Taschengeld zu beschenken, tadelte den Erstgeborenen, Otto, der das seinige bereits für seidene Strümpfe ausgegeben hatte, und umarmte die zarte Elisabeth, die reichlich geben konnte. Der Mann wurde samt seinen Tieren aus der fürstlichen Küche gut bewirtet und dem Gesinde gestattet, die Fremdlinge in Augenschein zu nehmen.
Am nächsten Sonntag zeigte es sich, dass eine größere Abneigung gegen die reformierte Ordnung bestand, als der Landgraf gemeint hatte; denn während er auf einer kleinen Reise abwesend war, brach in der Hofkirche beim Gottesdienst ein Tumult aus, dem beinahe die amtierenden Geistlichen zum Opfer gefallen wären. Dies war für Moritz umso peinlicher, als er es grundsätzlich missbilligte, in Angelegenheiten des Glaubens die Untertanen zu zwingen, und doch im Dienste der Wahrheit und Ordnung vorwärtskommen wollte. Vorzüglich erbitterte ihn der allgemeine Widerstand der Ritterschaft, von der er am ehesten erwartet hatte, sie würde ohne Weiterungen seinem Beispiel folgen als die dem Throne am nächsten Stehenden und ihm am meisten Verpflichteten.
Indessen entmutigten ihn solche Erfahrungen nicht, sondern regten ihn an, seine Tätigkeit zu verdoppeln. Stets sah man den unermüdlichen Mann beschäftigt: in der von ihm gegründeten Ritterschule, wo er die Aufsätze der Schüler verbesserte und besprach, im Gespräch oder Briefwechsel mit Gelehrten aller Art, auf der Reise in den verschiedenen Teilen seines Landes oder an den Höfen glaubensverwandter Fürsten, um sie zur Wachsamkeit anzuspornen. Die Aufmerksamkeit auf das nahe Jülich gerichtet, mahnte er die Ansprecher, welche hauptsächlich in Betracht kamen, sich über das schöne Erbe nicht zu verfeinden, sondern sich zu gemeinsamer Besitzergreifung zu verbinden, damit nicht ein Dritter zum Schaden des evangelischen Glaubens es an sich reiße. Einstweilen verpflichteten er und Kurpfalz sich, Brandenburgs gerechten Anspruch zu unterstützen; schwieriger war es, mit dem alten Herzog von Pfalz-Neuburg ins reine zu kommen.
In dem stattlichen Schlosse zu Neuburg an der Donau waltete dieser lutherische Fürst ehrbar und bedächtig, den Welthändeln im ganzen abgeneigt und der reichen Erbschaft, die ihm durch seine Jülich-Clevesche Gemahlin zufallen sollte, mit ebenso viel Misstrauen wie Begehrlichkeit entgegensehend. Da sein Ländchen ihm nur eine geringe Summe an jährlichen Einkünften abwarf, hätte er die rheinischen Lande mit ihren gewerbfleißigen Städten gut gebrauchen können; doch beängstigten ihn die Verwicklungen, die der Besitzergreifung vermutlich vorausgehen mussten und die auszufechten seine Macht allein nicht ausreichte. Von seinen drei Söhnen war der älteste ihm am meisten ungleich, ein hübscher junger Mann, der den Frauen gefiel, sowohl durch seine Beredsamkeit wie durch das verhaltene Selbstbewusstsein, das seine Erscheinung königlich umgab. Dessen Meinung war, dass man guttue, sich beizeiten nach wirksamer Hilfe in Bezug auf Jülich umzusehen und sich deshalb mit Brandenburg und Kurpfalz in Verhandlungen einzulassen, während Herzog Philipp, sein Vater, mit den Reformierten nichts zu tun haben wollte. Er nannte sie Abtrünnige, deren Selbstüberhebung und Unabhängigkeitsgelüste etwas Teuflisches wären und die man ebenso bekämpfen müsse wie den Gräuel des Papismus.
Sein Vater habe zwar recht, sagte dagegen Wolfgang Wilhelm, doch müsse man die Politik vom Kirchlichen abtrennen. Sei Jülich erst einmal in seinen Händen, werde er natürlich das Luthertum dort einführen. Was schade es, wenn Reformierte zu diesem Zweck beitrügen? Heftig und entschieden auf seinem Willen zu bestehen, war indessen seine Art nicht, nur gelegentlich ließ er Eltern und Brüder etwas von seinen Wünschen und Plänen merken. Die Brüder waren zu bescheidener Unterordnung unter den ältesten erzogen; doch ertappte sich der zweite, August, zuweilen auf einem Gefühl des Misstrauens, ja der Abneigung gegen ihn, das er im Bewusstsein seiner Sündigkeit zu bekämpfen suchte. Johann Friedrich dagegen, der viel jünger war, sah in Wolfgang Wilhelm die Verkörperung des Edlen, der Schönheit und Liebe, und er dachte nicht ohne seliges Beben an den Augenblick, wo es ihm gelungen war, seine wohlgeformte weiße Hand zu küssen, als sie sich gerade schön gebogen auf einer karminroten Damastdecke ausbreitete.
Meistens beschäftigten sich Wolfgang Wilhelms Träume mit seinem künftigen Reich am Rheine; denn Neuburg hielt er für etwas Ungenügendes und Vorläufiges. Es wurmte ihn, dass er die Erbschaft mit Brandenburg teilen sollte, und da es ihm schwer möglich schien, den mächtigeren Fürsten ganz zu verdrängen, malte er sich aus, wie er sich durch Heirat mit einer brandenburgischen Prinzessin zum Herrn des Ganzen machen könne. Um seinen Vater mit der Heirat auszusöhnen, würde er sie zu seinem Glauben bekehren, was er sowieso für notwendig zum ehelichen Glücke hielt. Er beschloss, sich ihr Bild zu verschaffen, und suchte eine Gelegenheit, sie zu sehen; denn ohne Liebe wollte er nun einmal keine Ehe eingehen. Für alle Fälle schien es ihm gut, sich auch andere Fürsten warm zu halten, und da kam unter den Verwandten der Herzog Maximilian von Bayern in Betracht als derjenige, dessen Freundschaft am meisten nützen, wie seine Feindschaft am meisten schaden konnte. Dieser Einsicht verschloss sich Herzog Philipp Ludwig nicht; doch schien ihm in dem Verkehr seines Sohnes mit dem erzkatholischen Vetter etwas Hochbedenkliches zu liegen. Er hatte darüber mit seinem Vertrauten, dem Hofprediger Heilbrunner, eine lange Unterredung, in der er sagte, sie hätten nun gottlob in seinem Lande den Irrglauben vollständig ausgerottet, die Saat des Lutherischen Wortes sei herrlich aufgegangen, sodass Gottesfurcht und gute Sitte bei den Untertanen herrsche, soweit es die menschliche Schwachheit zulasse. Ob er nicht ein gefährliches Beispiel gebe, wenn er seinem ältesten Sohn erlaube, sich da, wo des Teufels Unkraut am üppigsten wuchere, vertraulich umzutreiben, das Gift, das die alte Hure von sich gebe, einzuatmen, wohl gar abergläubischen und gottesschänderischen Gebräuchen scheinbar beifällig beizuwohnen? Ob er das vor seinem Gott verantworten dürfe?
Das sei alles nur zu wahr, antwortete sorgenvoll der Prediger; doch müsse der Herzog auch bedenken, zu welcher Glaubensfestigkeit sein Sohn erzogen sei und wie man nicht zu fürchten brauche, dass der Antichrist etwas über ihn gewinne, wie er vielmehr auf die Verstocktheit der Glaubensfeinde wirken könne, und dass der Mensch den feingesponnenen Plänen des Herrn nicht vorgreifen solle. Freilich dürfe es nicht so weit gehen, dass der junge Herr in Person dem Baalsdienst beiwohne, wovor er aber durch die Keuschheit seines Gewissens oder durch eine väterliche Verordnung bewahrt werden könne.
Mit dementsprechenden Ermahnungen versehen, trat Wolfgang Wilhelm die Reise nach München an, wo er mit dem Herzog Maximilian gut auskam, obwohl dieser bald merken ließ, dass er sich die Bekehrung des jüngeren Vetters zum Ziel gesetzt hatte. Wolfgang Wilhelm widersprach ihm nicht mit hitzigem Eifer, wie die Lutheraner zu tun pflegten, sondern hörte achtungsvoll an, was Maximilian in Glaubenssachen vorbrachte, ohne von seinem Standpunkte abzuweichen, und nötigte den Gegner dadurch, mit seinem Gaste auch seinerseits vorsichtig und rücksichtsvoll umzugehen.
Am liebsten hielt sich der alte Philipp Ludwig zum Herzog von Württemberg, von dem ihn keine gleichartigen Ansprüche trennten, während das gemeinsame Bekenntnis des Luthertums sie verknüpfte; aber es war schwer, dem Herzog Friedrich beizukommen, der von besonderen Grundsätzen beherrscht war, die Philipp August nicht durchschauen konnte. Um wegen der Ablösung der österreichischen Lehensrechte sich die Gunst des Kaisers zu erhalten, hielt er sich beiseite, wenn die Glaubensgenossen etwas unternehmen wollten, um ihre Rechte zu wahren, wollte es aber doch nicht mit ihnen verderben und verwickelte sich dadurch oft in Widersprüche. Einmal brachten es die Umstände dahin, dass der Markgraf von Baden ihm gewisse Gebietsteile abzutreten versprach, wenn er einen Vertrag mit Neuburg abschlösse, worauf jener, Herzog Friedrich von Württemberg, ohne Besinnen einging, um sich die billige Erweiterung nicht entgehen zu lassen. Auch wäre ihm das Neuburger Bündnis recht gewesen, wenn nicht Neuburgs Verfeindung mit Kurpfalz dazwischengestanden hätte, dem Württemberg schon durch Verträge verpflichtet war. Wie nun die neuburgischen Gesandten nach Stuttgart gereist kamen, um den Vertrag abzuschließen, an welchem Philipp August viel gelegen war, entwich Herzog Friedrich rasch auf sein Schloss Tübingen, und als sie ihm dahin folgten, auf ein anderes, und so fort, bis sie es aufgaben und unverrichteter Sache und sehr erstaunt nach Neuburg zurückkehrten.
Mit der Feindschaft zwischen Pfalz-Neuburg und Kurpfalz hatte es folgende Bewandtnis: Bei der zunehmenden Hinfälligkeit des Kurfürsten Friedrich musste man, da sein Sohn und Nachfolger noch im kindlichen Alter stand, beizeiten in Heidelberg an die Vormundschaft denken, die nach alten Verträgen dem neuburgischen Vetter zustand. Die Pfälzer hielten es aber für bedenklich, dadurch dem Luthertum eine Pforte zu öffnen, und wandten sie dem reformierten Herzog von Zweibrücken zu, mit dem Kurpfalz ohnehin im engsten Einvernehmen stand. Eine so gewaltsame Verkürzung seiner Rechte kränkte den Herzog von Neuburg umso mehr, als er sich in der Tat Rechnung darauf gemacht hatte, diese Gelegenheit zur Ausbreitung des lutherischen Bekenntnisses zu benutzen.
Außer der Jagd und den Trinkfesten nahmen Liebessachen die Zeit Herzog Friedrichs von Württemberg in Anspruch. Er hatte mehrere Jahre mit einem ehemaligen Hoffräulein seiner Frau gelebt, die ihm bereits langweilig zu werden anfing, als er die fünfzehnjährige Tochter eines Sängers aus seiner Kapelle sah, deren spröde Jugend ihn entzückte und die zu voller Blüte anzufachen er sich sofort unwiderstehlich getrieben fühlte. Mit der Entlassung der bisherigen Geliebten wurde der Hofprediger betraut, der sich denn auch seufzend anschickte, die Frau in Kenntnis zu setzen. Sie solle sich, riet er ihr, zu ihrer Familie begeben oder sonst einen entlegenen Ort wählen, wo sie in der Stille weilen könne; denn in der Nähe des Herzogs sei ihres Bleibens nicht länger, ihre Gegenwart sei ihm unleidlich, weil sie ihn an begangenes Unrecht erinnere. Es bleibe ihr somit nichts anderes übrig, als den Willen des Herzogs zu respektieren und sich zu bessern.
Die fassungslose Dame war den Ratschlägen und Vorstellungen des Predigers nicht zugänglich und wusste sich den Zutritt zum Herzog zu erzwingen. Dieser fing an mit kurzen, schnellen Schritten im Zimmer auf und ab zu gehen und laut über ihr ungehorsames, widerspenstiges, unartiges Wesen zu klagen. Unmöglich sei es, mit einem solchen Weibe zu leben, zu lange schon habe er es ertragen, anstatt ihm dankbar zu sein, habe sie ihn unglücklich gemacht; wenn er nicht schleunig von ihr befreit werde, müsse er zugrunde gehen. Indem sie sich auf den Boden warf und seine Füße umschlang, erinnerte sie ihn unter Tränen an seine Liebesschwüre, vergangenes Glück und dergleichen, wie er an einem lieblichen Frühlingsabend unter einem blühenden Birnbaum sie, die Verzagte, an sich gezogen und sich verschworen habe: die Zunge solle ihm verfaulen, wenn er je ein unholdes Wort zu ihr spreche!
»Ja«, schrie der Herzog wütend, »damals liebte ich dich, und jetzt hast du meine Liebe verscherzt, das ist ein Unterschied!« Wenn sie sich jetzt in anständiger Verborgenheit halten und ihre Zunge hüten wolle, fuhr er ruhiger fort, wolle er etwas für sie tun; führe sie aber fort, ihn zu erzürnen, so werde er sie einsperren und gebührend bestrafen.
Nachdem diese Person beseitigt war, erhielt der Hofprediger den Auftrag, die Herzogin davon in Kenntnis zu setzen, was ihn veranlasste, den Herzog mit vorsichtigem Augenblinzeln zu fragen, ob er etwa das neue Dirnlein auch anweisen müsse. Der Herzog zog zuerst die Brauen zusammen, schlug dann aber ein lautes Gelächter auf und sagte, nein, darauf verstehe er sich besser.
Die Herzogin, eine Prinzessin von Anhalt, sah ihren Gemahl nur noch selten. Sie beschäftigte sich damit, in der Bibel zu lesen und Stücke daraus, die sie besonders liebte, in französische Sprache zu übertragen. Beinah täglich empfing sie den Besuch des Hofpredigers, mit dem sie sich über theologische Fragen unterhielt und von dem sie über die Vorgänge am Hof und im Lande unterrichtet wurde. Als er ihr von der Verabschiedung der letzten Geliebten ihres Mannes Mitteilung machte und zugleich ihre Mildtätigkeit für die Verstoßene in Anspruch nahm, bemerkte er, dass das blasse Gesicht der Herzogin sich rötete und den Ausdruck hoffender Erwartung kaum zurückhalten konnte. Er betrachtete sie verwundert und schwieg eine Weile in großer Verlegenheit, während er sich mit einem Tüchlein den Schweiß von der Stirn wischte. Dann erwähnte er behutsam das kleine Mädchen, das die Aufmerksamkeit des Herzogs erregt habe und für dessen Zukunft er väterlich sorgen wolle, weswegen es in der Nähe des Schlosses einquartiert sei. Die Augen der Herzogin erloschen wieder, und sie sagte, sich auf ihr ehemaliges Hoffräulein beziehend, sie wolle sie gern nach ihrem geringen Vermögen unterstützen, wenn ihre Eltern es nicht täten. »Ich habe es ihr vorausgesagt«, fuhr sie fort, »dass es so kommen würde, denn ich kannte meinen Herrn. Sie stand ein wenig beschämt vor mir, aber doch sah ich, wie glücklich und wie stolz und eigensinnig sie war, und konnte von ihrem Gesicht, das wie Apfelblüten leuchtete, ablesen, was sie dachte: ›Du kennst ihn nicht, du Armselige! Du freilich vermagst ihn nicht zu fesseln! Keine vermöchte es! Aber ich, ich! Mich, die Allerlieblichste, wird er niemals verlassen!‹ – Es ist nur Gott«, setzte die Herzogin gedankenvoll hinzu, »der uns niemals enttäuscht, weil er die Vollkommenheit ist. Aber unsere Seele, die der niedrigen Erde verwachsen ist, erreicht den Himmel nicht immer.«
»Das Gebet, das liebe Gebet trägt uns hinauf«, sagte der Pfarrer und fing an, allerlei kuriose Geschichten von der Wunderwirkung des Gebetes zu erzählen, womit er die Herzogin schließlich sogar zum Lachen brachte.
Eines Vormittags trat in die Apotheke ein in Pelzwerk und einen bunten Kaftan wunderlich gekleideter Mann, der Antimon, Merkur und Flos ferri zu kaufen verlangte und um Erlaubnis bat, in irgendeinem Nebenraum der Apotheke einige Versuche damit machen zu dürfen. Er bediente sich dabei der lateinischen Sprache, die er mit deutschen, fremdartig ausgesprochenen Wörtern vermengte. Der Apotheker, der in dem Manne sofort einen Adepten erkannte, antwortete zögernd, das Goldmachen, worauf er augenscheinlich ausgehe, sei im Württembergischen eine weitaussehende, gefährliche Sache, die allerlei Unvermutetes nach sich zu ziehen pflege. Er selbst sei auch in der Wissenschaft nicht unerfahren, hielte aber die Hände davon und riete auch dem Fremden, seine Kenntnisse als ein vorsichtiger Mann geheimzuhalten. Es waren unterdessen mehr Leute in den Laden getreten, deren Neugier durch die auffallende Erscheinung des Reisenden, seinen hohen Pelzhut, die große silberne, mit farbigen Steinen besetzte Schnalle, die den scharlachrot gefütterten Kaftan zusammenhielt, erregt wurde. Obwohl der Apotheker warnend den Finger auf den Mund legte, ließ der Fremde sich nicht bitten, sondern schwatzte bereitwillig von seiner Kunst und zeigte ein in einem gläsernen Büchschen verschlossenes pfirsichblütenfarbenes Pulver, mit dessen Hilfe er sich rühmte, ganz Stuttgart mit purem Golde überziehen zu können. Als er wiederum mit dem Apotheker allein war, mahnte ihn dieser ernstlich, nunmehr flugs die Stadt zu verlassen, bevor seine Anwesenheit dem Herzog hinterbracht sei; denn dieser sei nun einmal auf das Goldmachen erpicht und würde ihn nicht eher loslassen, als bis er seinen Durst nach diesem Metall vollkommen gestillt habe. Vor einigen Jahren sei auch einer gekommen, den habe der Herzog wie einen Heiland empfangen, ihn zum Feldmarschall und Oberjägermeister ernannt, ihn bei Tische neben sich sitzen lassen und ihm selbst das Fleisch vorgeschnitten und den Wein eingeschenkt. Nächtelang habe der Herzog ihm zugesehen, wie er im Laboratorium gemischt und gekocht habe, ja einige behaupteten sogar, er habe ihn umarmt und Herzbruder genannt. Wie aber die Taler und das Gold haufenweise in den Taschen des Adepten verschwunden seien, in seiner Pfanne aber nichts geraten sei, habe ihn der Herzog in billiger Entrüstung am Galgen aufhängen lassen.
Das habe der Betrüger denn wohl auch verdient, sagte der Fremde mit einem überlegenen Lächeln; ihm könne es so nicht gehen, denn er sei im Besitze des wahren Arkanums, er führe den echten Bräutigam in die Kammer, der die Braut nicht ungesegnet aus dem Feuerbett lassen werde.
Ach, sagte der Apotheker, das werde ihm auch nicht helfen, an einem Bröcklein oder Häuflein Gold werde sich der Herzog niemals genügen lassen; so viel, wie der haben wolle, könne ein armer Adept gemeiniglich doch nicht produzieren, da müsse er schon mit dem Teufel im Bunde stehen. Er hatte kaum ausgesprochen, als einer vom Hofstaat des Herzogs in die Apotheke trat, ein höfliches Gespräch mit dem Fremden anknüpfte und ihn aufforderte, einige Experimente im Schlosse zu machen; der Herzog habe ein vortreffliches Laboratorium und wolle sich gern von einem erprobten Künstler unterweisen lassen. Es hatte nämlich einer von den Bediensteten der Hofküche, der gerade Einkäufe an Gewürzen und Leckereien in der Apotheke machte, die Neuigkeit von der Anwesenheit des Wundermannes in das Schloss getragen, worauf Herzog Friedrich Befehl gegeben hatte, ihn einzuladen und, koste es, was es wolle, zu ihm zu führen. Der Fremde erschrak ein wenig, wollte es aber nicht merken lassen und bestellte, sich gewaltig aufblasend, noch allerlei Tinkturen und Mineralien bei dem Apotheker, der ihm, während er alles zusammentrug, kläglich zuzwinkerte.
Billigten die Theologen das Treiben ihres Herrn auch nicht, so dankten sie es ihm doch, dass er sie ungestört in ihrem Kreise walten ließ und nicht etwa wie andere Fürsten kalvinistische Umsturzgelüste hatte. Die Lutheraner hatten nach ihrer Meinung eine felsensichere Stütze in der Augsburgischen Konfession, als die von Kaiser und Reich verbürgt sei, und glaubten, es könne nur über die Kalviner hergehen, die kein Recht und keine Sicherheit erworben und auf nichts Schriftliches pochen könnten.
Da fiel ein Ereignis vor, welches die Evangelischen in weitem Umkreis aufschreckte und auch den Bequemeren zu denken gab. Zunächst hatte es nicht viel zu bedeuten, dass in der evangelischen Reichsstadt Donauwörth, wo sich ein katholisches Kloster befand, eine Prozession wider das Herkommen außerhalb der Kirche mit fliegenden Fahnen umzog und von angriffslustigem Straßenvolke belästigt wurde; aber unversehens nahm die Sache ein ernsteres Aussehen, da die Katholischen sich klagend an den Kaiser wandten, der Stadtrat aber, von der trotzigen Bürgerschaft gedrängt, nicht nachgeben wollte. Hin und wider wurde vermittelt und beraten, aber keine Verständigung erzielt, worauf der Kaiser endlich über die hartnäckige Stadt die Acht verhängte und den Herzog von Bayern zum Vollstrecker derselben erklärte. Dieser eigenmächtige Akt rief allgemeine Entrüstung unter den Evangelischen hervor, und auch die Katholischen billigten ihn nicht alle, teils aus Eifersucht auf Bayern, teils weil die Berechtigung dazu augenscheinlich bestreitbar war. Am meisten regte sich der alte Herzog von Neuburg als der Nachbar von Donauwörth und Bayern auf; denn er zweifelte nicht daran, dass Maximilian bei dieser Gelegenheit sein Gebiet überziehen und überhaupt gegen alle Ketzer auf einmal ausholen würde. Er schickte Boten nach allen Seiten: nach Donauwörth, um ihm Hilfe zu versprechen und es zum Ausharren zu ermuntern, nach der Stadt Ulm und nach Württemberg, um auf freundnachbarliche und glaubensverwandte Unterstützung zu dringen, ja sogar nach Kurpfalz, um anzuklopfen, wessen man sich in der Not von dort zu gewärtigen habe.
Auch dem Herzog von Bayern war nicht durchaus wohl zumute. Er hatte längst ein Auge auf die Stadt Donauwörth geworfen, an welche er alte Rechte haben wollte, und hatte deshalb die Gelegenheit, sich einzudrängen, gern ergriffen; aber er verhehlte sich nicht, dass er damit das Pfand noch nicht im eigenen Sacke hatte, und wenn er nach vollzogener Acht wieder abziehen musste, so hatte er umsonst viele Kosten aufgewendet, die ihm weder die kleine Reichsstadt noch der in Schulden fast ertrinkende Kaiser ersetzen würde.
Jocher, sein klügster und fleißigster Rat, musste den Fall vom rechtlichen Gesichtspunkt untersuchen und kam zu dem Schlusse, dass kein Rechtstitel vorhanden sei, unter dem der Herzog Anspruch auf die Reichsstadt erheben könne; indessen ließen sich, wenn der Herzog wolle, schon Umwege zum Ziele finden, und einen solchen biete eben die Geldfrage. Er müsse nämlich die Rechnung über die aufgewendeten Kosten von vornherein so groß machen, dass der Kaiser in absehbarer Zeit nicht daran denken könnte, sie zu bezahlen, und also die Sache stillschweigend veralten und verjähren lassen müsse.
Nun blieb freilich immer noch zu fürchten, dass die Stadt sich klüglich der Gnade des Kaisers unterwürfe, was beiden, der Stadt und dem Kaiser, das liebste gewesen wäre; aber dies unterblieb auf das Drängen einiger Heißsporne, die das Volk mit dem verheißenen Beistand der Glaubensgenossen vertrösteten. Der Herzog von Neuburg wollte sich hervorwagen, wenn die Stadt Ulm den Anfang machte; da sich diese aber auf Württemberg verließ, welches nicht geneigt war, sich einzumischen, so rührte sich keiner, und es blieb der verlassenen, vor der heranrückenden Macht des Herzogs heftig erschrockenen Stadt nichts übrig, als sich dem gestrengen Herrn zu unterwerfen. In seinem Gefolge waren mehrere Jesuiten, die den Auftrag hatten, die Bürgerschaft in der Weise zum katholischen Glauben zu bekehren, dass das gegebene Wort des Herzogs, gewaltsame Mittel sollten dazu nicht angewandt werden, dabei bestehen könne.
Die evangelischen Fürsten ärgerten sich nicht wenig, dass die glaubenstreue Stadt so liederlich verlorengegangen war und dass der hochmütige und habgierige Bayernherzog eine so geschwinde und billige Beute hatte gewinnen können, und der Drang, das Geschehene in etwas gutzumachen und ähnliche Verstöße in Zukunft zu verhindern, befeuerte sie zu einer gewissen Einmütigkeit und Tatkraft. Von dem herzhaften Christian von Anhalt zusammengehalten und angespornt, brachten sie ein Bündnis zuwege, das sie Union nannten und das seinen eigentlichen Rückhalt, da sich im Reiche genügende Kraft nun einmal nicht aufbringen ließ, in einem heimlichen Freunde, dem Könige von Frankreich, Heinrich IV., finden sollte. Hessen-Kassel und Kurbrandenburg wurden im folgenden Jahre für die Union gewonnen, Kursachsen hingegen, obwohl die eigentliche Vormacht der Evangelischen, ebenso Herzog Heinrich Julius von Braunschweig-Wolfenbüttel blieben missbilligend abseits.