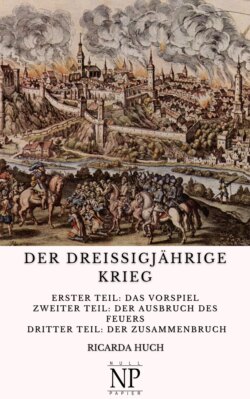Читать книгу Der Dreißigjährige Krieg - Ricarda Huch - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
10.
ОглавлениеDie ersten Jahre der zweiten Ehe des Herzogs Jan Wilhelm von Jülich-Cleve waren reich an Aufregungen für die beteiligten Fürsten; denn zuweilen hieß es, er sei nun gesund und wohlauf, halte offene Tafel und gehe zur Jagd, ja die Herzogin sei guter Hoffnung, und die Geburt eines Erben stehe bevor. Allein dies bewahrheitete sich niemals, und diejenigen schienen recht zu behalten, die von Anfang an behauptet hatten, Jan Wilhelm sei ebenso verwirrt wie früher und werde nur jeweilen, wenn er eine ruhige Zeit habe, dem Volke von fern gezeigt, damit es ihn für gesund ansehe. Die Herzogin halte sich für betrogen, sei bitterböse und werde nur mit Mühe bewogen, nicht zu ihren Verwandten in die Heimat zurückzukehren. Auch erfuhr man, dass sie einen Prozess gegen Schenkern wegen seiner vielen Gewalttaten anstrengte, wobei er aber mit dem Leben davonkam, wenn er auch von seinen Ämtern weichen musste. Dann kamen Nachrichten über die Abnahme von Jan Wilhelms Lebenskraft, die den Kurfürsten von Brandenburg und Wolfgang Wilhelm von Neuburg in Atem hielten; Wolfgang Wilhelm hatte Beauftragte in Düsseldorf, die es ihn ohne Verzug wissen lassen sollten, wenn der erwartete Todesfall einträte. Indessen vergingen noch mehrere Jahre unter wechselnden Gerüchten, bis Jan Wilhelm, ganz in Blödsinn verfallen, im Anfang des Jahres 1609 endgültig starb.
Ohne Zeitverlust machte sich Wolfgang Wilhelm mit einem kleinen Gefolge nach dem Norden auf, das Ziel seiner geschwinden Reise möglichst geheimhaltend. Während er durch die aufgeweichten Straßen zog, unter hochschiffenden Frühlingswolken und feuchten Stürmen, und den Blick über die braune Erde schweifen ließ, die von langsamen Pflügen aufgelockert wurde, hob sich seine Brust unter angenehmen Träumen. Niemand, dachte er, würde so früh wie er von dem Tode Jan Wilhelms unterrichtet sein, er würde als der erste anlangen und sich der Herrschaft bemächtigen. Gnädig würde er die Huldigung der Stände im Namen seines Vaters entgegennehmen und etwaige Widersacher entschlossen beugen; der Brandenburger würde am Ende froh sein, seine Ansprüche auf seine Tochter übertragen und sie ihm zur Ehe geben zu können. Spanien würde voraussichtlich alles aufbieten, um das Land in die eigene Gewalt oder in die eines von ihm abhängigen Fürsten zu bringen; aber er brauchte es nicht zu fürchten, da ja die Union ihm zur Hilfeleistung verpflichtet war und der König von Frankreich selbst ihn mit seinem Siegesschwert verteidigen würde. Die Vorstellung schmeichelte ihm, wie umsichtig er Vorsorge getroffen hatte und dass vielleicht ein Krieg unter den Völkern entbrennen würde, um ihn zum reichsten Fürsten im Deutschen Reiche zu machen.
Er war gerade am Ziele seiner Reise angelangt, als ein widerwärtiger Anblick plötzlich seine frohe Stimmung umkehrte: er sah das wohlbekannte brandenburgische Wappen am Tore angeschlagen, ein Zeichen, dass der Kurfürst bereits dort war oder durch einen Stellvertreter von der Hauptstadt Besitz ergriffen hatte. Viel weniger hätte es ihn erbittert, wenn ihm spanische Waffen entgegengestarrt hätten, denn diese hätten seine Glaubensgenossen verdrängen können; wer aber würde ihm helfen, den verhassten Nebenbuhler loszuwerden? Keiner von den protestantischen Fürsten würde ihm darin beistehen, das ganze Land ungeteilt für sich zu behalten. Obwohl ihm zunächst nichts übrigblieb, als sich in die Tatsache zu fügen, fühlte er sich allzu beleidigt, um es nicht den Markgrafen Ernst von Brandenburg, des Kurfürsten Vertreter, merken zu lassen, und es wäre zu einem folgenschweren Zerwürfnis gekommen, wenn nicht Landgraf Moritz von Hessen sich die Vermittlung hätte angelegen sein lassen.
Man möge doch auf gelegenere Zeit verschieben, stellte dieser beiden Parteien vor, wie das Land unter seinen Ansprechern zu teilen sei, und jetzt alle Kräfte darauf richten, dass es nicht dem Kaiser oder Spanien zufalle. Bei dem Kampfe, der sich darüber entspinnen werde, müsse man einig sein, jetzt seien alle Umstände günstig, die Habsburger, die Pest des Reiches, seien unter sich uneinig, im Begriffe, sich selber zu verschlingen. Der Augenblick sei für die deutschen Fürsten gekommen, sich ihre Unabhängigkeit zu erobern. In demselben Sinne sprach Anhalt, der geschäftig hin und her flog, um die letzten Zurüstungen zu betreiben, damit auf ein gegebenes Zeichen die Feuer an allen Orten zugleich aufflammen könnten.
In den habsburgischen Ländern bereitete sich sichtlich ein großer Umschwung vor, denn Matthias und Rudolf standen sich unversöhnlich gegenüber, und den Sieg davontragen musste der, dem die Übermacht der Protestanten zufiel. Khlesl und Matthias konnten sich dem nicht verschließen, dass sie der protestantischen Herren bedurften und dass diese sich nicht billig verkaufen würden. Zuerst waren sie mit Anlockungen und Vorspiegelungen ausgekommen; nachdem aber Rudolf Ungarn, Mähren und Österreich wirklich abgetreten hatte, verlangte der protestantische Adel wirkliche, mit Brief und Siegel beglaubigte Zugeständnisse, namentlich Glaubensfreiheit, die Matthias doch nicht gewähren zu dürfen glaubte. Der nunmehrige König von Ungarn wusste durchaus nicht, wie er diesen gewiegten, redefertigen, grundgelehrten und vorurteilslosen Herren begegnen sollte. Khlesl hatte gut sagen, nun solle er zeigen, dass er dem erhabenen Erzhause angehöre, er müsse ihre Dreistigkeit durch Majestät in Schranken halten; Matthias klagte, es werde ihm übel in den Eingeweiden, wenn er diese Leute nur sähe, der Teufel führe ihnen die Zunge, sie sollten ihm nicht mehr vor die Augen kommen. Hiervon nahm er einzig den mährischen Baron Zierotin aus, der denn auch schließlich die Verhandlungen zu einem Ende brachte, indem er einerseits den Adel in etwas nachzugeben und Matthias den notwendigen Forderungen Genüge zu leisten bestimmte.
Zierotin war ein kluger, feingebildeter, etwas kränklicher Herr, der nach mancherlei Enttäuschungen jugendlicher Begeisterung die aufgeregten Kämpfe seiner Zeit mit melancholischem Zweifel verfolgte. Er war der Ansicht, dass die Evangelischen nicht auf die Gleichberechtigung ihres Bekenntnisses dringen sollten, wenn der Frieden davon abhänge; was verschlage es ihnen, ob sie ihre Andacht in dieser oder jener Kirche verrichteten, ob sie ihre Gebeine auf diesem oder jenem Kirchhof beerdigten, an welchem Orte sie ihren Glauben laut bekennen dürften? Wenn sie nur nicht verhindert würden, Gott in ihrer Weise zu dienen, und nicht gezwungen, Abgötterei zu treiben. Wollten sie mehr erreichen, müssten sie weniger selbstsüchtig und einig untereinander sein. Die Hussiten bekrittelten die Meinungen der Böhmischen Brüder, beide hassten die Lehren der Reformierten, und kaum hinderte sie die gemeinsame Gefahr, sich gegenseitig zu zerreißen. Wie oft hätte er versucht, die Herren aller habsburgischen Länder so zu vereinigen, dass sie einen Körper bildeten, der mächtig allen Gegnern gewachsen wäre; die Eifersucht der Schlesier und Mähren auf Böhmen und Österreich hätte es verhindert. Sie sollten sich mit dem Erreichbaren begnügen, da sie das Vollkommene zu verdienen nicht fähig wären.
Die ungewöhnliche Erscheinung des blassen Herrn im braunen Sammetkleide, dessen traurige Augen Überlegenheit und zuweilen eine leise, zurückgehaltene Verachtung ausdrückten und dessen sanfte Stimme eher zögerte als sich aufdrängte, gewann auf alle solchen Einfluss, dass sie sich, wenn auch widerwillig, fügten. Die Herren zürnten ihm, dass er, von seinem früheren, schärferen Standpunkt abweichend, für Zugeständnisse stimmte, und auch Matthias gab, ohne überzeugt zu sein, mit bekümmertem Gewissen nach.
Wie ein vom Himmel stürzender Donnerkeil traf Matthias die Exkommunikation1 des Papstes, weil er sich mit den Ketzern verglichen und ihnen eine, wenn auch beschränkte, Duldung gewährt habe. Dies sei die Strafe, jammerte er, für sein Rebellieren und Traktieren! Hätte er sich doch niemals so viel unterstanden! Nun ziehe Gott die Hand von ihm ab, und zu so viel Plage und Ungemach auf Erden stehe ihm jenseits noch die Hölle bevor. Khlesl redete ihm ernstlich zu: »Sie nehmen sich die Sache allzu sehr zu Herzen«, sagte er, »die adeligen Herren sind keine Handwerker oder Bauern, die man ohne weiteres in ein Gefängnis werfen oder aus dem Lande jagen kann; man muss mit ihnen dissimulieren, und der Heilige Vater würde es selbst nicht anders machen, wenn er dergleichen Untertanen hätte.« Solange Matthias, fuhr er fort, in seinem Herzen ein guter Katholik sei und sich vorbehalte, die Ketzerei auszurotten, sowie er die Möglichkeit dazu habe, brauche er sich nicht schuldig zu fühlen.
In demselben Sinne sprach sich auch der Beichtvater aus, bei dem Matthias Trost suchte. Er bewog den König, eine ausdrückliche Erklärung insgeheim auszustellen, dass er nur gezwungen den Ketzern nachgegeben habe und den Kampf gegen sie zu gelegener Zeit wieder aufnehmen wolle; wodurch sich denn der zürnende Papst versöhnen ließ.
Unterdessen stritten auch die böhmischen Herren miteinander, um eine gemeinsame Formel für ihre Forderungen zu finden, worüber es beinahe zu vollständiger Entzweiung gekommen wäre. Die Lutheraner und Utraquisten schrieben eine bestimmte Kleidung für ihre Geistlichen vor, während die Böhmischen Brüder der Ansicht waren, Frömmigkeit solle sich durch die Reinheit des Herzens und der Sitten ausdrücken, und es sollten sich deshalb die Geistlichen nicht durch äußerliches Gewand von der Menge unterscheiden. Schon hatten die Lutheraner erklärt, sich lieber von den Katholiken Hunde schelten lassen als den Böhmischen Brüdern die Hand reichen zu wollen, als diese durch Nachgiebigkeit den Frieden wieder herstellten. Nunmehr legten die Einmütigen Rudolf ihre Forderungen vor und drohten, nicht auseinanderzugehen, bis er sie bewilligt habe.
Schrecken und Unruhe bemächtigte sich der Bürger, die nicht wussten, auf welche Seite sie sich bei dem augenscheinlich bevorstehenden Kampfe schlagen sollten. Als Protestanten fühlten sie die Pflicht, zu ihren Glaubensgenossen zu stehen; aber sie waren dem Kaiser, in dem sie einen guten alten kranken Mann sahen, ergeben und betrachteten die adeligen Herren mit Misstrauen. Sie verwünschten das Lärmschlagen und Zusammenrotten, das den Geschäftsgang ins Stocken brachte und Handel und Wandel bedrohte. Nicht mindere Verlegenheit herrschte auf der Burg. Der Kaiser wollte die Abgeordneten nicht vor sich lassen, so erzürnt war er über ihre Dreistigkeit; aber ihre Forderungen geradezu abzuweisen, getraute er sich auch nicht. Auf der anderen Seite mochte er die katholischen Kronbeamten, Lobkowitz, Martinitz, Slawata, seine Unsicherheit nicht merken lassen, die ihn drängten, fest zu bleiben und die Verbündeten als Rebellen zu behandeln. Erzherzog Leopold, der anwesend war, bestürmte ihn, den Krieg entscheiden zu lassen. Er hatte mehrere Offiziere aufgetrieben, darunter Lorenz Ramée, einen wilden Menschen, der im Besitz der feinsten Kriegskunst zu sein behauptete und sich vermaß, ganz Böhmen in einem Feldzuge zum Gehorsam zu bringen. Die Kronbeamten stimmten ihm bei: Rudolf dürfe sich von den Ständen nichts vorschreiben lassen, zeige er ihnen jetzt nicht den Herrn, würde er ihr Sklave werden. Und wenn der Kaiser selbst, sagte Lobkowitz, den Vertrag unterschreibe und ihn bei seinem Leben hieße, es auch zu tun, so würde er doch seinen Namen nicht daruntersetzen. Er sei nicht nur ein Diener des Kaisers, sondern auch Gottes und seines beschworenen Amtes.
Die herrische Art dieses Magnaten erfüllte den Kaiser mit Abneigung und Argwohn; es fiel ihm ein, dass Heinrich III. nicht durch einen feindlichen Ketzer, sondern durch einen seines Glaubens ermordet war. Diese Leute, dachte er, maßten sich mehr an als die Protestanten, während sie doch mehr als jene zur Unterwürfigkeit gegen ihn verpflichtet wären. In äußerster Ratlosigkeit ließ er Hannewald rufen, dem es nie an tüchtigen Auskunftsmitteln gebrach, den einzigen Mann, von dem er glaubte, dass es ihm nur um die Erhaltung der Kaisermacht zu tun wäre.
Gelassen ruhten Hannewalds Blicke auf dem graubleichen Gesicht und den zitternden Händen seines Herrn. Was der Lobkowitz und die anderen Herrschaften vorgebracht hätten, sagte er, könne der Kaiser an die Wand malen lassen, sonst sei es zu nichts gut. Krieg! Man hätte jetzt gesehen, wie man mit dem Matthias gefahren sei.
»Ich bin verloren!« sagte der Kaiser, indem er das Gesicht mit den Händen bedeckte; »alles verlässt mich. Der Tod wird mich aus dem Elend erlösen!« Hannewald, der solche Klagen öfters gehört hatte, war nicht dadurch gerührt und ließ sich nicht darauf ein. »Es gibt einen vergrabenen Schatz im Königreich Böhmen«, sagte er, den Kaiser fest ins Auge fassend, »wer den hebt, ist Herr des Landes, und Eure Majestät kann ihn ohne viel Mühe oder Gefahr gewinnen!« Rudolf, in dem sogleich abenteuerliche Hoffnungen auftauchten, hob den Kopf und sah Hannewald begierig an; er werde doch aber nicht allein bei der Nacht etwas Schauerliches verüben sollen? Nein, sagte Hannewald, dergleichen nichts. Er brauche nur den Städten die Reichsunmittelbarkeit zu verleihen und die Bauern zu befreien, so hätte er ein Heer, das für ihn kämpfen und siegen werde. Wie lange hätte er den Übermut und Trotz des Adels erduldet, von dem sich jeder mehr als der Kaiser dünke und die darauf ausgingen, eine Adelsrepublik zu gründen. Dieser Adel habe das Reich an sich gerissen, indem er die Bauern zu Knechten gemacht habe und für sich arbeiten lasse. Die Schmarotzer sögen sich voll, indes der Kaiser und das Land verarmten. Auch die Städte fürchteten den Neid und die Missgunst des Adels und blickten voll Sehnsucht nach dem Kaiser; die Bauern riefen ihn an als ihren Heiland. Kürzlich hätten die Bauern eine Beschwerde gegen ihre Herren aufsetzen lassen, um sie dem Kaiser zu überreichen; wie das herausgekommen wäre, hätten die Herren den Bauern die Köpfe und dem Schreiber, der die Beschwerde geschrieben hatte, die Hände abschlagen lassen. Sie wollten es nicht leiden, dass die Bauern einen Kaiser hätten, darum hätte der Kaiser keine Bauern und kein Kriegsheer mehr. Er, der katholische Kaiser, könne mit einem Wort die evangelischen Bürger und Bauern zu seinen treuen Untertanen machen. Nur von ihm hänge es ab, ob er ein mächtiger Herr über ein blühendes Land sein wolle.
Der Kaiser starrte Hannewald enttäuscht und befremdet an. »Das ist Rebellion«, sagte er langsam. »Das ist wider Gottes Gebote.« Ob Gott dem Adel die Erde geschenkt habe? fragte Hannewald. Es handle sich da nicht um Religion, sondern um Vernunft und Notwendigkeit. Indessen, was Hannewald auch entgegnete, der Kaiser schüttelte den Kopf und sagte am Ende, das wären Schimären, Hannewald solle ihm auf andere Art helfen. Er könne ja abdanken, sagte Hannewald ärgerlich und schickte sich an, fortzugehen. Rudolf hielt ihn kläglich bittend zurück; wenn er, Hannewald, ihn verlasse, so bleibe ihm nichts übrig, als sich ins Grab zu legen. »Wenn Sie sich zum Handeln nicht entschließen können«, sagte Hannewald, sich an der Tür umwendend, »so müssen Sie den Evangelischen nachgeben.« Geld, um Söldner zu einem aussichtsvollen Kriege zu werben, sei nicht vorhanden. Die ganze Erde hätte nicht Wasser genug, um den Brand zu löschen, der entstehen würde, wenn irgendwo ein Feuerfunken zündete. Pfalz und Hessen spitzten die Ohren, um das Schwert zu ziehen, sowie irgendwo die Waffen klängen; Frankreich und Holland würden einfallen. Wo wolle er da bleiben ohne Heer? Er sei nicht einmal Bayerns sicher. Dann möchte sich Lobkowitz mit dem Papst vor seinen Thron stellen und ihn beschützen.
Dieser Ausgang, die Forderungen der protestantischen Herren zu bewilligen, war dem Kaiser im Grunde erwünscht; denn seine Unterschrift kostete ihn nichts, und er gewann Zeit, neue Rettungspläne einzufädeln. Von solchen Hintergedanken äußerte er gegen Hannewald nichts; aber am Tage, nachdem er die Urkunde unterschrieben hatte, durch welche der böhmische evangelische Adel seine Rechte zu versichern dachte und welche unter dem Namen des Majestätsbriefes bekannt wurde, empfing er seinen Neffen Leopold und erteilte ihm die Erlaubnis, sich umgehend nach Jülich aufzumachen und in seinem Namen von der Festung Besitz zu ergreifen. Auf diesen kriegerischen jungen Mann, der ihm leidenschaftliche Ergebenheit beteuerte, setzte er jetzt sein Vertrauen, und ihn dachte er gegen seine Brüder und seinen Neffen Ferdinand auszuspielen. Böhmen und Jülich sollten Leopolds Hausmacht werden, und als Schwager Maximilians von Bayern würde er auch über dessen Macht verfügen können; Rudolf nämlich gab seine Heiratspläne bereitwillig auf, um die Braut für seinen Neffen zu werben, der ihm seine Liebe und die damit verknüpften Hoffnungen gestanden hatte.
Leopolds abenteuerliche Fahrt ließ sich zuerst besser an, als zu erwarten war: der Kommandant von Jülich, Rauschenberg, der die Festung weder dem Brandenburger noch dem Neuburger hatte einräumen wollen, überließ sie dem Günstling des Kaisers, der sich in Verkleidung glücklich bis dahin durchgeschlagen hatte.
Damit war die Losung zum Kriege gegeben; denn die Union hatte sich verpflichtet, den Fürsten von Brandenburg und Neuburg zur Erhaltung des Rheinlandes, wenn es ihnen etwa streitig gemacht werden sollte, zu Hilfe zu kommen. Dass es sich dabei nicht eigentlich nur um das Herzogtum Jülich handelte, wussten alle; bei diesem Anlass sollten einmal die alten Streitfragen ausgefochten werden, die in Güte nicht zum Austrag zu bringen waren. Nach dem Zusammentritt der Union hatten sich auch die katholischen Fürsten verbündet, um den Protestanten nötigenfalls eine tüchtige Kriegsmacht entgegensetzen zu können. Maximilian von Bayern hatte sich bereit erklärt, die Leitung des Bundes und den Oberbefehl über das Heer im Fall eines Krieges zu übernehmen unter der Bedingung, dass Österreich nicht darin aufgenommen würde. Doch hatte Spanien, das dem Bunde gern beigetreten wäre, wenigstens die Zulassung Ferdinands von Steiermark durchgesetzt, wenn er auch freilich mit einem bloßen Titel abgefunden wurde; da man schon Frankreich gegen sich hatte, hielt es Maximilian nicht für rätlich, es auch mit Spanien zu verderben.
Während der protestantische Adel Böhmens noch in kriegerischer Stimmung auf dem Rathause zu Prag versammelt war, eilte Christian von Anhalt hin, um auf den Sturz des Kaisers zu dringen und einen Anschluss an die Union zu vereinbaren. Wie sehr er jedoch seine Reise beschleunigte, kam er erst an, als Rudolf schon den Majestätsbrief unterzeichnet und dadurch eine Versöhnung herbeigeführt hatte. Anhalt war enttäuscht und entrüstet, dass man sich so hatte einfangen, vom abgefeimtesten der Lügner hatte hinters Licht führen lassen. Nie mehr, und wenn er seine Seele zum Pfände setze, würde er Rudolf trauen; er hätte keine, seine Brust sei leer wie ein hohler Baum, in dem die Fäulnis leuchtete. So arg sei es doch wohl nicht, meinte Wilhelm von Lobkowitz, und man vermeide doch lieber die Extremitäten, wogegen andere sagten, sie trauten Rudolf keineswegs, einstweilen hätten sie ihm aber die Hände gebunden, das Weitere müsse man abwarten. Graf Thum war unzufrieden und teilte Anhalts Meinung, man hätte den mürben Strick nicht noch einmal anknoten sollen; nun aber, sagte er auch, müsse man sich damit weiterhelfen, solange er hielte. Vergebens malte Anhalt die Gunst der Umstände: überall recke die Freiheit das Haupt, Venedig sei im Kampfe mit dem Papst Sieger geblieben, man könne keine kühnere Sprache führen als der Doge und jener vom kalvinischen Geiste beseelte Mönch Paolo Sarpi. Was für Veränderungen, wenn die weltliche Herrschaft des Papstes stürzte, das tönerne Haupt des großen Tieres zerschellte! Wenn Genf, die Keusche, ihren Fuß auf den Nacken der römischen Hure setzte! Vergeblich mahnte er zum Eintritt in die Union und bot ihre Hilfe an: insgeheim fürchteten die böhmischen Herren für ihre Selbstständigkeit und hüteten sich, Verpflichtungen gegen die deutschen Fürsten auf sich zu laden.
In Wahrheit waren die Kräfte und Mittel der Union weniger glänzend, als Anhalt sie darstellte. Keiner von den Fürsten hatte Geld genug, um sein Heer lange Zeit im Felde zu halten, oder Lust, das etwa vorhandene daranzuwagen. Nur die Städte hatten einen vollen Beutel, zogen ihn aber nicht auf, außer wenn es ihnen wirklich und erweislich unmittelbar zugute kam. Wir möchten sie so markten, sagte dann wohl Anhalt ungeduldig, wenn es sich um die Freiheit der Gewissen handele! Wollten sie stillsitzen, wenn nun die Horden der Jesuiten und Kapuziner näherrückten, um die dem reinen Gottesdienst geweihten Kirchen mit ihrem Baalsdienst zu besudeln?
Sie würden sich wehren, erwiderten die Städte, wenn die Widersacher ihnen zu Leibe rückten; aber davon wären noch keine Anzeichen vorhanden. Wenn in ihrem Gebiet ein Päpstlicher sich unbescheiden aufführte, so hätten sie Mittel, ihn zu strafen trotz Kaiser und Papst. Bisher hätte der Kaiser sie bei ihren Rechten und Gewohnheiten belassen, wie sie ihm wiederum ihre Schuldigkeit geleistet hätten.
Sie hätten keinen Gemeinsinn, warf ihnen Anhalt vor.
Ob die Fürsten nicht auch zuerst ihre Selbsterhaltung bedächten, entgegneten die Städte. Es wäre bisher so gewesen, dass sie vom Kaiser ihren Lebensfaden angesponnen und dass die Fürsten ihn abzuschneiden getrachtet hätten; sollten sie sich nun gegen den Kaiser zu den Fürsten stellen? Man sehe jetzt wieder, wie der Herzog von Wolfenbüttel der Stadt Braunschweig nachstellte und sie zu einer gemeinen Landstadt herunterdrücken wollte.
Ja, und der Kaiser hätte sie nicht beschützt, sagte Anhalt triumphierend, ebensowenig wie die Reichsstadt Donauwörth, die er vielmehr aus Glaubenshass dem jesuitischen Herzog von Bayern preisgegeben hätte.
Wäre die Stadt vorsichtig gewesen und hätte dem Pöbel nicht zu viel nachgegeben, antworteten wiederum die Städte, möchte es nicht so weit gekommen sein. Übrigens wüssten sie wohl, dass die gegenwärtigen Läufte gefährlich und besonders für die Städte verdächtig wären; sie müssten mühselig zwischen Scyllam und Charybdim hindurchsteuern, wollten sie die heile Haut davontragen.
Als Christen sollten sie nicht an ihre Haut denken, sagte Anhalt, sondern an ihren Gott. Worauf der nürnbergische Abgesandte einmal entgegnete: »Euer Liebden reden viel von Gott, wenn Sie zu uns sprechen. Sprechen Sie aber zu Ihresgleichen, so reden Sie von der Libertät, welches so viel heißt, als dass die Fürsten dem Kaiser nicht Untertan sein wollen.«
Was ferner den Städten durchaus nicht eingehen wollte, war die Verbindung mit dem König von Frankreich als mit einem ausländischen Fürsten. In der guten alten Zeit würde man dergleichen als Hochverrat angesehen haben, und es könne nichts Gutes aus solchem Bündnis kommen. Noch dazu sei der König von Frankreich ein Apostat, habe seinen Glauben abgeschworen, seine Glaubensbrüder verraten und bekämpfe sie jetzt. Wie reime sich das damit, dass er den Protestanten im Nachbarlande beistehen wolle? Dabei sei kein Treu und Glauben, und es möchte den guten Deutschen ergehen wie dem Bären oder Hasen, als er mit dem Fuchs gemeinsame Sache machte.
1 Exkommunikation ist der zeitlich begrenzte oder auch permanente Ausschluss aus einer religiösen Gemeinschaft oder von bestimmten Aktivitäten in einer religiösen Gemeinschaft. <<<