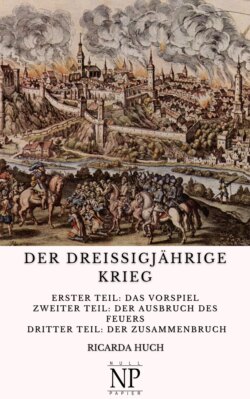Читать книгу Der Dreißigjährige Krieg - Ricarda Huch - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
12.
ОглавлениеWährend im Nordwesten des Reiches die Waffen klirrten, reisten die Kurfürsten von Köln, Mainz und Sachsen nach Prag zu einem Konvent, den der Kaiser zur Beratung der schwebenden Fragen ausgeschrieben hatte, nämlich der Jülicher Sukzession, des Streites um Donauwörth, seines Handels mit Matthias und der Nachfolge im Reich. Wegen der Aussöhnung des Kaiser mit Matthias hatte sich Ernst von Köln während des Winters längere Zeit in Prag aufgehalten, aber keine Audienz beim Kaiser erhalten können, sodass er über die Einladung, die er gleich nach seiner Rückkehr erhielt, füglich erstaunt war; da jedoch die mildere Jahreszeit heranrückte und die Kriegsfrage für ihn als Nachbar von Jülich von hohem Belang war, machte er sich geduldig wieder auf den Weg. Im ganzen sahen die Herren einer fröhlichen Zeit entgegen, da sie in Prag Gäste des Kaisers sein sollten, der zu großer Verlegenheit des Finanzrates die Fürsten üppig zu bewirten liebte.
Nach feierlicher Eröffnung durch den Kaiser leitete der Konvent seine Tätigkeit dadurch ein, dass er von mehreren Universitäten Gutachten über die verwickelte Jülicher Erbfolge einzuholen beschloss, welcher denn von den verschiedenen Erbansprechern, zu denen auch der Kurfürst von Sachsen gehörte, das beste Recht hätte. Sie waren noch in Erwartung der Antworten, als die Nachricht von der Ermordung Heinrichs IV. von Frankreich eintraf, wodurch die Kriegsgefahr sich erheblich verringerte. Herzog Heinrich Julius von Braunschweig-Wolfenbüttel, der wegen seines Streites mit der Stadt Braunschweig sich schon vor mehreren Jahren persönlich mit dem Kaiser in Verbindung gesetzt und ihn ganz auf seine Seite gebracht hatte und der auch jetzt wieder in Prag anwesend und von dem ihm besonders vertrauten Kaiser zum Konvente zugezogen war, gab bei dieser Gelegenheit ein Gastmahl, dessen vornehmste Tafelzierde ein die Judith mit dem Haupte des Holofernes darstellendes Schaustück bildete. Es bestand aus Mandeln, Honig und Mehlteig und war dadurch merkwürdig, dass der Zuckerbäcker auf Anweisung des Herzogs von Braunschweig dem von der Judith am Schopfe gehaltenen Haupte die Züge Heinrichs IV. zu geben versucht hatte. Er sei selbst in der Werkstatt des Meisters gewesen und habe nicht ungeschickt mit zugegriffen, erzählte der Herzog seinen Gästen, die denn auch die Arbeit wohlgelungen und des Königs Nase und Bart wohlgetroffen fanden. Der rüstigen Mörderin, erklärte der Herzog, habe er nur das Gesicht eines beliebigen schönen, gesunden Weibsbildes geben lassen, denn er wisse nicht, wie der Mann beschaffen sei, der den König erstochen habe, auch sei das Ganze mehr als ein Symbolum aufzufassen. Wer er auch sei und ob man auch die Mordtat nicht billigen könne, sagte der Erzbischof von Köln, so sei sie, wenn nicht auf Anstiftung, doch unter Zulassung Gottes geschehen, der das fromme Kaiserhaus augenscheinlich beschütze. Der kecke und unruhige Geist des Königs hätte ein hübsches Kriegsfeuer am Rheine anzünden können, daran sie lange zu löschen gehabt hätten. Ja, sagte Kurfürst Christian von Sachsen, mit Frommsein und Zuwarten übe man meist die feinste Politik aus, indem Gott die Entscheidung in allen Dingen zustehe und er alles zum Besten der Frommen einrichte.
Um nun die Jülicher Frage vollends zum Ende zu bringen, erklärte sich der Kaiser einverstanden, den Kurfürsten von Sachsen mit dem erledigten Herzogtum zu belehnen, welche Handlung gleich während des Konventes feierlich vollzogen werden sollte. Hatte Rudolf es auch bereits seinem Neffen Leopold versprochen, so konnte doch inzwischen der sächsische Kurfürst damit zufriedengestellt werden, den als den mächtigsten evangelischen Fürsten von Zeit zu Zeit durch eine unvorgreifliche Vergünstigung zu verpflichten ein Hauptstück der kaiserlichen Regierungskunst im Reiche war. Mit Eifer nahm sich dieser Sache der Herzog von Wolfenbüttel an, indem er für die richtige Ausführung des Belehnungsaktes nach den Vorschriften der Goldenen Bulle, die er auswendig wusste, Sorge trug. Die Fürsten, welche seine Gelehrsamkeit bewunderten, fügten sich seinen Anordnungen und kamen in dem Gasthof, den er bewohnte, zusammen, um dem Kurfürsten von Sachsen seine Rolle einzustudieren. Christian nämlich war von großer, breiter, muskelstarker Gestalt, hatte sich als Jüngling bei Turnieren ausgezeichnet und pflegte sich von den Bildhauern als Herkules darstellen zu lassen; aber das übermäßige Trinken hatte ihn aufgeschwemmt und zu einer trägen, unförmigen Masse gemacht, sodass es nicht leicht war, ihn seinem alten Ruhme gemäß eindrucksvoll zu verwenden. Vornehmlich schwer wurde ihm das Niederknien vor dem Kaiser, das den wichtigsten Punkt der Darstellung bildete, da er in der engen und schweren Rüstung, die dazu gehörte, noch unbeweglicher als sonst war. Die Erzbischöfe musterten etwas besorgt das rotgedunsene Gesicht mit den schlaff hängenden Backen unter dem Kurhute, an dem der Schweiß hinunterzulaufen begann, während der Herzog ihn unnachsichtig den Kniefall wiederholen ließ, bis es ohne Anstoß gelungen wäre. Es habe nichts auf sich, sagte der Herzog, wenn der Kurfürst sich etwas langsam und unanstellig gebärde, nur dürfe er weder lachen noch greinen oder das Maul hängen lassen, ebensowenig taumeln oder stolpern oder schnaufen, was alles der fürstlichen Majestät Abbruch tue, vor allen Dingen aber beim Niederknien nicht wie ein voller Sack zu Boden plumpsen, sondern sich gelinde und gleichsam aus freien Stücken niederlassen und wieder aufstehen. Schließlich kamen die Fürsten überein, dass es besser wäre, dem Kurfürsten zwei Knappen beizugeben, die ihm beim Niederknien und Wiederaufstehen unter die Arme griffen, da man sonst doch sich eines Unfalls besorgen müsse.
Der Kurfürst, den das häufige Proben etwas verdrossen hatte, gewann bei dem sich daranschließenden Gelage seine gute Laune wieder, übernahm sich aber im Trinken so sehr, dass er am folgenden Morgen, als die Belehnung vorgenommen werden sollte, gänzlich unfähig und seiner nicht mächtig war und dadurch die Fürsten in nicht geringen Schrecken versetzte. Sie sollten ihm einen Humpen voll zu trinken geben, sagte Christian übellaunig zu ihnen, die ihn vorwurfsvoll umstanden, dann werde er alles ordentlich ausrichten, erst müsste er allemal den Schlaf, der ihm wie Blei in den Gliedern liege, mit einem Frühtrunk fortspülen. Dem widersetzte sich anfangs der Herzog von Braunschweig, da es erstens der Güldenen Bulle nicht gemäß sei und zweitens auch gefährlich, indem der Kurfürst sich wieder übernehmen und dadurch alles zum Scheitern bringen könne; allein auf Zureden der anderen, dass Christian in einer mäßigen Trunkenheit besser figurieren könne als nüchtern, ließ ihm der Herzog einen Krug Bier verabreichen, worauf er sich erholte und die Zeremonie unter großem Gepränge und Zulauf vorgenommen wurde und auch leidlich abging. Das Gesicht des Kaisers blickte fahl und traurig aus dem starrenden Ornat, mit dem er behangen war; er hatte sich in der letzten Zeit von den gemeinsamen Zusammenkünften zurückgezogen, da die Fürsten allmählich abreisen und vorher dasjenige Geschäft erledigen wollten, das ihm widerwärtig war, nämlich die Aussöhnung mit Matthias.
Auch dieser wollte anfangs nichts davon hören, aber der Herzog von Braunschweig, der unverdrossen nach Wien reiste, um ihn zu bearbeiten, brachte ihn dahin, dass er die Waffen niederzulegen versprach, wenn der Kaiser das Kriegsvolk entließe, das er im Bistum Passau geworben hatte und das gegen ihn bestimmt sei. Darauf wollte Rudolf jedoch nicht eingehen: das Passauer Kriegsvolk, sagte er, gehöre seinem Neffen Leopold und solle in der Jülicher Fehde verwendet werden; er habe nichts damit gegen Matthias im Sinne, aber er und seine übrigen Brüder und Neffen, mit Ausnahme Leopolds, wären ein vatermörderisches Geschlecht und wollten ihn wehrlos machen, um ihn desto besser ausplündern zu können. Die Fürsten waren über Rudolfs seltsame Geisteskonstellation etwas betreten, ließen aber nicht nach, auf ihn einzureden, bis er einwilligte, die Passauer zu entlassen und die Abbitte der schuldigen Verwandten entgegenzunehmen, nur Matthias wolle er nicht sehen. Es wurde also ausgemacht, dass anstatt seiner die Erzherzöge Maximilian und Ferdinand vor ihm erscheinen sollten; aber eine neue Schwierigkeit entstand dadurch, dass der Kaiser die Bedingung stellte, sie müssten die Abbitte kniend vortragen, wozu sich wohl Ferdinand, aber nicht Maximilian verstehen wollte. Als dem Kaiser endlich mitgeteilt werden konnte, dass sein Bruder in Hinsicht auf den Kniefall nachgegeben habe, fing er an zu weinen und sagte, er wolle nun und nimmermehr einen Habsburger auf den Knien sehen, sondern werde Maximilian aufheben, sobald er die Knie zu beugen begonnen haben werde. Dies führte er auch aus, reichte beiden Erzherzögen die Hand und sprach sie freundlich an, indem er sich nach Ferdinands Frau und Kindern erkundigte.
Nachdem diese Angelegenheit erledigt war, besprach sich der Kaiser mit den Fürsten noch über die Nachfolge im Reich, die er keineswegs Matthias, sondern seinem Neffen Leopold zuwenden wollte. Die Kurfürsten widersprachen ihm nicht, sondern erklärten sich bereit, Leopold die Stimme zu geben; Trier und Köln wollten Matthias wegen seiner Anzettelungen mit den Protestanten nicht wohl und waren es deswegen zufrieden, ihn zu übergehen. Um die Stimmen der protestantischen Kurfürsten zu gewinnen, knüpfte Rudolf eingehende Verhandlungen mit Pfalz an, wobei er sich auf den Majestätsbrief berief und auch im Reiche den Forderungen der Evangelischen Rechnung zu tragen verhieß. Indessen wurde diese Übereinkunft durch den Tod des Pfalzgrafen, der im September desselben Jahres 1610 erfolgte, abgerissen.
Nachdem die Festung Jülich von den Unierten erobert war, kehrte Leopold ruhmlos nach Prag zurück, doppelt auf große Unternehmungen erpicht, durch die er seine Niederlage wettmachen wollte. Er flößte seinem Oheim Mut ein, mit den in Passau geworbenen Truppen Matthias Ungarn und Österreich wieder abzunehmen, was denn auch in geheimer Übereinkunft beschlossen wurde. Als nun Matthias, der inzwischen sein Heer, dem gegebenen Versprechen gemäß, entlassen hatte, auf die Entlassung der Passauer drang und der Herzog von Braunschweig deswegen beim Kaiser vorstellig wurde, entschuldigte sich dieser, er habe kein Geld, den Passauern ihren Sold, nämlich 400.000 Gulden, auszuzahlen, ohne welchen sie nicht auseinandergehen wollten. Der Sold müsse aufgebracht werden, sagte der Herzog eifrig, er mache sich dazu anheischig, wenn es nicht anders sei. Die Sache wurde nämlich dadurch dringender und gefährlicher, dass die Passauer erklärten, das Bistum sei jetzt gänzlich erschöpft und ernähre sie nicht mehr, sie müssten wohl oder übel nach Böhmen ziehen und sich dort erholen. Die Angst vor diesem Heuschreckenschwarm bewog die böhmischen Stände, dem Herzoge, der sie darum anging, 300.000 Gulden zu versprechen, worauf er einige vermögende Prager Bürger überredete, das übrige dazuzusteuern. Froh über das Erreichte, erbot sich der Herzog selbst, nach Passau zu eilen und die Entlohnung des Heeres zu betreiben, das mit dem Einfall in Böhmen drohte; das Geld versprach der Kaiser, sowie es flüssig gemacht wäre, nebst einer Vollmacht dem Herzog durch einen Zahlmeister nachzuschicken.
Es war ein kalter Nachmittag im Dezember, als der Wagen des Herzogs, sich der Bischofsstadt nähernd, plötzlich angehalten wurde. Als der Herzog, um zu sehen, was es gäbe, sich aus dem Kutschenfenster beugte, erblickte er einen Haufen zerlumpter Männer, die Almosen heischten, und er erkannte nun wohl, dass er mitten in das Lager der Passauer geraten war. Viele von den Leuten glichen mehr Bettlern als Soldaten, hatten Weiberröcke und Tücher umgebunden, um sich vor der Kälte zu schützen, und die bloßen Füße, auf denen sie mühsam forthinkten, in alte Flicken gewickelt. Verdutzt und erschreckt über diesen erbärmlichen Anblick, verteilte der Herzog, was er an Münze bei sich hatte, und fragte, ob kein Leutnant oder Hauptmann da sei; denn diesem dachte er zu eröffnen, wer er sei, und ihn mit der baldigen Ankunft des Soldes zu vertrösten. Der Leutnant liege besoffen in seinem Zelte, wurde ihm mitgeteilt, er habe mit drei oder vier Soldaten einen Auszug in die nächsten Dörfer unternommen und ein Fäßlein Wein heimgebracht, jetzt müsse er den Rausch ausschlafen.
Hie und da brannte ein Holzfeuer, von dem feiner, bläulicher Rauch steil in die graue Schneeluft hinaufkletterte. Über einen großen, von Weiden und Erlen umstandenen Sumpf hatte sich eine Frosthaut gezogen, unter der es leise gluckste und polterte. Nachdem er sich aufmerksam umgesehen hatte, gab der Herzog dem Kutscher ein Zeichen, schnell weiterzufahren und sich durchaus nicht von den Heischenden oder Drohenden aufhalten zu lassen. In der bischöflichen Residenz fand er den Erzherzog Leopold mit den anderen hohen Offizieren, nämlich den Grafen Sulz und Althan, den Herren Trauttmansdorff und Ramée, die ihn höflich aufnahmen und bewirteten. Er hätte nicht gedacht, sagte der Herzog, dass es so böse im Lager aussehe; er könne den elenden Anblick nicht aus den Gedanken schlagen und sei froh, dass er das nahe Ende dieses kläglichen Zustandes ankündigen könne. Der Zahlmeister des Kaisers kam jedoch weder am nächsten noch an den folgenden Tagen, worauf der Erzherzog mit Sulz, Althan und Trauttmansdorff nach Prag abreiste, um, wie er sagte, sich nach dem Verbleib des Geldes zu erkundigen. Also blieb Heinrich Julius mit Ramée allein zurück, der ein wortkarger Gesellschafter und dem Herzoge schon durch sein Äußeres unheimlich war. Es ging nämlich durch sein eines Auge eine Narbe und verursachte, dass es von unten her aus einem Hinterhalt zu lauern schien, unabhängig von der Blickrichtung des anderen; infolgedessen war es unmöglich, aus seiner Miene etwas abzulesen, abgesehen davon, dass er auch absichtlich seine Gedanken verbergen zu wollen schien. Um sich das Zusammensein mit ihm zu verkürzen, schlug der Herzog ein Kartenspiel vor, worauf Ramée auch einging und wobei er fortwährend gewann. Er spielte schweigsam, rasch und sicher, strich schweigend das Geld ein und verteilte die Karten unaufhaltsam, wobei er den Herzog mit seinem heilen Auge unverwandt ansah. Obwohl diesen der andauernde Verlust wurmte, hielt er doch an sich und sagte nur einmal wie im Scherze, Ramée verstehe wohl die Kunst, die Karten mit den Fingern zu sehen. Nein, sagte Ramée, während ein diabolisches Lächeln um seinen Mund lauerte, er habe nur die Gewohnheit, vor dem Spiel dreimal auf die Karten zu klopfen und dabei für sich zu sprechen: ›Im Namen der heiligen Jungfrau‹; das helfe zum Gewinnen, der Herzog könne es auch versuchen. Der Herzog spielte und verlor daraufhin weiter, ohne etwas zu sagen, und sehnte den Tag herbei, wo der Zahlmeister aus Prag einträfe.
Endlich sagte Ramée, er müsse die Truppen nun in ein anderes Quartier führen, wenn sie nicht alle Hungers sterben sollten. Der Herzog habe ja nicht einmal eine Vollmacht, man könne nicht wissen, ob er wirklich einen Auftrag vom Kaiser empfangen habe. Wie er es wagen könne, seine fürstliche Ehre anzutasten, schrie der Herzog zornig; wer er sei, sich solcher Sprache gegen einen Reichsfürsten zu unterstehen! Der Herzog solle sich nicht aufregen, sagte Ramée, wenn das Geld komme, sei er bereit, ihn um Verzeihung zu bitten. Unterdessen möge er die Truppen beschwichtigen, die sich zusammengerottet hätten und ihren Sold verlangten. Dazu erklärte sich der Herzog bereit, rüstete sich, stieg zu Pferde und ließ sich von Ramée auf einen Platz führen, wo die Meuterer in einem Haufen zusammenstanden. Bei seinem Anblick erhob sich ein lautes Murren, Pfeifen und Aneinanderschlagen der Waffen, auch an drohenden Gebärden und Zurufen fehlte es nicht. Wütend sprang der Herzog vom Pferde, riss einem eine Trommel aus der Hand, schlug mit dem Griff seines Schwertes darauf und verschaffte sich endlich Gehör, worauf er sagte, die Truppen hätten zwar ein Recht auf ihren Sold, aber ihn auf diese meuterische1 Art zu verlangen, stehe rechtschaffenen Soldaten nicht zu. In zwei Tagen werde das Geld eintreffen, er stehe mit seinem fürstlichen Wort dafür, so lange sollten sie sich gedulden.
Nach Verlauf dieser Zeit suchte Ramée den Herzog auf und sagte mit seinem teuflischen Lächeln, wenn der Herzog nach Prag zurück wolle, biete er ihm ein Geleit von zuverlässigen Leuten an, die ihn auf verborgenen Wegen aus Passau führen sollten, damit er das Lager vermeide. Er für seinen Teil glaube wohl, dass der Herzog es ehrlich gemeint habe, die wilde Soldateska könne sich aber leicht einbilden, er habe ihnen eine Falle aufgestellt, und ihren Zorn an seiner Person auslassen, zumal er kein Katholik sei.
Trotz seines Misstrauens und heimlichen Ärgers entschloss sich der Herzog, das Anerbieten des Ramée anzunehmen, und machte sich bei einbrechender Dämmerung nach Prag auf. Die Pistole im Gürtel, folgte er zu Pferd zwei Bewaffneten, die ihn über Hügel und durch Wälder an einem vereisten, krachenden Fluss entlang verwachsene Pfade führten, nicht wenig froh, als er an der Grenze des Bistums wohlbehalten auf der gemeinen Heerstraße anlangte. In Prag warteten seiner neue Enttäuschungen und Widerwärtigkeiten, indem der Kaiser sich nicht sehen ließ und die böhmischen Stände ihn, den Herzog, mit Vorwürfen anfielen und ihr Geld von ihm zurückforderten, das sie auf sein Wort hergegeben hätten, das aber nicht auf den ihnen vorschwebenden Zweck verwandt sei.
1 aufgewiegelt <<<