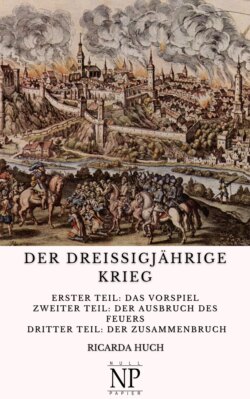Читать книгу Der Dreißigjährige Krieg - Ricarda Huch - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.
ОглавлениеWährend der junge Erzherzog Ferdinand von Steiermark zu Ingolstadt studierte, begab es sich an einem Festtage, dass er später als gewöhnlich zur Messe in die Kirche kam und den vorderen Stuhl, den er sonst innehatte, von seinem Vetter Maximilian, dem Sohne des Herzogs von Bayern, besetzt fand. Indem er diesen mit freundlichem Anlachen begrüßte, blieb er wartend vor ihm stehen, und da Maximilian nicht Miene machte, ihm den Platz zu überlassen, forderte er ihn leichten Tones dazu auf. Er wisse nicht, dass das Ferdinands Stuhl sei, antwortete Maximilian zögernd und kühl; dass er ihn bisher gehabt hätte, hindere nicht, dass heute er, Maximilian, ihn behalte, da er ihm einmal zuvorgekommen sei. »Mein Platz ist es«, entgegnete Ferdinand, »weil er als der vordere meinem Range gebührt, und lege ich auch als Freund und Vetter keinen Wert darauf, so bin ich es doch seit dem Tode meines Vaters meiner Würde schuldig, darauf zu bestehen.«
Hätte er gewusst, sagte Maximilian, dass Ferdinand es so auffasste, würde er ihm den Stuhl vorher nicht immer überlassen haben, was nur aus dem Grunde geschehen sei, weil er sich an der bayrischen Landesuniversität dem steiermärkischen Vetter gegenüber als Wirt gefühlt habe; nun werde ihm seine Höflichkeit als Unterwürfigkeit ausgelegt. Ein Herzog von Bayern sei so viel wie ein Erzherzog von Steiermark, vorzüglich auf bayrischem Gebiet, wo keinem Erzherzoge auch nur so viel wie eine Scheune oder ein Heustock gehöre.
Das könne man nicht wissen, entgegnete Ferdinand und lächelte; er gehöre zur kaiserlichen Familie und könne noch einmal Kaiser werden, wenn es Gott gefällig sei.
Der ältere Vetter, der, gerade gewachsen und sich steif haltend, auf den vor ihm stehenden, ein wenig schlotterigen Steiermärker herabzusehen schien, errötete vor Ärger, blieb aber kalt und sagte: »Ich etwa nicht? Es gibt kein Gesetz in der Güldenen Bulle, dass nicht auch ein Bayer zum Kaiser könnte erwählt werden.«
Die beiden Hofmeister, die bisher vergeblich dem Wortwechsel zu steuern versucht hatten, drangen nunmehr durch, der bayrische, indem er Maximilian flüsternd an den Befehl seines Vaters erinnerte, stets höflich gegen Ferdinand zu sein und auf alle Fälle in gutem Vernehmen mit ihm zu bleiben, während der steiermärkische Ferdinand mit dem Zorn seiner Mutter schreckte, die ihm streng befohlen hatte, dem Herzog von Bayern, ihrem Bruder, wie einem Vater zu gehorchen und Maximilian wie einen älteren Bruder zu respektieren. Der Gedanke daran, dass seine Mutter schon mehrmals gedroht hatte, ihn von Ingolstadt fortzunehmen, wie es der Kaiser und dessen Brüder, Ferdinands Oheime, wünschten, schlug seinen Hochmut nieder, und er verstand sich dazu, Maximilian zu bitten, er möge ihm den Stuhl, abgesehen von der Rangfrage, aus vetterlicher Freundschaft überlassen, weil er sich an ihn gewöhnt habe. Maximilian gab mit kühler Herablassung, aber im Grunde nicht ungern nach; denn inzwischen waren ihm Zweifel aufgestiegen, ob er nicht doch einem Habsburger gegenüber, der des Kaisers Neffe war, ein wenig zu weit gegangen sei. Während der kirchlichen Zeremonie gab sich Ferdinand ausgelassenen Späßen über einen der Geistlichen hin, der augenscheinlich den Schnupfen hatte und seine rotgeschwollene Nase mit dem reichgestickten Unterärmel seines Gewandes putzte; aber wie der Hofmeister seine Lustigkeit nicht zu dämpfen vermochte, so gelang es ihm nicht, Maximilian zum Lachen zu bringen.
An diesen Vorfall knüpfte sich ein langer, nicht unbeschwerlicher Briefwechsel zwischen Maximilians Vater, Herzog Wilhelm von Bayern, und dessen Schwester, der Erzherzogin Maria von Steiermark, Ferdinands Mutter, die sich herzlich liebten, obwohl die Heftigkeit der jüngeren Erzherzogin ihrem friedfertigen Bruder manche Nachgiebigkeit zumutete. Maria hielt ihre bayrische Familie für weit tüchtiger und verdienstlicher als die ihres Mannes, die sie im Stillen herzlich verachtete; allein da ihre Kinder nun einmal Habsburger waren, trotzte sie auf deren Titel und Rechte und gebärdete sich sogar dem Herzog gegenüber zuweilen als die Höhere, deren Ansprüchen ein jeder zu weichen habe. Da von ihren fünfzehn Kindern die meisten kränklich und unbegabt waren, machte ihr die Erziehung viel zu schaffen, umso mehr, als sie bei ihrem Manne wenig Unterstützung fand, im Gegenteil seine Trägheit, Gleichgültigkeit und Leichtfertigkeit beständig durch ihren Ernst und ihre Tatkraft ersetzen musste. Wenn sie bedachte, wie sie ihn stets hatte stoßen und treiben müssen, damit er den Anmaßungen seines Adels standhielt, wie sie hatte wehren müssen, wo er nachgeben wollte, wie sie mit Drohen, Keifen, Predigen und Intrigieren allem Gegenwirken der Stände zum Trotz Jesuiten und Kapuziner ins Land gebracht hatte, dass sie nunmehr allenthalben das wahre katholische Leben sprießen und um sich greifen sah, so mochte sie sich füglich von ihrer Wichtigkeit und Machtfülle durchdrungen fühlen. Auch hätte keines von ihren Kindern gewagt, ihr den Gehorsam zu weigern; aber das konnte sie doch nicht hindern, dass etwas habsburgisches Unkraut selbst in ihres Ferdinands gute Anlagen, die er von bayrischer Seite mitbekommen hatte, hineinwilderte.
Als er das erste Mal nach dem Tode des Vaters von Ingolstadt nach Hause kam, hoffte sie ihn etwas gereifter und männlicher zu finden; indessen musste sie ihm schon beim Eintritt seine Lustigkeit und Scherze mit der Dienerschaft als dem Trauerhause unziemlich verweisen. Sie überraschte ihn mit einem Geschenk aus dem Nachlasse des Vaters, einer reich mit Perlmutter und Elfenbein eingelegten Büchse, die der Nürnberger Künstler Jamnitzer verfertigt hatte; denn er sollte sie künftig an Stelle des Vaters zur Jagd begleiten. Der sechsjährige Leopold, der auch zur Jagd zu gehen verlangte, wurde im Hinblick auf seine Bestimmung zum geistlichen Stande mit einem Rosenkranz aus böhmischen Granaten getröstet, der neben dem Bette des verstorbenen Vaters gehangen hatte. Dies gab Anlass zu einer Rauferei, da Ferdinand den Kleinen auslachte und neckend sagte: »Lerne du nur fleißig beten, du kannst nicht zur Jagd gehen, denn du wirst Weiberröcke tragen und müsstest als ein Weib auf dem Sattel sitzen«, eine von den Anspielungen, mit denen die Geschwister den wilden Buben zu reizen liebten. In lautloser Wut stürzte sich Leopold auf den großen Bruder, warf ihn mit dem ersten Anlauf zu Boden und schlug den jämmerlich Schreienden mit der Faust auf den Kopf, indem er schrie: »Ich will dir auf deinen dreckigen Grind beten!«, bis Marias feste Hand den Knäuel auseinanderriss. Sie gab Leopold zwei Ohrfeigen, die eine wegen seiner Versündigung am heiligen Gebet, die andere, weil er seinen älteren Bruder, dem er Gehorsam schuldig sei, verprügelt habe; dann sich plötzlich zu Ferdinand wendend, der bei der Bestrafung seines Bruders zu wehklagen aufgehört und lachend zugesehen hatte, versetzte sie auch ihm eine, denn er sei nicht minder schuldig als Leopold, insofern er mit unziemlichen Neckereien den Anfang gemacht habe, wo er doch vielmehr den künftigen Priester in seinem Bruder ehren sollte. Dann wischte sie Leopold die Tränen ab, der unter dem Schluchzen wütende Blicke auf seinen Bruder schoss, reichte ihm einen Apfel und führte ihn in ein anderes Zimmer, wo ihn die Schwestern mit neugierigen Blicken und Fragen empfingen. Von der Zurückkehrenden bat sich Ferdinand, halb dreist, halb ängstlich, auch einen Apfel aus; Leopold werde von ihr verhätschelt, und das sei der Grund, warum er ihm nicht gehorche, er wisse wohl, dass die Mutter ihm alles hingehen lasse, die Ohrfeigen habe sie ihm ja auch gleich vergütet.
Es verhalte sich ganz anders, sagte Maria streng; eigentlich hätte sie ihn, Ferdinand, allein strafen sollen, denn nicht nur, dass er als der Ältere der Verständigere sein und ein gutes Beispiel geben sollte, hätte er, der Große, sich von dem tapferen Kleinen wie ein Feigling zu Boden schlagen und verprügeln lassen, dazu noch Zeter geschrien. Frömmigkeit sei zwar für einen christlichen Regenten die Hauptsache, und auch die katholischen Wissenschaften und die Historie seien ihm nützlich, aber die ritterlichen Übungen und eine stattliche, kriegerische Haltung dürfe er nicht vernachlässigen. Die Verwandten machten ihr Vorwürfe, dass sie ihn zu lange auf der Universität lasse, wo er nichts als gelehrtes Silbenstechen und Disputieren lerne.
Ferdinand sagte maulend, er nehme Reit- und Fechtstunden und habe schon große Fortschritte gemacht. Der päpstliche Nuntius, der kürzlich durch Ingolstadt gekommen sei und ihn in der Fechtschule gesehen habe, habe ihn mit dem blitzeschleudernden Apollo verglichen. Was hätten sich auch seine Oheime, die Erzherzöge, einzumischen? Sie, die Mutter, hätte allein zu bestimmen und allenfalls ihr Bruder, der alte Herzog von Bayern, ihnen beiden wolle er gern gehorchen.
Ganz besänftigt, hieß Maria ihren Sohn sich zu ihr setzen und sprach ihm vertraulich von ihren Sorgen und Plänen. Einen erbitterten Kampf habe sie führen müssen, bis man sie mit ihren Kindern im Schlosse zu Graz gelassen habe; man hätte sie am liebsten auf die Seite gestellt, nicht weil man an ihrer Kraft zweifelte, die Regentschaft zu führen, im Gegenteil, weil man ihre Entschlossenheit fürchte. Der Kaiser und seine Brüder seien zwar gut katholisch, das wolle sie ihnen nicht abstreiten, aber es fehle ihnen der Mut, den allein das reine Gewissen verleihen könne. Das sei ein beständiges Paktieren und Feilschen mit den Ketzern! Dadurch, dass man sie fürchtete, würden sie fürchterlich. Jetzt freilich blähten sie sich auf und spritzten ihr Gift dahin und dorthin.
Aus einem Schubfach ihres Schreibtisches holte sie Briefe, die sie von ihrer Tochter Anna, der Gemahlin des Polenkönigs Sigismund, erhalten hatte. Sigismund sei ein guter, frommer Mann, sagte sie, und ihr als Eidam wert, aber allzu sanftmütig und den boshaften Schweden nicht gewachsen, wie er denn ein feierliches Versprechen gegeben habe, die lutherische Religion in Schweden zu erhalten und zu schützen; denn sonst hätten ihm die unbotmäßigen Stände nicht huldigen wollen. Dahinter stecke niemand anders als Karl, sein Oheim, der, als ein echter Abkömmling der bösen, wölfischen Wasabrut, selbst auf den Thron spekuliere. Nachdem nun Sigismund das leidige Versprechen einmal gegeben habe, solle er sich wenigstens nicht daran gebunden halten; denn den Untertanen stehe keinerlei Recht zu, den ihnen von Gott gesetzten Herren Eide und Bündnisse abzunehmen, sondern als gottlose Räuber solle er sie einfach zu Paaren treiben. Auch sei Anna sehr traurig darüber, dass es so gekommen sei und dass sie sich von den lutherischen Affen hätte müssen krönen und salben lassen, welches doch nicht mehr zu bedeuten habe, als wenn man von einem Bader wegen eines Aussatzes oder anderen Schadens geschmiert werde. Könnte sie nur allen ihren Mut und ihre Überzeugung einflößen, so würden die Unruhen und Empörungen, das Geschrei der tollköpfigen Bauern um freie Religionsübung und das Lärmen der Prädikanten auf den Kanzeln einmal aufhören. Die Bauern gehörten an den Pflug, die Bürger in ihre Werkstatt und die Prädikanten an den Galgen; hielte man sich daran, so würde der liebe Friede und die alte Ordnung bald wieder hergestellt sein. Freilich müsse zuerst der übermütige Adel gebeugt werden, damit das ketzerische Volk keinen Rückhalt mehr an ihm finden könne.
Er wolle schon Ordnung schaffen, sagte Ferdinand, der sich bemüht hatte, aufmerksam zuzuhören; wenn er drei Jahre regiert hätte, solle keiner mehr im Lande sein, der nicht das Knie beugte, wenn die Prozession vorübergehe. Er wolle den großen Prahlhansen schon ein Gebiss ins Maul klemmen, die störrischen Ketzeresel sollten ihm Säcke in seine Mühle tragen.
Maria zählte einige Herren vom Adel auf, die ihr am meisten zu schaffen machten, die Räknitz, die Praunfalk und die Windischgrätz. Bereits hätten sie sich beim Alten, nämlich beim Kaiser, beklagt, dass sie sie Untertanen geheißen hätte; und doch müssten sie wohl Untertanen sein, wenn der Fürst der Herr sei. Sie steckten mit allen Ketzern und Aufrührern in Österreich, Schlesien und Mähren, ja auch in Böhmen und Ungarn zusammen, wo es an dergleichen nie gefehlt habe, und möchten etwa gar freie Schweizer oder Holländer sein. Ein hübscher Staat ohne göttliches und irdisches Haupt, eine schöne Ordnung, wo die Untertanen mit ihrem kurzen Verstande Gott und die heilige Kirche lästern dürften, ohne dass einer sie beim Schopfe nehme. Sie wisse auch im Reich draußen manch einen, der dabei sein möchte.
»Sie werden schon zu Kreuze kriechen, wenn der Ferdinand die Zügel führt«, sagte dieser lachend.
Wenn sie nur erreichen könnte, meinte Maria, dass er ein paar Jahre früher mündig erklärt werde; die habsburgische Vormundschaft sei doch nur eine Misswirtschaft. Es komme darauf an, dass er sich seinem Oheim, dem Kaiser Rudolf, persönlich vorstellen könne; der Rat Rumpf, der alles beim Alten vermöge, sei ein guter Freund von ihr und habe sich bereit erklärt, einen solchen Besuch zu vermitteln. Inzwischen müsse Ferdinand sich in körperlichen Übungen vervollkommnen, damit er eine anständige Haltung bekomme, nicht wie ein Hampelmann einhergehe, müsse sich ein ernstes, aufrichtiges, bescheidenes Betragen angewöhnen, um auf Rudolf einen günstigen Eindruck zu machen, denn davon hänge nun einmal alles ab.
»Ich bin gut genug für den alten Unflat!« sagte Ferdinand, indem er die lange Unterlippe hängen ließ, unterbrach sich aber sogleich, von der Mutter derb am Arme geschüttelt. Er hätte eine Maulschelle verdient, rief sie zornig; wie er so frech von der kaiserlichen Majestät reden dürfe! Wenn das seine jüngeren Geschwister gehört hätten!
Sie hätten es oft genug von ihr gehört, brummte Ferdinand, wie er es auch nicht aus sich selber habe. Sie habe gesagt, dass er sich Huren halte und mit gemeinen Leuten und Ketzern saufe und schändliche Künste treibe.
»Dir ziemt nicht, alles zu sagen, was mir ziemt«, sagte sie unwirsch, »denn du kannst nicht unterscheiden, wo und wann du den Mund auftun sollst.« Sie sei Rudolfs Freundin nie gewesen, aber er sei nun einmal der Kaiser und habe ihr Schicksal in seinen Händen, darum müsse Ferdinand sich Mühe geben, ihm zu gefallen.
Schließlich eröffnete Maria ihrem Sohne einen Ausblick in die Zukunft: Bis jetzt hätten weder der Kaiser noch seine lebenden Brüder einen Erben; er sowie Matthias, Ernst und Albrecht wären unvermählt, Maximilian dürfe als Deutschordensmeister nicht heiraten, der Sohn Ferdinands von Tirol sei als Kind der Welserin unebenbürtig, nur der jüngste Bruder, Karl, sein verstorbener Vater, habe Söhne in der Ehe erzeugt. Ersichtlich stehe das Haus unter der Malediktion Gottes, die es sich durch Lauheit im Glauben zugezogen habe, und so wäre es nicht unmöglich, dass noch einmal alle habsburgischen Länder auf ihn kämen. Wenn Gott es so füge, sei dabei jedenfalls seine Absicht, einen frommen Glaubenshelden an die Herrschaft zu bringen, der die katholische Kirche wiederherstellen werde, und obschon er natürlicherweise seinen Oheimen nichts Übles wünschen dürfe, vielmehr fortfahren solle, für ihre Gesundheit und Fortpflanzung zu beten, so müsse er sich doch im Stillen auf sein großes Amt vorbereiten, falls Gott im Schilde führe, ihn dahin zu erhöhen.
Ferdinand war ein wenig rot geworden; aber er sagte leichthin, warum sollte denn der Kaiser nicht noch heiraten und Nachkommenschaft erzielen, da er doch Hurenkinder habe. Auch Matthias, Ernst und Albrecht wären noch in den Jahren, sich zu vermählen; mit so weitaussehenden Sachen wolle er sich nicht ernstlich abgeben.
Dank den Anweisungen, die sein Beschützer, Minister Rumpf, dem Knaben gab, wie auch durch seine natürliche Unbefangenheit und Schlauheit fiel Ferdinands Besuch am Kaiserhofe gut aus; überhaupt hatte der Kaiser an jungen Leuten, die sich ihm mit bescheidener Bewunderung und Ehrerbietung näherten, Wohlgefallen und liebte es, Späße mit ihnen zu machen, bei denen er eine anmutig überlegene Freundlichkeit entfalten konnte. Ferdinand kehrte nicht wenig gehoben nach Graz zurück und musste sich manche Neckerei von Seiten der Geschwister gefallen lassen, die das pomphafte Wesen an dem Dämel, wie sie Ferdinand nannten, der beim Spiel der Albernste war, nicht leiden konnten.
Es schien in der Tat, als wolle Gott das Haus der Erzherzogin Maria erhöhen; denn nach vielen Weiterungen, die die Launenhaftigkeit des greisen Königs von Spanien, Philipps II., verursachte, kam endlich die Verlobung zwischen seinem Sohne Philipp, dem Thronfolger, und ihrer Tochter, der kleinen blonden Margareta, zustande. Maria, die das Reisen außerordentlich liebte, geleitete sie selbst nach Madrid und hatte große Mühe, das kindische Wesen der Tochter vor den so anders gearteten Spaniern zu verbergen. Als die erste spanische Gesandtschaft die Reisenden unterwegs antraf und der Prinzessin ein auf Elfenbein gemaltes Miniaturbild ihres Bräutigams überreichte, hielt sie den Ausbruch ihrer Lustigkeit unter dem strengen Blick der Mutter notdürftig zurück; sowie sie aber allein waren, warf sie sich auf einen Stuhl und rief unmäßig lachend: »So also sieht der Lipperli aus! Und dies soll mein Mann sein! Er gleicht einer Quarkrübe! Ich werde ihm ein Lätzlein mitbringen, denn er kann gewiss noch nicht sauber essen.«
Dass sie selbst noch in die Kinderstube gehöre, sagte Maria strafend, beweise ihr Benehmen. Dann betrachtete sie das Bildchen, stellte einige Familienähnlichkeit fest und meinte, es sei überhaupt fraglich, ob der Prinz selbst dazu gesessen habe; denn der alte König habe seine Kinder nicht mehr konterfeien lassen, seit ihm mehrere bald nach dem Abmalen gestorben seien.
Ob denn etwa die Maler in Spanien als Zauberer verbrannt würden? fragte die Kleine neugierig. Es gehe eben seltsam zu in Spanien, sagte Maria, der alte König habe zuletzt voll Bosheit und Narrheit gesteckt, es komme ihr wohl, dass er noch gerade gestorben sei. Die spanischen Verwandten seien alle ein wenig verstockt und verdreht, man heiße das die spanische Krankheit, und sie könne es sich gut vorstellen, wenn sie die widerwärtigen Spanier sähe, in deren Gesellschaft es einem eng ums Herz werde. Zwischen dieser gelben, langnasigen, ranzigen Nation und den Juden sei kaum ein Unterschied.
Vielleicht bekomme sie diese Krankheit auch, wenn sie erst in Spanien sei, sagte Margareta, so wolle sie sich bis dahin noch recht lustig machen. Damit war auch Maria einverstanden. Die vielen Geschenke, die den hohen Reisenden unterwegs von Fürsten und Städten überreicht wurden, die Kostbarkeiten und Heiligtümer, die die Erzherzogin einkaufte, wurden abends beim Glückstopf verspielt in der Art, dass für die daheim zurückgelassenen Kinder mit gesetzt wurde. In Mailand gefiel der Kleinen nächst den vielen Kirchen und Klöstern ein Flohtheater am besten, und sie lag der Mutter mit dringenden Bitten an, es ihr zu kaufen. Indessen schlug es ihr Maria ab, weil die leidigen Spanier, wenn sie dahinterkämen, es ihr übel auslegen könnten, obwohl sie selbst gewiss mehr Flöhe, Läuse und Wanzen hätten als ein Bauernkind auf dem Miste.
Großen Trost fand Maria in der Begleitung des Hans Ulrich von Eggenberg, der, aus einer lutherischen, durch Geldgeschäfte reich gewordenen Familie stammend, sich, seit er erwachsen war, zur katholischen Kirche gehalten hatte, kürzlich vom Kaiser in den Freiherrnstand erhoben und bei der Erzherzogin und ihrer ganzen Familie sehr beliebt war. Seine offenen blauen Augen und sein gemütliches Wesen versinnbildlichten ihr unter den Fremden die deutsche Heimat. Wenn sie eine Weile mit ihm geschwatzt habe, sagte sie zu ihm, sei ihr zumut, als sei sie daheim im Walde spaziert und habe Eichen und Buchen rauschen hören, und hätte sie nicht von Zeit zu Zeit eine solche Erquickung, möchte sie es nicht so lange zwischen den stinkenden spanischen Zwiebelfeldern aushalten. Auch die kleine Margareta sagte, sie würde lieber nach Madrid reisen, wenn Eggenberg noch kein Weib hätte und König von Spanien wäre; worauf Eggenberg erwiderte, er würde ihr dann gewiss auch so viele Flöhe fangen, dass die Hofdamen sich ihren Bedarf aus Aranjuez müssten kommen lassen.
Gleichzeitig fand eine andere habsburgische Vermählung statt, durch welche Ferdinands Aussichten einen unerwarteten Niederschlag erlitten; sein Oheim Albrecht nämlich heiratete die Prinzessin Isabella von Spanien, die einzige, wegen ihres Verstandes und ihrer Tüchtigkeit berühmte Tochter Philipps II., die seit so vielen Jahren mit ihrem Vetter Rudolf, dem Kaiser, verlobt gewesen war, dass man sich gewöhnt hatte, dies als einen dauernden Zustand zu betrachten. Die Geschwister kicherten und warfen listige Blicke auf Ferdinand, Leopold streckte ihm hinter dem Rücken der Mutter die Zunge aus. Da er seine Wut an dem jüngeren Bruder nicht selbst auslassen konnte, der eine breite Brust und starke Muskeln bekommen hatte, machte Ferdinand die Mutter aufmerksam, die dann auch mit der Strafe nicht zögerte. Einen solchen Rüpel könne sie den Passauern nicht als Bischof anbieten, fuhr sie Leopold an; sie müsse so von ihrer eigenen Familie genug darüber hören, dass sie alle geistlichen Würden für ihren unmündigen Buben wolle. »Ich speie Euch auf den Passauer Bischofshut!« sagte Leopold trotzig, worauf er mit einem Gebetbuche eingesperrt wurde, keinen anderen Besuch als den des Beichtvaters empfangen durfte und durch mehrtägiges Fasten auf die seinem Stande geziemende Sanftmut heruntergebracht wurde.
Merklichere Aufregung und Veränderung rief die Nachricht von der Verlobung am Hofe zu Prag hervor. Rudolf nämlich hatte sich nie entschließen können, die spanische Braut zu heiraten, aus Scheu vor jeder Fessel sowohl, wie weil ihr fester und gebietender Charakter ihm ein unbestimmtes Gefühl von allerlei zu nehmenden Rücksichten einflößte, dann auch, weil er das gewohnte Zusammenleben mit einer Frau aus geringerem Stande, die ihm mehrere Kinder geboren hatte und die jede seiner Launen und Begierden gehen ließ, durchaus nicht hätte aufgeben mögen. Andererseits war ihm das Bewusstsein wert, die Prinzessin jeden Augenblick heimführen zu können, und es schien ihm nicht anders, als hätte sie eine frevelhafte Treulosigkeit begangen, sein Bruder aber sich ein Stück von seinem Besitztum angeeignet. Der Schmerz wurde dadurch verbittert, dass Rudolf durch seinen Kammerdiener Matkowsky einige Einzelheiten der vom Minister Rumpf geführten diplomatischen Verhandlungen erfuhr, die der Vermählung vorangegangen waren. Rumpf, von welchem man wusste, dass er das ganze Vertrauen des Kaisers besaß und das Treiben am Hofe durch und durch kannte, hatte dem spanischen Gesandten mitgeteilt, von einer Heirat mit dem Kaiser müsse die Prinzessin gänzlich absehen, er könne keinen Entschluss fassen, lasse alles gehen, wie es wolle, kümmere sich nur um sein leibliches Wohlergehen und etliche Liebhabereien und sei überhaupt zum Regieren unfähiger als ein abgerichteter Pudel.
Rudolfs Erstaunen über diese Beleidigung seiner Majestät ging in einen Zorn über, den er anfänglich nur im Blute des Schuldigen kühlen zu können glaubte, indessen beschwor ihn Matkowsky selbst, von einem Hochverratsprozess abzusehen, der die verkleinernde Äußerung des Ministers weiterverbreiten würde. Demnach begnügte sich Rudolf damit, den Nichtsahnenden mit allen Zeichen der Ungnade zu entlassen, sodass er sich vor Untergang der scheinenden Sonne aus Prag zu entfernen habe. Diese nachdrückliche Justiz, die sich niemand zu erklären wusste, verbreitete Schrecken und unbestimmte Erwartung; aber es folgte zunächst nichts als eine große Stille. Da für den gestürzten Minister, durch dessen Hand alle Geschäfte gegangen waren, nicht sogleich ein Ersatz zur Stelle war, blieb alles liegen; der Kaiser erteilte weder Audienzen noch unterzeichnete er Erlasse und Handschreiben, und man hätte glauben können, er sei gestorben, wenn sich nicht hie und da sein blasses Gesicht an einem Fenster des Schlosses gezeigt hätte. Der Böhme Matkowsky war der einzige, den er jederzeit gern um sich hatte, und ihm erzählte er unter Tränen, wie er seit seinen Jünglingsjahren die Prinzessin Isabella geliebt habe, wie aber ihr Vater, Philipp II., sich geweigert hätte, ihm das Herzogtum Mailand als Mitgift zu geben, worauf er als Kaiser und Mehrer des Reichs hätte bestehen müssen.
Matkowskys williges Zuhören und herzliche Rührung taten ihm wohl, sodass er seinerseits dessen Berichte gern annahm, der, als Böhmischer Bruder ein gewissenhafter Bekenner der evangelischen Religion, beteuerte, seine Glaubensgenossen blickten auf den Kaiser wie auf ihren Heiland und trügen seine Ungnade ergeben, während er für die Katholiken nur ein Mittel wäre, dessen sie sich bedienten, um zu herrschen, und dessen sie sich zu entledigen versuchen würden, wenn er ihnen nicht in allem zu Willen wäre.
Eines Abends begab sich der Kaiser in ein gewisses Turmstübchen, wo seine Goldmacher und Künstler arbeiteten, unter denen er sich mit Vorliebe aufzuhalten pflegte. Er saß mit halbgeschlossenen Augen in einem Lehnstuhl, während die Männer unter sich fortplauderten, weil sie wussten, dass ihm das angenehm war. Der Glasschneider Lehmann und sein Schüler Georg Schwanhard waren damit beschäftigt, eine Ansicht der Stadt Nürnberg in einen Pokal zu schneiden, obwohl die feine Arbeit beim Kerzenlichte für ihre Augen anstrengend sein mochte, einer knetete und mischte Wachs an einer Flamme, und ein anderer sortierte einen Haufen Edelsteine. Eine Tochter des Kaisers, ein üppiges blondes Mädchen, saß auf einem Schemel neben dem Ofen des Goldmachers und starrte verträumt in die Pfanne, wo sein blankes Gemenge brodelte. Durch ein offenes Fenster strömten die Düfte des Sommers und der unendliche Gesang einer in den dicken Gebüschen des Burggrabens verborgenen Nachtigall. Meister Vianen, der dem Fenster zunächst saß, erzählte halblaut, dass er sich lange bemüht habe, eine künstliche Nachtigall herzustellen, dass das Vöglein aus Silber und Schmelz ihm auch nett gelungen sei, dass aber die Flöte, die er hineingesetzt habe, dem süßschmetternden Ton des wirklichen Tieres nicht gleichgekommen sei, was ihm jetzt besonders auffalle, da er es höre. »Du wärest der Herrgott«, sagte Kaspar Lehmann, »wenn du eine lebendige Stimme machen könntest, die aus einem lebendigen Herzen kommt.« Gerade jetzt wurde der wohllautende Gesang durch ein schrilles Glockenzeichen unterbrochen, das den Kaiser zusammenfahren machte; Matkowsky erklärte, es komme aus dem Kapuzinerkloster, das unterhalb des Schlosses neu errichtet worden sei. Zu viele Maulwurfshügel schadeten dem Felde, sagte Lehmann leise lachend; aber wenn die Kapuziner auch Bettler und Müßiggänger wären, so gingen sie doch wenigstens nicht mit Gift und Dolch um wie die Jesuiten.
So ungefährlich wären die Kapuziner auch nicht, sagte Matkowsky, er habe von seinem Vater gräuliche Geschichten darüber erzählen hören. Zu der Zeit, als in Znaim ein Kapuzinerkloster gegründet worden sei, habe es sich begeben, dass der Sohn eines evangelischen Ratsherrn, der diese Gründung bekämpft gehabt habe, von einer sonderbaren Krankheit befallen worden sei, gegen die kein Arzt etwas habe ausrichten können. Allmählich sei es allen aufgefallen, dass der Kranke immer zu der Zeit von den Krämpfen heimgesucht worden sei, wenn der Chorgesang im neuen Kapuzinerkloster begonnen habe, das dem Hause des Ratsherrn benachbart gewesen sei. Dieser, ein beherzter Mann, habe sich denn einmal zur Nachtzeit in das Kloster geschlichen und sei ungesehen durch den dunklen Kreuzgang bis an das Chor der Kirche gekommen. Da wären die Mönche beim trüben Licht eines Lämpchens unter dem Altar um ein Wachsbild gehockt und hätten mit hohler Stimme Beschwörungen gesungen, und bei gewissen Stellen hätten sich alle erhoben und mit langen Nadeln in die Figur hineingestochen. Nach und nach hätten sich die Augen des Ratsherrn an die Dunkelheit gewöhnt, und da hätte er erkannt, dass das wächserne Bild ihn selbst darstelle, worauf ihn anfänglich das Entsetzen so gelähmt hätte, dass er sich nicht von der Stelle hätte bewegen können, obwohl ihm von der Anstrengung der Schweiß in Bächen über die Stirne geronnen sei. Endlich habe ihn ein Stoßgebet freigemacht, sodass er sich habe retten können, aber im Laufen habe er die höllischen Kapuziner hinter sich her klappern hören, und zu Hause angekommen, sei er in Krämpfe verfallen und stracks gestorben, nachdem er noch habe erzählen können, was ihm begegnet sei.
Während des Gesprächs, das die Erzählung angeregt hatte, stand der Kaiser plötzlich auf und streckte mit angstvoller Gebärde den Arm nach dem Fenster aus, worauf Matkowsky zu ihm eilte und ihn dicht an das Fenster zog in der Meinung, Rudolf fühle sich engbrüstig und bedürfe frischer Luft. Der Kaiser jedoch wandte sich voll Schrecken fort und befahl Matkowsky, er solle ihn in den sogenannten Kaisersaal hinunterführen, der im unteren Geschoss lag und wo seine Sammlung von Kunstgegenständen und Kuriositäten aufgestellt war. Die Tochter, für die der prächtige Saal, der sich ihr nur selten auftat, etwas besonders Anziehendes hatte, sprang auf und wollte, sich an den Kaiser drängend, mitgenommen werden; aber er stieß sie von sich und befahl ihr, heimzugehen und sich zu Bette zu legen. »Warum ist sie hier?« fragte er böse. »Ich habe gesagt, dass ich das Hurenvolk nicht um mich sehen will.« Unten im Saale wühlte er, während Matkowsky mit einer Fackel leuchtete, unter einem Haufen von Korallen, Erzstücken, Wurzeln und anderen Seltsamkeiten. Er suche die Meernuss, sagte er, die der Doria ihm kürzlich zugeschickt habe und die den, der sie bei sich trage, gegen Zauberei beschütze. Matkowsky, der ängstliche Blicke auf die Schatten warf, die von ihren Gestalten auf die weiße Wand fielen, murmelte indessen Gebete und flehte den Kaiser an, einzustimmen, denn das sei das wirksamste Mittel.
Endlich gelang es ihm, den Erschöpften zu Bette zu bringen; aber am folgenden Abend begann die Unruhe von Neuem und so heftig, dass er selbst nach einem seiner Leibärzte verlangte. Doktor Altmanstetter verordnete dem Kaiser ohne Besinnen einen starken Schlaftrunk, denn Schlaf sei das einzige, was ihm fehle. Rudolf sah ihn erschreckt an und sagte: Trinken? Er könne ja nicht trinken, da ihm der Bauch nach vorne und die Brust nach hinten stehe. Ob er es nicht bemerkt habe? Die Kapuziner hätten ihn so verdreht. »Die Sache wollen wir unverweilt ins reine bringen!« sagte Doktor Altmanstetter lachend, nahm den Kaiser um den Leib, drehte und rollte ihn mehrmals hin und her und stellte ihn dann fest auf die Beine, indem er triumphierend ausrief: »Nun fehlt kein Haarbreit mehr an der rechtmäßigen Figuration!« Dann ließ er eine Kanne Bier kommen und trank dem Kaiser zu, der ihm Bescheid gab, lustig und gesprächig wurde und nach kurzer Zeit in tiefen Schlaf fiel. Aber derselbe währte nicht lange, und am folgenden Abend zeigten sich ähnliche Erscheinungen. Zuweilen wurde der Kaiser zornig, weil ohne sein Vorwissen Klöster gegründet würden, wollte wissen, wer daran schuld sei, und drohte mit Strafen, damit man erführe, dass er der Herr sei. Dann wieder zog er Matkowsky in einen Winkel und fragte ihn aus, ob die Kapuziner wohl um Geld jemanden totbeten würden oder ob sie seinem Bruder Albrecht die Manneskraft abzaubern könnten, wenn es ihnen befohlen würde.
Die Nachricht von der seltsamen Krankheit des Kaisers verbreitete sich bald und gab in der Familie zu sorglichen Betrachtungen Anlass. Schon längst hatte man dort gewünscht, dass der kinderlose Monarch einen Nachfolger ernenne und womöglich nach dem Brauch bei Lebzeiten zum römischen König wählen lasse, damit bei seinem allfälligen Tode nicht die Evangelischen, die, wie man wusste, dem habsburgischen Hause abhold waren, die Zwischenzeit für ihre Absichten ausnützen könnten. Sie hatten indessen doch nicht darauf zu dringen gewagt, weil bekannt war, dass der Kaiser Einmischungen seiner Brüder nicht liebte, besonders aber durch Anspielungen auf die Möglichkeit seines Sterbens gereizt wurde. Jetzt jedoch wurden alle der Meinung, dass längeres Zuwarten hochgefährlich sei, und namentlich der zunächst Betroffene, Matthias, erklärte nachdrücklich, etwas unternehmen zu wollen. In seiner Jugend war Matthias ein fröhlicher Herr gewesen und hatte seines älteren vorsichtigen Bruders Missfallen erregt, weil er ein wenig fahrlässig in den Tag hineinlebte, nur bedacht, zu Gelde zu kommen, um sein planloses Dasein zu bestreiten. Die Anläufe, die er hie und da nahm, um seine Würde geltend zu machen, verliefen stets im Sande und nahmen sich hernach wie Grillen aus, die der Beachtung nicht wert waren; im ganzen war er es zufrieden, dem kaiserlichen Bruder aus dem Wege zu gehen. Seit er aber Statthalter von Österreich geworden war und Khlesl, der Bischof von Wien, sich seiner bemächtigt hatte, fing er an die Rolle des künftigen Kaisers zu spielen, wie sie Khlesl, der aus einem lutherischen Wiener Bäckerssohn beinahe die einflussreichste Person in Österreich geworden war, ihm einblies. »Gehen Sie nach Prag«, sagte ihm Khlesl, »und verlangen Sie vom Kaiser Audienz. Sie dürfen sich nicht abschrecken lassen, wenn er Sie abweist, am Ende muss er den Bruder doch vorlassen. Treten Sie dann ehrerbietig auf, aber fest, im Bewusstsein des Rechtes. Der Kaiser ist ein Schwächling und hat ein böses Gewissen, ein redlicher Fürst muss leicht mit ihm umspringen können.« Auch mit Verhaltungsmaßregeln für den Verkehr mit dem evangelischen böhmischen Adel versah ihn Khlesl. »Die Ketzer werden Ihnen alle zufallen, denn sie sind nun einmal der Meinung, Sie glichen Ihrem Herrn Vater, dem hochseligen Kaiser Maximilian, und wären heimlich den Protestanten hold. Benützen Sie das getrost; denn warum sollten Sie aus dem Irrtum oder der Dummheit rebellischer Untertanen nicht Vorteil ziehen? Nur einen schriftlichen Vertrag dürfen Sie nicht unterzeichnen und überhaupt in keiner Weise sich förmlich binden, sonst aber sollen Sie gegen jedermann leutselig, kaiserlich, willfährig sein. Kommt es nachher anders, so ist der Khlesl da, der alles auf sich nimmt. Ich mache mir nichts aus ihrem Toben; aber ich will nicht sterben, bevor ich nicht die habsburgischen Lande allesamt unter dasselbe katholische Hütlein gebracht habe.«
Am liebsten wäre Khlesl selbst nach Prag gegangen, um alles einzuleiten; aber er wusste, dass er in dem hussitischen Lande unbeliebt war und dass er seiner Sache schaden könnte, wenn er zu früh in den Vordergrund trat. So machte sich denn Matthias allein auf und setzte sich mit der spanischen Partei und dem Beichtvater des Kaisers in Verbindung. Dieser, ein betriebsamer Mann, der die Seelen seiner Zöglinge so gut kannte, wie etwa ein Koch die Eigenheit, Tüchtigkeit und Verwendbarkeit seiner Schüsseln und Pfannen unterscheidet, ging auf die Absichten des Matthias umso verständnisvoller ein, als er ein Spanier war und Spanien eben nicht in gutem Vernehmen mit Rudolf stand. Bei nächster Gelegenheit stellte er dem Kaiser seine Pflicht vor, seinen Bruder Matthias wie einen Sohn zu lieben, was er doch als sein Nachfolger auch dem Herkommen gemäß sei. Als er das innere Widerstreben des Kaisers spürte, machte er eine geschickte Wendung, sprach missbilligend von dem Neid und der Herrschbegierde des Matthias und entlockte ihm dadurch am Ende das Zugeständnis, dass er seinem Bruder den Tod wünsche. Kaum hatte der Kaiser die Worte ausgesprochen, als sein Äußeres sich zu verändern begann; seine Augen wankten einige Augenblicke unstet hin und her und hefteten sich dann starr auf den Geistlichen, bis sie sich plötzlich nach oben verdrehten, seine Arme und Beine durchfuhr ein Zucken. Zuerst dachte der Beichtvater, dies sei ein Anfall von Wut oder eine Machination, um das eben Gesagte als in der Besinnungslosigkeit von sich gegeben erscheinen zu lassen oder um weiteren Fragen zu entgehen; aber die abscheulich verzerrten Züge und hin und her zuckenden Gliedmaßen schienen doch nicht willkürlich hervorgerufen werden zu können, und so rief er denn Arzt und Dienerschaft und versuchte inzwischen mit Beten gegen das Teufelswerk anzukämpfen, was da im Spiele zu sein schien.
Nach Verlauf einiger Wochen erreichte zwar Matthias eine Audienz; aber nicht ohne dass er sich zuvor verpflichtet hatte, ein von den Räten aufgesetztes und von seinem kaiserlichen Bruder gebilligtes Gespräch einzuhalten, welches nur die allgemeinen Fragen des beiderseitigen Wohlergehens und der gegenseitigen Geneigtheit beziehungsweise Devotion berührte. Dagegen versicherten die Räte, welche beträchtliche Summen von Matthias empfangen hatten, um die Zusammenkunft zuwege zu bringen, sie würden die Angelegenheit, deren hohe Wichtigkeit offenkundig sei, in dienstwillige Überlegung ziehen, und zweifelten nicht, dass der Kaiser sich willig finden lassen würde, das Notwendige zu verfügen; der Erzherzog werde mit seinem fürstlichen Verstande begreifen, dass eine so weitaussehende Sache nicht von heute auf morgen könne entschieden werden, sondern fürsorglich und achtsam von allen Seiten müsse erwogen werden.