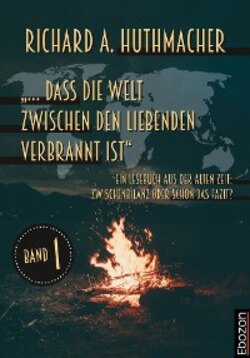Читать книгу „… dass die Welt zwischen den Liebenden verbrannt ist“ - Richard A. Huthmacher - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
„ALTE LIEBE ROSTET NICHT“: HANNAH ARENDT – MARTIN HEIDEGGER – KARL JASPERS
ОглавлениеLiebe,
habe gesehen, dass der Film über Hannah Arendt ins Kino kommt (die Sukowa in der Hauptrolle, Regie: Margarete von Trotta). In den achtziger oder neunziger Jahren, so genau weiß ich es nicht mehr, habe ich die Arendt-Biographie von Elisabeth Young-Bruehl gelesen, in der, soweit mir bekannt, erstmals die Liebesbeziehung zwischen Arendt und Heidegger thematisiert wurde. Bekanntlich rostet alte Liebe nicht; jedenfalls blieb die nach Amerika emigrierte Jüdin Arendt dem Nazi-Kollaborateur Heidegger (entschuldige, aber so sehe ich den Sachverhalt, man ist dafür oder dagegen) ihr Leben lang verbunden, ebenso wie Jaspers, ihrem Doktorvater, der seinerseits, ursprünglich ebenfalls mit Heidegger befreundet und mit einer jüdischen Frau verheiratet (von der er sich, allem Druck zuwider, nicht scheiden ließ), nach Heideggers berühmt-berüchtigter Freiburger Rektoratsrede, dem Kniefall vor den Nazis (als armer Bub von der schwäbischen Alb will man schließlich was werden; so einfach sind oft die Dinge, allem „philosophischen Überbau“ zum Trotz), den Kontakt zu Heidegger abbrach und sich nach dem Krieg für ein befristetes Lehrverbot von Heidegger aussprach, das dann tatsächlich, soweit mir erinnerlich bis 1951, verhängt wurde.
Jaspers schreibt diesbezüglich (Karl Jaspers an Martin Heidegger am 6. Februar 1949): „Die unendliche Trauer seit 1933 und der gegenwärtige Zustand, in dem meine deutsche Seele nur immer mehr leidet, haben uns nicht verbunden, sondern stillschweigend getrennt. Das Ungeheure, das etwas ganz anderes ist als nur Politik, hat in den langen Jahren meiner Ächtung und Lebensbedrohung kein entsprechendes Wort zwischen uns laut werden lassen. Als Menschen sind wir uns ferngerückt.“
Zwar grenzt sich auch Arendt (zunächst) in aller Deutlichkeit von Heidegger ab, so in ihrem berühmten Aufsatz von 1946: „Was ist Existenzphilosophie”, wo sie nachzuweisen versucht, dass die Hinwendung Heideggers zum Nationalsozialismus in seinem Denken angelegt ist. Da sie wisse, dass ein von Heidegger unterschriebener Rundbrief (in dem er seinem „Lehrer und Freund“ Husserl verboten habe, die Fakultät zu betreten, weil er Jude war), diesen, letzteren, bis ins Mark getroffen habe, könne sie nicht umhin, „Heidegger für einen potentiellen Mörder zu halten”. Später indes (1969, zum 80. Geburtstag Heideggers) spricht sie lediglich von einer “déformation professionelle” und einem Irrtum, den Heidegger später – im Gegensatz zu vielen anderen – eingesehen habe.
Wahrlich, eine seltsame, faszinierende Liebesgeschichte, die zwischen Arend und Heidegger, vergleichbar der zwischen Sartre und Beauvoir oder Nitzsche und Lou Salome.
Und ein seltsames Paar: Auf der einen Seite Martin Heidegger, bäuerlicher Provenienz, mit dem Nationalsozialismus paktierend, Demokratie und Moderne skeptisch bis ablehnend gegenüberstehend; auf der anderen Seite Hannah Arend, die jüdische Emigrantin, die Vordenkerin einer freiheitlichen, antitotalitären Moderne, welche die Banalität des Bösen an Eichmann analysierte und demonstrierte.
Und diese beiden Extreme sollen zusammenpassen? Kaum vorstellbar. Dennoch: Mehr als ein halbes Jahrhundert verband die beiden eine (ungleich gewichtete, gleichwohl) große Liebe, die 1924 in Marburg zwischen der noch minderjährigen Studentin und dem verheirateten 36-jährigen Heidegger, damals außerplanmäßiger Professor, begann. Für Arendt, so ihre eigenen Worte, „der Segen meines Lebens“; Heidegger, gleichwohl, erwog nie, seine Frau für sie zu verlassen.
Zwar schrieb Arendt deshalb, gleichsam als Hilferuf, eine kryptische Erzählung, ein verschlüsseltes Selbstportrait („Schatten“); Heidegger indes hörte diesen Hilferuf nicht. Oder wollte ihn nicht hören. Schließlich flüchtete Arendt (Ende 1926) zu Jaspers nach Heidelberg. Heidegger blieb ihre große Liebe. Noch 1928 schreibt sie an ihn: „Der Weg, den Du mir zeigtest, ist länger und schwerer, als ich dachte. Er verlangt ein ganzes Leben. Doch diesen Weg zu gehen ist die einzige Lebensmöglichkeit, die mir zukommt … Ich hätte mein Recht zum Leben verloren, wenn ich meine Liebe zu Dir verlieren würde … Und wenn Gott es gibt, werd ich Dich besser lieben nach dem Tod.“
Selbst kurz nach ihrer Heirat (1929) mit Günter Stern (später als Schriftsteller unter dem Namen Günter Anders bekannt) schreibt sie an Heidegger, dass sein „Anblick … die Kontinuität meines Lebens immer wieder entzündet, um die Kontinuität unserer – lass mich bitte sagen – Liebe.“
Während Arendt 1933 als Jüdin emigrieren musste, wurde Heidegger im selben Jahr der erste nationalsozialistische Rektor der Freiburger Universität. In der Hoffnung, der Philosoph der nationalen Erneuerung zu werden, die Vermassung des modernen Menschen, der keinen Zugang mehr habe zu den Dingen und der Welt (wie er es in „Sein und Zeit“ beschrieben hatte), zu überwinden, in der absurden Illusion, gleichsam den Führer führen zu können, scheute er den Pakt mit dem Teufel nicht. Zwar fiel er schon bald bei den Nazis in Ungnade, das hinderte ihn aber nicht, auch dann noch von der inneren Wahrheit und Größe der nationalsozialistischen Bewegung zu sprechen.
Von 1933 bis 1950 herrschte „Funkstille“ zwischen Heidegger und Arendt. Als diese im Auftrag der „Kommission für jüdischen kulturellen Wiederaufbau in Europa“ nach Kriegsende auch nach Deutschland kommt, sehen sie sich im Februar 1950 in Freiburg erstmals wieder. Und ihre Liebe entflammt erneut – dem, was geschehen, zu Spott und Hohn.
„Anzeichen der alten Leidenschaft finden sich nun auch wieder in den Briefen Heideggers. Am 15. Februar 1950 schreibt er: ,Wir haben, Hannah, ein Vierteljahrhundert unseres Lebens nachzuholen´. Und am 4.5. endet er: ,Du – Hannah – Du.´“
Und Hannah Arendt – die Jüdin, Demokratin, Antifaschistin! – wird, namentlich in den USA, zur „unbezahlten Agentin“ Heideggers, wirbt für ihn, verteidigt ihn, kämpft für sein Renommee. Als Jaspers sie (1956) ersucht, den Kontakt zu Heidegger abzubrechen, ihn zumindest nicht wiederzusehen, weist sie dieses Ansinnen empört zurück.
„1958 sollte Arendt bei der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels an Jaspers die Laudatio halten. Sie hat Zweifel und ist aufgeregt, besonders weil sie Angst hatte, Heidegger könnte das kränken, könnte dies als Parteinahme für Jaspers und damit gegen ihn deuten. Sie muss sich selbst gut zureden, ´daß ich doch einen Mund habe und sagen kann, was mir beliebt´.“ Der letzte Brief Arendts an Heidegger datiert auf den 27. Juli 1975, der Heideggers an Arendt drei Tage später. Im Dezember 1975 stirbt Hannah Arendt. Martin Heidegger überlebt sie um fünf Monate.
Warum ich Dir von Martin Heidegger und Hannah Arendt schreibe? Weil Ihre Liebe, über alle trennenden Gräben hinweg, beweist, was Hannah Arendt selbst in „Vita activa oder vom tätigen Leben“ schreibt:
„In der Leidenschaft, mit der die Liebe nur das Wer des anderen ergreift, geht der weltliche Zwischenraum, durch den wir mit anderen verbunden und zugleich von ihnen getrennt sind, gleichsam in Flammen auf. Was die Liebenden von der Mitwelt trennt, ist, dass sie weltlos sind, dass die Welt zwischen den Liebenden verbrannt ist.“