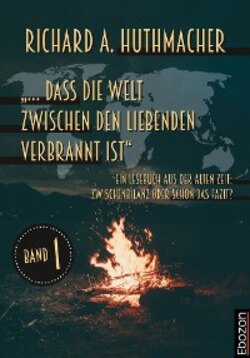Читать книгу „… dass die Welt zwischen den Liebenden verbrannt ist“ - Richard A. Huthmacher - Страница 22
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ALEXANDER MITSCHERLICH: „IRRUNGEN UND WIRRUNGEN“ EINES GROSSEN GEISTES
ОглавлениеLiebster!
Andere Intellektuelle mit maßgeblich prägendem Einfluss in jener Zeit (der Sechziger und Siebziger) waren Alexander Mitscherlich und Horst Eberhard Richter (bei dem Du, wie ich mich gut erinnern kann, seinerzeit habilitieren wolltest, was daran scheiterte, dass, bei allem Bemühen von Richter, keine entsprechende Stelle geschaffen werden konnte).
Das Leben von Alexander Mitscherlich wurde bereits früh durch die (gegensätzlichen) ideologischen Strömungen der Weimarer Republik (und Vor-Nazi-Zeit) sowie durch deren Wirrnisse und den hieraus resultierenden „realen Wahnsinn“ beeinflusst – so musste er seine Dissertation (er studierte in München Geschichte, Kunstgeschichte und Philosophie) abbrechen, weil der Antisemit von Müller diese nicht weiter betreuen wollte, nachdem Mitscherlichs Doktorvater, der Jude Paul Joachimsen, 1932 verstorben war.
Prägend für Mitscherlich war auch die Begegnung mit Ernst Jünger. Dieser, Jünger, Verfasser von „In Stahlgewittern“, wo Jüngers nationalistische und antidemokratische Gesinnung in der Verherrlichung des Kriegs zum Ausdruck kommt (wiewohl manche Unverbesserliche hier gar ein „Antikriegsbuch“ erkennen wollen), Jünger, ebenso mit dem preußischen „Pour le Mérite“ ausgezeichnet und bis zu seinem Tod 1998 im gesegneten Alter von fast 103 Jahren letzter Träger dieses umstrittenen höchsten militärischen Ordens wie, in bundesrepublikanischen Zeiten, mit dem „Großen Bundesverdienstkreuz“ geehrt, Jünger, Freikorpskämpfer, voller Sympathie für die Idee der nationalen Revolution eintretend und „dem nationalen Führer Adolf Hitler“ sein Buch „Feuer und Blut“ widmend, Jünger, dezidierter Antidemokrat (er hasse die Demokratie wie die Pest, gegen das Literatenpack, das sich für Aufklärung, für Demokratie und Pazifismus einsetze, müsse die Prügelstrafe wieder eingeführt werden), Jünger, der sich mit antisemitischen Äußerungen, beispielsweise in seinem Essay „Nationalismus und Judenfrage“ (1930) hervortat und sich – angeblich – mit „Auf den Marmorklippen“ (die er als verdeckte Kritik an Hitler geschrieben habe) gegen den Tyrannen wehrte (bekanntlich waren im Nachhinein ja alle Widerstandskämpfer und hatten zuvor einen Juden im Keller versteckt), Jünger, der sich nach dem Krieg weigerte, den Fragebogen der Alliierten zur Entnazifizierung auszufüllen und deshalb mit Publikationsverbot belegt wurde, Jünger, der mit dem LSD-Entdecker Albert Hofmann mit Drogen experimentierte und seine Erfahrungen mit LSD in seiner 1952 erschienen Erzählung „Besuch auf Godenholm“ thematisierte, Jünger, der gegen Ende seines Lebens von den „Großen“(?) der Politik (wie Kohl und Mitterand) besucht wurde – die zum stauffenbergschen Forsthaus in Wilflingen, wo er seit der Zeit nach dem Krieg wohnte, wie zum Tempel eines weisen alten Philosophen pilgerten –, Jünger, Insektenkundler und Schriftsteller, dem Brecht jeden literarischen Rang absprach („Da er selbst nicht mehr jung ist, würde ich ihn einen Jugendschriftsteller nennen, aber vielleicht sollte man ihn überhaupt nicht einen Schriftsteller nennen, sondern sagen: Er wurde beim Schreiben gesehen“), eben diese vielschichtig-schillernde Persönlichkeit Ernst Jünger veranlasste Alexander Mitscherlich, sich in Berlin der nationalrevolutionären Bewegung anzuschließen, also jener Rechten, welche die Umwandlung der bürgerlich-parlamentarischen in eine autoritär-nationalistische Gesellschaftsform anstrebte.
Auch Mitscherlich hatte mithin eine Zeit der „Irrungen und Wirrungen“.
1936 (trotz dieser „Irrungen der jungen Jahre“) wegen der Nazis in die Schweiz emigriert, 1937 nach der Rückkehr von dort für einige Monate von der Gestapo inhaftiert, konnte er sein Medizinstudium gleichwohl in Deutschland fortsetzen und wurde 1941 in Heidelberg promoviert; 1946 habilitierte er sich mit seiner Schrift „Vom Ursprung der Sucht“.
Nach Ende des 2. Weltkriegs wurde ihm die Leitung einer Kommission zur Beobachtung der „NS-Ärzteprozesse“ in Nürnberg übertragen; auftragsgemäß sollte er alles Erforderliche veranlassen, um in Presse und Öffentlichkeit die Vorstellung einer Kollektivschuld der Ärzte zu verhindern.
Ein Jahr später, 1947, erschien dann seine Prozess-Dokumentation „Diktat der Menschenverachtung: Der Nürnberger Ärzteprozeß und seine Quellen“. Mitscherlich war über die Verbrechen deutschen Ärzte in den KZs, über deren schier unvorstellbare Grausamkeiten derart entsetzt, dass er nicht daran dachte, die Wahrheit zu schönen. Die Ärzteschaft schwieg die Publikation daraufhin tot, in keiner Fachzeitschrift (und auch sonst nirgendwo) durfte die Dokumentation, die schon in einer Auflage von 25.000 Exemplaren gedruckt worden war, erscheinen, auch in der Presse fand sie so gut wie keine Erwähnung.
Über die NS-Ärzteprozesse veröffentlichte Mitscherlich drei Jahre später die Dokumentation „Wissenschaft ohne Menschlichkeit: Medizinische und eugenische Irrwege unter Diktatur, Bürokratie und Krieg“. Gedruckt wurden 10.000 Exemplare des Buches, die aber kurz nach dessen Erscheinen aus sämtlichen Buchläden verschwanden – nicht nur Mitscherlich selbst vermutete, dass die Exemplare in toto von den Ärztekammern aufgekauft und aus dem Verkehr gezogen wurden.
Jedenfalls wurde Mitscherlich von nun an systematisch aus sämtlichen medizinischen Fakultäten ausgegrenzt. Von 1967-76 war er Inhaber einer Professur – wohlgemerkt der Philosophischen Fakultät – in Frankfurt, dort auch (von 1960-1976) Leiter des Sigmund-Freud-Instituts (vormals „Institut und Ausbildungszentrum für Psychoanalyse und Psychosomatik“, mittlerweile reines Forschungszentrum).
Vorgenannte Veröffentlichung Mitscherlichs über die Nürnberger Ärzteprozesse erschien 1960 erneut (jetzt unter dem Titel „Medizin ohne Menschlichkeit“). Dieses Buch nun wurde insgesamt weit über hunderttausendmal (gedruckt und auch) verkauft. Summa summarum geht Mitscherlich von 350 Ärzten aus, die an Menschenversuchen sowie an sonstigen Verbrechen von KZ-Ärzten und anderen ärztlichen Schergen in Diensten des NS-Regimes beteiligt waren.
In der ZEIT vom 25. April 2007 schreibt der Psychoanalytiker Bernd Nitzschke zum Menschen Mitscherlich, und zwar als Rezensent der Mitscherlich-Biographie des Historikers Martin Dehli:
„Die Mutter war ´ewig unzufrieden´; der Vater, ein ´Koloß an Leib und Zorn´, ´die große Angstquelle meiner Kindheit´ – und ´dazwischen ich, ein einziges, einsames Kind´. So steht es in einer um 1937/38 entstandenen Aufzeichnung. In dieser Zeit sitzt der dreißigjährige Sohn in einem Gestapo-Gefängnis. Nach dem Krieg veröffentlicht er einen Aufsatz mit dem Titel Ödipus und Kaspar Hauser. Da ist er noch immer einsam – und immer noch auf der Suche nach einer Frau, die ihm Mutter, nach einem Mann, der ihm Vater hätte sein können. Von einer Frau, die er zur Mutter gemacht und bei der [er] einen Sohn und zwei Töchter vaterlos zurückgelassen hat, ist er bereits geschieden. Jetzt, 1953, wiederholt sich das Drama: Wieder wird er geschieden; diesmal kommen zwei Söhne in ein Schweizer Internat.
Für ihn aber beginnt nun eine Karriere, an deren Ende aus dem ewigen Sohn einer der geistigen Väter der 68er-Generation geworden ist. Die Bücher, die er publiziert, verdichten kollektives Schicksal und individuell Erlebtes. Sie tragen Titel, die zu Schlag-Worten werden: Die vaterlose Gesellschaft (1963); Die Unfähigkeit zu trauern (1967). Ja, von Alexander Mitscherlich ist die Rede. Das zuletzt genannte Buch hat er mit seiner dritten Ehefrau Margarete Nielsen [Margarete Mitscherlich – e. A.] verfasst – die in seiner 1980 erschienenen Autobiografie Ein Leben für die Psychoanalyse ebenso wenig beim Namen genannt wird wie ihre Vorgängerinnen, Melitta Behr und Georgia Wiedemann. Auch seine sieben Kinder bleiben darin ... ohne Namen.“
Fast ist man ob solcher Ausführungen zu sagen geneigt, dass offensichtlich theoretischer Anspruch und konkrete Lebenswirklichkeit auch bei denen (oft) weit auseinanderklaffen, die seinerzeit unsere „Ikonen“ waren – als wir, die Nachkriegsgeneration, die Generation der Söhne und Töchter, nach Vorbildern suchten, die uns unsere eigenen Väter und Mütter, nicht zuletzt wegen ihrer Verstrickungen in der Nazi-Zeit, nicht geben konnten. Gleichwohl: „Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen“ (Faust II).