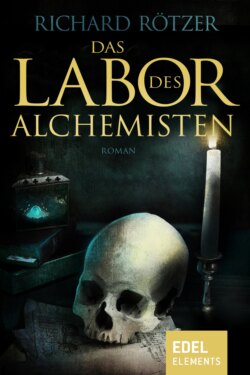Читать книгу Das Labor des Alchemisten - Richard Rötzer - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Kapitel
ОглавлениеEin frischer Wind wehte an diesem Morgen von Osten her über die Untere Isarlände, und Peter Barth war deshalb nicht unzufrieden, daß er gut zu tun hatte. Eben noch stritt er sich mit dem Bäcker, der sein Brennholz erst nach Michaeli aufhacken wollte, hinter ihm wurde ein Fuhrknecht ausfällig, weil das Kaufmannsgut blockiert war, und vorne standen schon die Kistler- und Schäfflerknechte an. Erst fiel sein Blick nur flüchtig auf den Karren, der den Weg von der Straße zu den Holzstößen einschlug, dann stutzte er und wurde neugierig. Tag für Tag strömten unzählige Leute zur Floßlände, aber Frauen fanden selten den Weg hierher, denn Holz für den Hausbrand wurde reichlich in der Stadt feilgeboten.
Die junge Frau führte ein Maultier am Zügel, das einen einachsigen Karren zog. Sie stand eine Weile unschlüssig, dann sah sie ihn und steuerte direkt auf ihn zu.
Kannte er sie nicht? Sie hatte von weitem nichts Auffälliges an sich, bloß ihr schmuckloses braunes Leinenkleid schien von Lehmpritzern übersät – natürlich, sie war die Töpferin, die gelegentlich neue Humpen und Krüge in den Maenhartbräu lieferte, wo er zur Miete wohnte.
Sie trug das flachsblonde Haar heute nicht geflochten; nur ein schmales Band umschloß die Lockenfülle im Nacken und – mein Gott, was war mit ihrem Gesicht, ihrem linken Auge? Es war geschwollen und tiefviolett umrahmt.
Er ging besorgt auf sie zu. »Habt Ihr Euch gestoßen? Seid Ihr verletzt?«
Sie verneinte kopfschüttelnd und sah ihn dabei so eigenartig an, als habe er Unschickliches gefragt. Er verscheuchte den lästigen Bäcker, der ihn erneut bedrängen wollte und wandte sich verunsichert wieder der jungen Frau zu: »Was kann ich denn für Euch tun?«
»Ich bin Wiltrud, die Tochter des Hafners und …«
»Ich weiß«, preschte Peter vor. »Ich sah Euch im Gasthaus. Agnes, die Wirtin, schätzt Eure Krüge.«
»Soso, ja … das freut mich. Ich bereite gerade wieder einen Brand vor und da wollte ich …«
»Ihr sucht Holz.« Es war mehr Feststellung als Frage. »Aber warum bemüht Ihr Euch selbst? Ihr solltet Euch ausruhen.« Peter deutete vielsagend auf das gezeichnete Auge. »Das Brennholz besorgt doch gewöhnlich Euer Lernknecht.«
»Der gewöhnlich nicht da ist, wo man ihn braucht«, erwiderte sie achselzuckend und rang sich ein Lächeln ab.
»Läßt sich Euer Meister das bieten?«
»Oh, der prügelt gern und viel. Ich bin ja schon froh, wenn es ein Lernknecht mehr als ein paar Wochen bei uns aushält.«
In Peter keimte ein Verdacht, den er nicht auszusprechen wagte in der Befürchtung, ihr erneut zu nahe zu treten.
»Ja, also, dann wollen wir …« Er griff ins Zaumzeug, führte das Maultier zu den Lagern für den Brennbedarf der Handwerksbetriebe und rief zwei Auflader herbei. Nachdem die Hafnerstochter die Gebühr fürs Holz entrichtet hatte, sollte für ihn der Vorgang erledigt sein, denn als Pfleger der Lände warteten anderswo genügend Aufgaben auf ihn. Aber er umschlich unschlüssig das Gefährt, prüfte die Radnabe hier, den Halt der Seitenwände dort …
Wiltrud schien es erst gar nicht zu bemerken, denn sie warf selbst Scheite auf den Karren, und was wollte einer noch hier, wenn er nicht zupackte?
In seiner Verlegenheit kam Peter schließlich aufs Wetter zu sprechen. »Ob’s zum Tag des Herrn wohl schön bleibt?«
»Wieso?« Die Hafnerin richtete sich auf und wischte den Schweiß von der Stirn.
»Na, wegen der Kirchweih. Es ist doch Tanz.«
»Oh! Ich mach’ mir nichts draus«, erwiderte sie geringschätzig, »und mit dem Auge gleich gar …«
»Aber das macht doch nichts, so erkenn’ ich Euch wieder.« Er hätte sich die Zunge abbeißen mögen für den mißglückten Scherz.
Die Hafnerin klopfte den Staub von ihren Händen und streifte sie gedankenverloren am Kleid ab. Urplötzlich trat sie ganz nahe heran, und ihr blutunterlaufenes Auge verstärkte bizarr ihren forschenden Blick: »Warum fragt Ihr?«
»Ich … ich dachte … vielleicht sehen wir uns dort und dann könnten wir doch …«
Sie wandte sich abrupt um, griff wortlos ins Geschirr und wendete langsam den Karren. Und ebenso unvermittelt schaute sie noch einmal zurück: »Vielleicht …«
Ihr Lächeln schien ihm hintergründig und amüsiert zugleich. Er starrte ihr nach und fragte sich plötzlich selbst: Warum eigentlich? Sie war gewiß nicht die Maienkönigin, und besonders zugänglich schien sie auch nicht. Aber irgend etwas an ihr … oder war es nur sein Beschützerinstinkt, der auf Veilchenblau ansprang?
»Ich dachte, die Balzzeit ist längst vorüber.«
Peter fuhr herum und blickte in das unverschämte Grinsen seines fast doppelt so alten und beleibten Freundes Paul. »Alter Narr«, brummte er kleinlaut.
»Kennst du nicht das Märchen von der Prinzessin?« zog der lebenslustige Paul den errötenden Galan noch weiter auf. »Sie stellt ihren Freiern unlösbare Rätsel und führt sie dann mit Wonne dem Henker zu? An die Hafnerin ist noch keiner rangekommen. Wo deine Agnes bloß energisch ist, da hat die Haare auf den Zähnen. Glaub mir, die bleibt entweder Jungfer oder sucht sich selbst den Richtigen. Das ist nichts für grüne Bengel.«
»Woher willst du das wissen?« trotzte Peter.
»Lebenserfahrung«, prahlte Paul.
»Hurenweisheit!«
»Pah!«
Ludwig Küchel eilte durch die Rosengasse. Wollte er die Freitagssitzung des Rates noch vor dem dritten Ausläuten erreichen, so mußte er sich sputen. Wegen der morgendlichen Kühle hatte er sich den pelzbesetzten Nuschenmantel reichen lassen. Die Gugel aus weichem Rotsamt verdeckte das schüttere Haar. Sie war aber nicht einfach übergezogen, sondern kunstvoll um den Kopf geschlungen in der Art, daß der gezaddelte Kragen wie ein Hahnenkamm nach oben stand. Und wie der reiche Weinhändler leicht vornübergebeugt so dahinstakste, erweckte er unfreiwillig das Bild eines Pfaus.
Dabei war er nicht wirklich eitel, sondern wetterte im Gegenteil – darin den Predigern ähnlich – immer häufiger gegen die Putzsucht der Evastöchter. Gediegen sollte das Äußere sein, gediegen und vornehm, und sich dadurch sowohl von der Ärmlichkeit niederen Standes als auch vom geschmäcklerischen Firlefanz der Emporkömmlinge unterscheiden.
Manchmal fühlte sich Ludwig Küchel nicht mehr so recht heimisch in dieser Stadt, in der die alte Ordnung und Beschaulichkeit gefährdet schienen wie Wolle im Mottenfraß. Mit dem rasanten Wachstum vergangener Jahre hatte zwar der Wohlstand Einzug gehalten, aber das Leben war auch lauter, hektischer geworden, bald dieser Neuerung, bald jener Torheit nachjagend – kurz: Es war schwieriger kontrollierbar geworden, und das bereitete ihm Sorge.
Am großen Marktplatz verstellte eine dichte Traube Schaulustiger seinen Weg. Die Gaukler nutzten mit Duldung des Fronboten die frühe Stunde, um den Beifall der Marktgänger und möglichst auch deren silberne Pfennige einzuheimsen.
Eben noch hatte der bärenstarke Samson das Publikum verblüfft, indem er armdicke Eisenstangen gebogen und faustgroße Isarkiesel mit den Zähnen zermalmt hatte. Jetzt schickte sich der wendige Balthasar an, mit Keulen und Bällen zu jonglieren.
Ludwig Küchel mißbilligte das Treiben, nicht nur weil ihn das Gewühl am Fortkommen hinderte, sondern aus tiefstem Herzen. War solches etwa die Arbeit eines rechtschaffenen Mannes? Wer wollte ihm weismachen, daß der gestrenge Gottvater derart liederliche Talente vergab. Dem Teufel, ja, dem standen Nichtstun und Hokuspokus gut an. Und die zwei dort waren fette Beute für ihn, der dralle Rotschopf und die Schwarzhaarige, die die Röcke unzüchtig schürzte, um die Beine zu werfen und radzuschlagen.
Ludwig Küchel drängte murrend vorwärts und wurde seinerseits von unwillig weichenden Gaffern geschoben. Und auf einmal stand er zuvorderst, und schallendes Gelächter erhob sich rundum. Er wandte sich um, konnte aber den Grund allgemeiner Belustigung nicht ausmachen. Dort stand nur der Gaukler und jonglierte seelenruhig seine Bälle. Worin lag da der Witz?
Der feine Herr suchte wieder in die Menge einzutauchen und sie zu durchdringen, aber die Wand aus hüpfenden Leibern und feixenden Gesichtern ließ ihn jedesmal abprallen und warf ihn zurück. Und wieder dies abscheuliche Gelächter.
Er fuhr herum, und diesmal sah er gerade noch, wie der Jongleur mitten in der Bewegung erstarrte und sein unschuldigstes Grinsen aufsetzte. »Verdammter Narr!« blaffte er ihn verärgert an.
Aber der Gaukler hatte sich durch seine freche Pantomime den Beifall der schaulustigen Menge erworben und die johlte begeistert und entließ den mürrischen Spielverderber mit Pfiffen.
Der Ratsherr winkte verächtlich ab und teilte nun schimpfend und mit energischen Stößen die Reihen der Müßiggänger.
Ott, der Bürgerknecht, riß beflissen die Türe zur Ratsstube auf, aber Heinrich Rudolf, der erste Kämmerer, der gegenwärtig auch als Redner den Vorsitz führte, hatte soeben die Sitzung eröffnet.
Während Küchel so unauffällig wie möglich seinem Platz in den Reihen des Äußeren Rates zustrebte, begleitete ihn allseits spöttisches Grinsen wie das Gelächter des Dämons den Gerechten.
»Nachdem uns nun auch Bürger Küchel die Ehre gibt«, hob der Redner süffisant nochmals an, »darf ich die heutige Sitzung mit der Feststellung eröffnen, daß wiederholt Klage an den Rat gerichtet wurde bezüglich allgemeiner Sittlichkeit und ein Einschreiten des Rates geboten sei. Es bezieht sich insonderheit auf das Treiben im Henkerhaus sowie allfällige Winkeldirnen, daneben auf Unzucht in den Badstuben und aus gegebenem Anlaß auf Bettler, landstörzerisches Gesindel und Spielmannsunwesen. Ich erteile hierzu das Wort dem Bürger Sendlinger.«
Die schlichte Anrede war Untertreibung, aber sie waren stolz darauf, Bürger dieser Stadt zu sein und wußten auch ohne hochtrabende Titel um ihr persönliches Ansehen. Die feinen Tuche, Pelzverbrämungen und Siegelringe waren augenfälliger und hätten der Kollektion jedes fahrenden Händlers zur Ehre gereicht.
Hans Sendlinger verwies geschickt darauf, daß seine Familie den Bettelorden der Stadt große Unterstützung zukommen lasse und diese dazu beitrügen, den Bewohnern ins Gewissen zu reden.
Damit sei’s nicht getan, ereiferte sich Pötschner, aber wie solle man dem Recht Geltung verschaffen, wenn schon der Henker eine äußerst zwielichtige Person sei.
Ludwig Tichtl erinnerte, daß schließlich die Mehrheit des Rats der Bestallung erleichtert zugestimmt habe, nachdem der vorige Halsabschneider mit zwei Dirnen und einem Beutel Silber über Nacht getürmt sei. »Und was schadet’s«, gab er zu bedenken, »wenn er verwahrloste Hübscherinnen etwas härter anfaßt und der heimlichen Unzucht den Garaus macht?«
Es sei doch merkwürdig, stichelte der junge Ligsalz mit sichtlichem Vergnügen, daß die Klagen über dreiste und sittenlose Weiber und über nächtliche Umtriebe von Knechten und Lehrlingen in erster Linie aus den Gassen um den Anger herum kämen, wo der doch zum Rindermarktviertel gehöre, in dem die ehrbaren Bürger dieser Versammlung überwiegend ihre Behausung hätten.
Die flapsige Bemerkung war ein Stich ins Wespennest.
Der junge Herr möge gefälligst zwischen der inneren und äußeren Stadt unterscheiden, empörte sich Heinrich Ridler. Und als Hauptmann der Quarta fori peccorum cum suis adherentiis, des gesamten Rindermarktviertels, mäkelte er: »Soll ich vielleicht höchstpersönlich jede Nacht hinter den Zirkern herrennen und Gassen und Gelichter oder die Badstuben der Emporkömmlinge kontrollieren?«
Der Kämmerer, der selbst am Anger wohnte, hatte alle Mühe, den aufkommenden Tumult und umherfliegende Schmähworte im hohen consilium zu unterbinden.
Als endlich die Frage anstand, wie mit den Gauklern und Spielleuten zu verfahren sei, da war Ludwig Küchel nicht mehr zu halten und ließ als Kirchpropst und frommer Bürger seinem Unmut freien Lauf: »Von St. Peters Turmspitzen führt kein Seil, wohin auch immer! Das wäre noch schöner, daß die Kirche diesen Mesnern des Teufels auch noch das Seil spannen soll, auf dem sie ihre Possen treiben. Aus der Stadt jagen sollte man sie oder besser gar nicht erst einlassen.«
»Jawohl«, pflichtete Pötschner bei, »der Nürnberger Rat hat letztes Jahr einen Haufen Falschspieler und Ruffiane mitsamt ihren Dirnen der Stadt verwiesen. Und Spielleut’ und Lumpen, die wachsen auf einem Stumpen.«
»Was habt Ihr gegen sie?« fragte Ligsalz ganz unbedarft.
»Das will ich Euch sagen, junger Freund«, knurrte Küchel angriffslustig. »Ihr Treiben ist lasterhaft und nicht gottgewollt. Die Kerle sind aufdringlich, betrügerisch und spielwütig, und ihre schamlosen Weiber pflanzen Begierden in die Herzen rechtschaffener Bürger. Ihre Verderbtheit hat noch zu keiner Zeit den Glauben gestärkt, aber sie schleppen ketzerische Ideen mit sich wie die Krätze, und so sie nicht den Manichäern, den Jüngern des Waldes oder gleich gar den verruchten Luziferianern angehören, hängen sie zumindest alten Bräuchen und heidnischen Gedanken an. Oder handeln ihre Lieder etwa nicht von Zauberern und verbotenen Göttern oder anderen Chimären? Und wo sie nicht gleich den Herrgott lästern, da machen sie sich über die Kirche und ihre Diener lustig und spotten über die Hölle. Und zuletzt gießen sie ihren Unflat selbst über die Hand, die sie in Verblendung nährt. Sie sind wie Ungeziefer, das immer mehr nach sich zieht.«
»Dann nährt manch frommer Bischof eine Laus im Pelz«, erwiderte Ligsalz spöttisch. »Obwohl sie die Fahrenden von der Kanzel herab schelten, sind diese an den Höfen zum Zeitvertreib wohl gelitten. Warum sollen wir’s anders halten?«
Dieser Meinung schlossen sich andere an, denn die Erfahrung hatte gelehrt, daß die Menge sich durch gelegentliche Zugeständnisse leichter regieren ließ, so wie ein tänzelnder Hengst seinen Auslauf braucht und ein brodelnder Topf seine Öffnung. Warum also sollte man den Bürgern zu Kirchweih nicht ein bescheidenes Vergnügen gönnen, wo es schon wieder auf die dunkle, für Körper und Gemüt harte Jahreszeit zuging.
Trotz Küchels heftiger Einwände drehte sich alles nur noch um die Frage, wie die Sache mit dem Seil – denn dies versprach zweifellos am meisten Kitzel und Vergnügen – zu bewerkstelligen sei.
An die Türme von St. Peter war nicht zu denken, denn der erhitzte Kirchpropst hätte vermutlich eigenhändig das Seil durchtrennt, und der Pfarrer war noch gar nicht gefragt worden. Den Marktplatz in seiner ganzen Breite zu überspannen, das schien auch den Mutigsten zu gewagt. Aber der Eier- und Kräutlmarkt schien selbst kritischen Geistern von Spanne und Höhe her angemessen, und so wurde mehrheitlich die Erlaubnis für das Spektakel erteilt, womit der Münchner Rat schon früh bewies, daß er der hohen Kunst des Balanceakts nicht abgeneigt war.
Wenn es schon irgendwann sein sollte, dachte Wiltrud, während sie das Fuhrwerk am Angerbach heimführte, dann am ehesten einen wie ihn. Seine Besorgnis um sie tat ihr gut. Er sah gut aus, hatte wunderschöne samtbraune Augen und zudem Manieren und – naja, sonst wußte sie so gut wie nichts über ihn, außer daß er im vergangenen Jahr zur Aufklärung scheußlicher Morde beigetragen haben sollte. Ob er verheiratet ist? Dumme Gans! schalt sie sich. Was geht’s mich an. Ich bin ja fast schon wie Margret.
Aber der andere kam keinesfalls in Frage. Dafür kannte sie Niklas Drexl zu gut. Nur ein windiges Zaungeflecht schied die beiden Grundstücke. Als Kinder, kurz nachdem die Drexl zugezogen waren, hatten sie sogar eine Weile zusammen gespielt. Schon damals hatte sich Niklas durch Sturheit ausgezeichnet, wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hatte. Er beanspruchte die Führung unter den Halbwüchsigen des Viertels und verlieh seiner Forderung Nachdruck durch besondere Roheit. Mit den Lehrjahren verloren sie sich aus den Augen oder richtiger: gingen sich aus dem Weg, und wenn Vater und Sohn jetzt um sie warben, dann galt dies nicht dem Liebreiz ihrer Person, sondern der bezaubernden Größe der Hofstatt. Soviel wußte sie genau.
Dem Teufel mußte an der Verbindung gelegen sein, denn eben schoß Niklas aus der Seitengasse und vertrat ihr den Weg.
»Meine Verehrung, Frau Nachbarin«, grüßte er mehr spöttisch als höflich und deutete plump eine Verbeugung an.
Anstelle einer Antwort hielt sie ihm den Zerrspiegel vor, und seine Augen wurden zu glühenden Kohlen, seine wohlgeformte Nase glich einer verwarzten Rübe, und der schmale Mund verzog sich zu einem geifernden Rachen. »Aus dem Weg!« fauchte sie.
Damit war das Scheusal nicht zu bannen. Niklas griff derb ins Zaumzeug und bremste das Maultier.
»Warum so kratzbürstig, meine Schöne? Ich wollte eben meine Aufwartung machen.«
»Bemüht Euch nicht!«
»So förmlich?« säuselte Niklas. »Weißt du nicht mehr, wie wir zusammen gespielt haben und du …«
»Ist lange her.«
»Um so wichtiger, daß wir wieder mal miteinander reden.«
»Ich wüßte nicht worüber.«
»Über uns, meine Liebe, über uns. Vater hat mir erfreut berichtet …«
»Was?« Wiltruds Augen schössen Blitze.
»... daß du sein Angebot … hm, sagen wir erwägst, und daß einer glücklichen Verbindung …«
»So, sagt er das?« schnappte Wiltrud. »Weiß er vielleicht auch schon den Tag?«
»Du etwa?«
»Sicher, ganz sicher.« Die Hafnerin legte alle Häme, die sie aufbringen konnte, in Mimik und Stimme: »Der Tag, an dem die Hölle zufriert, wird unser Hochzeitstag sein.«
Niklas lachte lauthals; es klang scheppernd, unecht. »Ich habe deinen Witz immer gemocht, Wiltrud, schon damals.«
»Und ich hasse deine Art, Niklas, schon immer. Laß mich in Ruhe und such dir den Trampel, der zu dir paßt!«
Niklas’ Gesicht verkrampfte sich. Zorn flammte auf. »Eine kühne Rede für ein Weib. Glaub nur nicht, daß du damit durchkommst. Du wirst dich nicht mehr auflehnen, wenn erst …«
»Frau Meisterin! Schnell! Euer Vater!« Wolfhart, der Lernknecht kam gerannt, ausnahmsweise zur rechten Zeit. Sie übergab ihm das Gespann und ließ Niklas einfach stehen.
»Dein Hochmut wird dir noch vergehen!« brüllte er hinterher, aber sie schien ihn schon nicht mehr zu hören.
»Huhuu! Wiltrud! Was meinst du, soll ich zu dem Kleid das Haar flechten oder als Schnecken tragen oder …«
»Schneid’s ab und mach Kissen draus!« riet Wiltrud bissig und stürmte an Margret vorbei nach Hause.