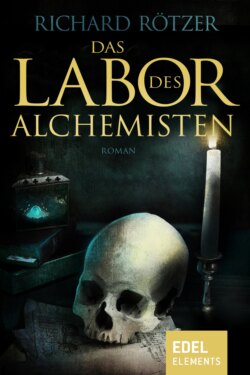Читать книгу Das Labor des Alchemisten - Richard Rötzer - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. Kapitel
ОглавлениеAls Paul am frühen Morgen die knarzende Stiege herabkam, hatte er urplötzlich eine bedrohliche Erscheinung: Eine massige Gestalt in Leinenhemd und weißer Haube versperrte ihm den Weg. Es war das keifende Weib des Krämers, bei dem er zur Miete wohnte.
»Hab’ ich ein Armenhaus?« spie ihr giftiger Schlund aus. »Euer Mietzins ist überfällig!«
»Gemach, verehrte Frau Krämerin«, versuchte Paul sie noch gut gelaunt zu beschwichtigen. »In ein paar Tagen.«
»Und wenn’s der Heilige Geist wär’«, belferte die geldgeile Matrone, »bei mir wohnt keiner umsonst!«
»Nur vorübergehend«, erklärte Paul noch immer freundlich. »Hab’ grad’ ein Loch im Beutel.«
»Dann geht doch zu den Steckenbrüdern ins Spital, wenn Ihr ein Hundsfott seid. Wovon sollen mein kranker Mann und ich sonst …«
»Schweigt still, Frau!« blaffte Paul sie ganz unvermutet an. Er kannte das Spiel. Wenn er jetzt nicht Einhalt gebot, dann würde sie keifen, bis das Haus zusammenlief. »Euer Zins ist ohnehin Wucher. Ich hause in einem Verschlag wie das ärmste Schwein und zahle für einen Palast. Halbieren sollt’ ich den Mietpreis, ach was, ein Viertel wär’ noch zu viel!«
»Wie ein Schwein!« bellte die Hudlerin zurück. »Da habt Ihr ganz recht: Ihr haust wie ein Schwein, kommt alle naslang besoffen und grölend daher. Bin sowieso viel zu nachsichtig. Rauswerfen sollt’ ich Euch und lieber gleich als morgen.«
Paul warf sich in die Brust: »Ihr solltet Euch glücklich preisen, eine Amtsperson in Eurem armseligen Stall beherbergen zu dürfen.«
»Daß ich nicht lache!« schrillte die Krämerin. »Jeder Hühnerdieb ist noblere Gesellschaft. Einen wie Euch krieg’ ich alle Tag, könnt gleich verschwinden!«
»Gut«, schmollte Paul, »dann werd’ ich dies ungastliche Haus auf der Stelle verlassen. Aber seid versichert, daß sich der Fronbote Eurer raffgierigen Krämerseele annehmen wird.«
»Was könnt Ihr dem schon erzählen, häh?« gickelte die Alte höhnisch und mißtrauisch zugleich.
Paul ließ sie einfach stehen und marschierte hocherhobenen Hauptes hinaus. »Ich hab’ es satt«, schimpfte er auf der Gasse, »ein für allemal! Ich muß raus aus diesem Loch!«
Wiltrud Hafner ging nachdenklich die Mühlgasse entlang. Vater hatte gestern wieder getobt, wegen seiner Schmerzen und wegen des sauren Weins. Es wurde immer schlimmer mit ihm. Sie hatte eben einen Armvoll duftender Gräser und Wiesenblumen geholt und war unterwegs zur Kirche, als sie ein feines Summen hinter sich hörte. Es kam näher. Sie schaute sich flüchtig um und sah ein grellbuntes Kleiderbündel einherstolzieren. Obenauf saß ein fröhliches Gesicht, das ihr zunickte.
Kühl warf sie den Kopf herum und strebte vorwärts. Das Summen wurde lauter. Sie riskierte nochmals einen Blick – jetzt deutete der Kauz gar eine Verbeugung an, und ein paar aufgeregte Herzschläge später hielt er mit ihr Gleichschritt, streckte den Hals vor wie ein Frettchen und grinste unverschämt zu ihr herüber.
»Was erlaubt Ihr Euch!« fuhr sie den frechen Kerl an, und dieser stutzte. Sein Grinsen verschwand augenblicklich, aber nicht die Schelte hatte es bewirkt. Er starrte sie an und fragte mitfühlend: »Meiner Seel’, wer hat Euch geschlagen?«
»Was geht’s Euch an?« schnauzte Wiltrud.
»Mehr als Ihr ahnt, werte Dame. Es …«
»... interessiert mich nicht.« Sie wandte sich ab, wollte vorwärts.
»So wartet doch!« Er faßte sie am Ellbogen.
»Laßt mich!« Sie riß sich los.
»Euch lassen? Gütiger Himmel!« Er sprang ihr direkt in den Weg und lief mit großen Gesten rückwärts vor ihr her. »Ebenso könntet Ihr von mir verlangen, Euch den Drachen vorzuwerfen, den Sarazenen zu verkaufen, den Mönchen auszuliefern …«
Wiltrud hielt abrupt an, stemmte die Rechte in die Seite, legte den Kopf schief und herrschte ihn an: »Was wollt Ihr?«
»Genugtuung! Rache für den Frevel an Eurer Schönheit. Nennt mir den Namen des Strolchs, und ich werde ihn auslöschen. Zeigt mir die verruchte Hand, und ich lege sie Euch zu Füßen …«
»Das fehlte noch«, murmelte die Umworbene.
Der kauzige Fremde beugte plötzlich das Knie, breitete die Arme aus und trug ihr schmachtend an: »Verfügt über mich! Laßt mich Euer Beschützer und Paladin sein! Ich bin, so Ihr’s nur wünscht, Euer Knappe, Euer Knecht, Euer Sklave. Ein Wort von Euch und …«
Mit Wiltruds Beherrschung war es zu Ende. Sie lachte so schallend, daß selbst dem Verehrer der Mund offenstand.
»Ihr seid verrückt«, keuchte sie nach Luft ringend, »völlig verrückt!«
»Ich nenn’ es Ehre«, parierte er und trug verletzten Stolz zur Schau.
Mittlerweile wurden sie von etlichen Gaffern umringt.
»Kommt weiter«, zog sie ihn fort. »Wie heißt Ihr eigentlich?«
»Siegfried von Hohenau, werte Dame. Und Ihr, wenn’s erlaubt ist?«
»Ich bin die Wiltrud vom Hinteranger und Hafnerin. Die Dame dürft Ihr Euch schenken.«
»Macht Euch nicht gering, Herrin«, bat er. »Ihr könnt Euer nobles Handwerk auf unser aller Mutter zurückführen, war doch Eva die erste Töpferin. Das nenn’ ich Adel!«
»Ihr redet lästerlich. Dem Herrn gebührt das Lob, denn er formte zuerst den Adam aus Staub und Lehm.«
»Oder der Demiurg«, wandte Siegfried mit skeptischer Miene ein, »der gefallene Lichtbringer, von dem die Manichäer sagen, daß er die Welt in ihrer Verderbtheit schuf.«
»Was redet Ihr da?«
»Oh, nichts! Ihr solltet Euren hübschen Kopf nicht …«
»Wollt Ihr damit sagen …«
»... daß Ihr schön seid«, suchte Siegfried galant den Ausweg. »Ein minniglich Gesicht, daß mich zu Versen drängt.«
»Ihr macht Euch lustig«, argwöhnte sie gereizt. »Erst heuchelt Ihr Mitleid, und dann verspottet Ihr mich.«
»Keineswegs«, wehrte er sich entrüstet. »Ich seh’ als Sänger nicht nur äußeren Schein. Mag’s auch so ausseh’n, als habe Dämon Iblis, der Frauen das Schminken verriet, um der Männer Leidenschaften zu entfachen, Euer Auge ummalt, so läßt mich doch das andre ungeschminkt und ohne Falsch in Euer Herz blicken. Und darin seh’ ich vieles, was ich in Liedern preisen mag.«
»Seid Ihr einer von den Spielleuten?« fragte sie mißtrauisch, während sie seinen Aufzug einer kritischen Prüfung unterzog.
Die Schnabelschuhe, die länger und spitzer waren als alle, die sie bisher gesehen hatte, wirkten geckenhaft und von den geflickten Beinlingen lenkte der eine mit sattem Rot den Blick auf wohlgeformte Waden, während der andere in grellem Gelb erstrahlte. Die kurze Schecke, die er trug, verwirrte eher, als daß sie ein Urteil über seinen Stand erlaubte, denn einerseits war sie aus golddurchwirktem Brokat gefertigt, andererseits so fadenscheinig, daß sie einen Bettlerkönig geziert hätte. Es hieß, daß Edle, wenn sie von Spielleuten gut unterhalten wurden, diesen freigebig ihre getragenen Kleider überließen. Und jetzt bemerkte sie auch, daß das Ding, welches ihm verkehrt über der Schulter hing, kein Ränzel, sondern eine Laute war. Bei seiner Nase hatte der Schöpfer nicht am Ton gespart, erkannte das kundige Auge der Hafnerin, aber sein stolzer Blick überflutete sie mit einem Blau wie reinster spanischer Azurit.
»Sänger und Dichter«, erklärte er ohne falsche Bescheidenheit, »Spielmann nur der Not gehorchend. Ich bin auf dem Weg zur Burg, um König Ludwig meine Dienste anzutragen. Er soll ein Mann von Ehre und Geschmack sein und ein gutes Lied zu schätzen wissen.«
»Und ich bin auf dem Weg zur Königin, um ihre Kammer zu schmücken«, erwiderte Wiltrud spöttisch. »Ihr seid ein Aufschneider und Prahlhans, mein Herr!«
»Ich trag’ in meiner Tasche eine Empfehlung Heinrichs von Meißen, als Frauenlob gepriesen«, verteidigte Siegfried seine Ehre. »Und all seine Verse trage ich in mir, und meine Stimme ist die der Nachtigall …«
»Und Euer Aufputz wie das Federkleid des Stieglitz.«
»Der manch’ Maienehe …«
»... die nicht mal bis zum Herbst hält«, fiel ihm Wiltrud trocken ins Wort. »Ihr seid ein Schmeichler und Ohrenbläser wie all die andern, die nur darauf aus sind, eine Jungfer zu betören, um dann ihr kostbarstes Gut zu rauben, ihre Ehre und ihren Ruf. Und wenn Ihr Euren Willen habt, empfehlt Ihr Euch durch die Hintertür.«
Sie schritten durch den Sendlinger Turm und schwenkten in den Rindermarkt ein.
»Was ist Euer Ziel, mit Verlaub?« fragte Siegfried, der seine Chancen schwinden sah.
»Die Pfarrkirche.«
»Was wollt Ihr dort?«
»Morgen ist Kirchweih. Die Altäre sollen geschmückt sein, und diese Blumen sind für Sankt Katharina, die unser Handwerk schützt, weil sie durchs Rad gefoltert wurde. Aber vor allem hilft sie, die Keuschheit zu bewahren, und ich will ihren Beistand erbitten gegen zudringliche Verehrer und Windbeutel wie Euch.«
»So erlaubt mir wenigstens, Euch eine Probe meiner aufrichtigen Kunst zu gewähren.« Er riß die Laute von der Schulter, trat ihr blitzschnell wieder in den Weg und hob im Rückwärtsgehen an:
»Durch die Augen erreicht die Liebe das Herz,
Denn die Augen sind des Herzens Späher …«
»Nein, hört auf! Ich will das nicht!«
»Und die Augen gehen erkunden,
Was zu haben das Herz sich sehnt.«
»Nein, nicht hier! Die Leute! Hört sof... Vorsicht!«
Der Minnediener prallte im Eifer mit dem Rücken gegen eine Kuh, die eben den Schwanz hob, und es war kein dampfendes Drachenblut, worin Jung-Siegfried plötzlich watete.
Wiltrud hielt sich erst schicklich die Hand vor den Mund und platzte dann ungehemmt los, daß der Markt erbebte.
Der Sänger schaute reichlich gequält, bewies dennoch Haltung und versicherte: »Ich liebe Euer Lachen. Es ist so herrlich wider alle Konvenienz. Eine Spur zu schadenfroh vielleicht.«
Das Gelächter der anderen begleitete sie bis St. Peter.
»Wie kann ich Euch wiedersehen?« drängte Siegfried.
»Gar nicht!« Seine Hartnäckigkeit verblüffte sie.
»Aber …«
»Nein, gebt Euch keine Mühe!«
»Ihr habt mein Herz …«
»Ach, was! Im Handumdrehen lauft Ihr einem andern Rock hinterher, und auf mich wartet jetzt Sankt Katharina.«
»Ihr solltet besser zur heiligen Wilgefortis beten.«
Sie schaute ihn skeptisch an und ebenso neugierig.
»Im Kirchlein zu Neufahrn bei Freising«, erklärte Siegfried, »sah ich ein merkwürdiges Kreuz, an dem der bärtige Heiland in ein langes Kleid gehüllt hing. Ein altes Weiblein erklärte mir, es sei in Wahrheit die gemarterte Wilgefortis. Um sich vor heidnischen Verehrern zu schützen, flehte die Jungfrau zu Gott, er möge sie so verwandeln, daß sie keinem Mann auf Erden mehr gefalle. Und siehe da: Über Nacht wuchs ihr ein prächtiger Bart.« Er deutete eine Verbeugung an, empfahl sich rückwärts und bemerkte grinsend: »Ich bin sicher, der Herr wird auch Euer Flehen erhören.«
»O Ihr Scheusal! Schert Euch zum Teufel!« schimpfte die Hafnerin und rauschte mit unfrommen Wünschen in das Gotteshaus.
»Hör zu«, sagte Agnes, die Wirtin, »wir müssen miteinander reden.«
Wie sie es sagte, noch dazu am Samstag morgen, das ließ Peter Barth nichts Gutes erahnen. Sie war einige Jahre älter als er und hatte ihm auch eine gute Spanne an praktischem Sinn und Entschlossenheit voraus. War dies der Grund, warum sie frank und frei vorschlug: »Wir sollten heiraten«, so daß er sich heftig am Dünnbier verschluckte? Oder hatte es damit zu tun, daß sie in letzter Zeit häufiger nach Unserer Lieben Frau zur Frühmesse ging?
Er konnte nicht wissen, daß an diesem Tag der Prediger des Todestages von Kirchenlehrer Johannes gedachte und ihn, den sie seiner schönen Reden wegen Chrysostomus nannten, was Goldmund heißt, zu Worte kommen ließ. Er schmähte die Weiber als notwendiges Übel und häusliche Gefahr, als einen Mangel der Natur, mit schöner Farbe bemalt. Ihre herrlich geformten Körper geißelte er als weiße Grabkammern, gefüllt mit Unrat. Und den, der diesen Reizen erlag, verhöhnte Goldmund: »Wenn du einen Stoffetzen siehst, von Schleim und Spucke beschmutzt, magst du ihn nicht mit der Fingerspitze berühren, aber du zitterst voller Begierde, wenn du einen Körper voll solcher Substanzen siehst.«
Sein weiser Rat also lautete: Es frommt nicht zu heiraten. Aber Agnes tat gerne genau das, was man nicht von ihr erwartete.
»Wie kommst du darauf?« fragte Peter vorsichtig. »Es hat dich doch bisher nicht gedrängt.«
In der Tat hatte sich die Wirtin des Maenhartbräu nach dem frühen Tod ihres Mannes wenig aus dem Geschwätz der Leute gemacht, und Peter erinnerte sich gerne daran, wie sie ihn vor über einem Jahr das erste Mal mit in ihre Kammer nahm und ihn all das lehrte, was auch der Klerus genoß, aber zugleich als Lüsternheit und Unersättlichkeit des Weibes verdammte. Er hatte sie damals als schön und begehrenswert empfunden, und selbst jetzt, als sie vom Heiraten sprach, glaubte er sich nicht in einer Teufelsschlinge gefangen.
»Ich mag’s nicht mehr wie bisher, Peter. Es ist an der Zeit, die Dinge zu klären.«
»Bist du meiner überdrüssig?« argwöhnte er.
»Aber nein, du Dummbart, ganz und gar nicht« – sie griff nach seiner Hand –, »es ist nur … ich will wissen, woran ich bin.«
»Wie meinst du das?«
»Sieh mal, wenn dir in ein paar Jahren eine hübsche Larve oder ein schlanker Hals vielleicht besser gefallen als meine ersten Falten, dann ist es für mich zu spät. Ich denke dabei auch an die Kinder und …« – sie schenkte ihm ein warmherziges Lächeln – »ich hätte gerne noch mit dir einen Sohn.«
»Ei... einen S...sohn«, stammelte Peter und ließ dabei einen halben Löffel Haferbrei wieder aus dem Mund laufen.
»Ich dachte, du freust dich.«
»J... ja schon. Es kommt nur so … so …«
»Es geht auch um die Zukunft des Gasthauses«, fuhr Agnes deutlich kühler in ihrer Argumentation fort. »Ich brauche endlich wieder einen Mann, auf den ich mich verlassen kann. Und ich mag’s auch nicht mehr, wenn die Leute so über mich reden.«
»... so plötzlich, alles so plötzlich«, wunderte sich Peter noch immer.
»Es ist nicht unbillig«, verteidigte sich Agnes. »Du hattest lange genug Zeit, und eigentlich sollte es von Dir kommen.«
»Jaja, schon richtig …«, stimmte Peter monoton und geistesabwesend zu. Er hatte stets gewußt, daß die Entscheidung eines Tages auf ihn zukommen würde und schob sie dennoch vor sich her, wie der Papst die ungeklärte Frage der Armut.
Sein Blick streifte fast wehmütig über ihr kastanienbraunes Haar, das sie zu Hause nicht züchtig verbarg. Wie liebte er diesen rötlichen Schimmer und ihre grünbraunen Augen, deren Blick er diesmal nicht standhielt. Sie war noch immer begehrenswert schön. Er spürte wieder dies Verlangen und wußte zugleich, daß es künftig zu einem höheren Preis gehandelt wurde.
»Überleg’s dir, ich meine es ernst«, bestätigte ihn Agnes darin.
»Es ist eine zu ernste Angelegenheit, meine Tochter, als daß sie von dir entschieden werden könnte.« Der Gesellpriester meinte die Ehe und daß angemessene Verheiratung Männersache sei.
Eigentlich wollte sich Wiltrud an Pfarrer Konrad wenden mit der Frage, ob es sündhaft sei, sich der Wahl des Vaters zu widersetzen. Er war erkrankt, und so mußte sie sich dem neuen Gehilfen offenbaren, dieser asketischen Säule der Frömmigkeit, die zwar andeutete, daß der Kirche an einem consensus der Brautleute liege, es aber dennoch für geboten hielt, sich zu fügen. Denn wollte ein Mädchen den ihr Zugedachten nicht akzeptieren, so lag doch der Schluß nahe, daß sie einen anderen liebte. Da solcherart Liebe kaum caritas im Sinne von Ehrerbietung und Nächstenliebe war, blieb nur der Eros, was Wollust und Triebhaftigkeit und somit schwere Sünde bedeutete.
Das Weib, sagte er abfällig unter Berufung auf Thomas von Aquin, sei ohnehin nur die Gehilfin des Mannes bei der unerläßlichen Fortpflanzung und dabei untergeordnet, wie es in der einzig zulässigen Stellung der copula carnalis zum Ausdruck komme, bei der der Mann als höherwertiges Wesen die Frau besteige. Und da allein der Samen des Vaters dem Kind die Gestalt gebe, müsse dies auch den Vater über alles lieben.
Schon der Gedanke, daß ihr cholerischer Vater der Mutter vorzuziehen sei, bereitete Wiltrud Kopfschmerzen, da fügte der Pfaffe ungerührt hinzu, daß selbstverständlich dem Vater das Recht der Züchtigung von Ehefrau und Kindern zustehe, so er die Schläge sorgsam erteile und nicht über alle Maßen prügle. Ihr – inzwischen mehrfarbig schillerndes – Auge lege doch wohl die Vermutung nahe, daß sie es am nötigen Gehorsam fehlen lasse. Er pries die Wahl des Vaters als Fürsorglichkeit, dazu gedacht, sie vor Schaden zu bewahren, denn auf die törichte Vorstellung eines Weibes, alleine durch die Gassen zu ziehen, um ihren Bräutigam zu wählen, gebe schon Salomos Hoheslied die rechte Antwort:
»Die umhergehenden Wächter fanden mich.
Sie schlugen und verletzten mich und rissen
hinfort mein Kleid.«
Seine Augen waren erfrischend blau und erinnerten Wiltrud an den Sänger, aber sie waren auch kalt wie Hagelkörner. Sie hätte schreiend davonlaufen mögen, aber wie unter einem Zwang sich zu rechtfertigen, offenbarte sie, daß sie sich mit dem Gedanken trage, ein Leben in Keuschheit zu führen.
Fast mitleidig über soviel Einfalt erklärte er ihr, daß solches nur in strenger Regel und klösterlicher Zucht möglich sei, da ansonsten durch die sattsam bekannte Verführbarkeit der Frauen der Teufel der Unzucht die Türe aufstoße. Und da die Klarissen und die Seelhäuser vornehmer Stifter kaum mittellose Novizinnen aufnehmen könnten, sei ihr Platz wohl oder übel an der Seite eines Ehemannes. Schließlich sei es auch gottgefällig, in Demut Söhne für den Weinberg des Herrn aufzuziehen.
»Ich dachte, für Euch ist Keuschheit höchstes Gut«, erwiderte Wiltrud nunmehr patzig.
»Zweifellos«, dozierte der Gesellpriester ungerührt, »ist die reine Paradiesehe, wie Joseph sie mit der seligen Jungfrau geführt und Augustinus sie gepriesen hat, höchstes Vorbild. Doch auch du wirst recht handeln, wenn du zwar deinem Mann das Nutzungsrecht an deinem Körper gewährst, dich aber bei der Begleichung des debitums nicht erhitzest und Wollust verspürst, sondern deine Gedanken auf den Allerhöchsten richtest. So leistest du zwar deinem irdischen Herrn in geziemender Weise deine Schuldigkeit, deine Seele aber bleibt dem himmlischen Bräutigam in Keuschheit verbunden.«
»O Gott!« stöhnte Wiltrud, als sie mit pochenden Schläfen und weichen Knien nach Hause taumelte und sich dabei den Schrecken ausmalte, wie Niklas sich in roher Weise auf ihrem steif und leblos daliegenden Körper abmühte, während sie verzweifelt versuchte, ihre Gedanken auf Höheres zu richten.
»Gütiger Gott«, stammelte sie, »das kannst du nicht wollen!«
Und was der Pfaffe noch Häßliches über die Ahn und ihre verstorbene Mutter gesagt hatte … Sie würgte. Zu ihren rasenden Kopfschmerzen gesellte sich Übelkeit, unbezwingbare, ihr Innerstes durchflutende Übelkeit, und sie erbrach sich in den Stadtbach, bis nur noch bittere Galle kam.