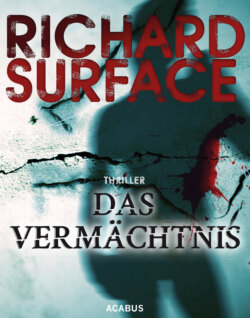Читать книгу Das Vermächtnis. The Legacy - Richard Surface - Страница 10
ОглавлениеKapitel 6
Zwischen Verona und Vipiteno – 23. Februar 2003
Sie folgten der A22 um Verona herum und erreichten die südlichen Ausläufer der Alpen. Der BMW wurde langsamer, als die Straße anstieg.
„Wie alt ist der Wagen?“, fragte Gabriel.
„Von 1958“, sagte Whyte. „Ich habe Sicherheitsgurte und ein Kassettendeck eingebaut. Alles andere ist original.”
„Hoffentlich nicht die Reifen.“
„Riech mal das Leder!“, sagte Whyte. „Und fühl über das Chrom!“
„Sehr schön … Könnten wir mal für einen Kaffee anhalten?“
Zehn Minuten später fuhren sie bei einer Tankstelle raus. Gabriel kaufte zwei Espressi, während Whyte tankte und in bar bezahlte. Er zeigte nach Norden. Ein grauweißer Vorhang legte sich über das Land, wo an einem klaren Tag die Berge zu sehen waren. Eine halbe Stunde später schaltete Whyte die Nebelscheinwerfer ein. Gabriel sah auf den Tacho.
„Wenn wir in diesem Tempo weiterfahren, sind wir erst weit nach dem Abendessen da.“
„Wenn ich schneller fahre“, sagte Whyte, „kommen wir vielleicht gar nicht an.“
Wie zum Beweis, bremste Whyte scharf, als sich vor ihnen im Nebel das Hinterteil eines LKW materialisierte. Whyte drosselte weiter das Tempo und lehnte sich vor, um durch die Windschutzscheibe zu sehen. Gabriel blieb ruhig, um ihn nicht abzulenken. Schließlich sagte Whyte: „Hast du eine Idee, wo wir gerade sind?“
„Gerade an Trento vorbei. Wir sind jetzt in Südtirol. Sehr hübsch, wenn man etwas sehen könnte.”
„Das ist, als würde man durch Watte fahren.“
„Und es ist zehn vor vier, und wir müssen noch ungefähr dreihundert Kilometer fahren. Bei einer Geschwindigkeit von sechzig Kilometer pro Stunde kommen wir heute noch nach Lech, aber sehr spät. Vielleicht haben wir Glück und es klart noch auf.“
Aber das tat es nicht. Innerhalb von Minuten wurde der Nebel noch dichter, und der Wagen schlich im dritten Gang voran. Whyte musste hin und wieder das Steuer herumreißen, um auf der Straße zu bleiben. Rechts konnten sie ein Schild im Nebel erkennen.
„Bozen“, sagte Gabriel.
„Scheiße, schon fünf Uhr“, sagte Whyte, „und es ist dunkler als im Arsch des Teufels!“
„Noch zweihundertfünfzig Kilometer bis Lech“, sagte Gabriel und sah auf den Tacho. „Wenn es so weitergeht, sind wir doch erst morgen da.“
Whyte sah ihn an. „Tu mir einen Gefallen“, blaffte er. „Hör auf mit diesem Entfernungsscheiß. Ich brauch keinen verfluchten Co-Piloten. Aaah!“ Er riss das Steuer hart nach rechts, als vor ihm aus dem Nichts Scheinwerfer auf der Spur auftauchten, auf die er gewechselt war. Ein Ausfahrtschild tauchte rechts auf, und Whyte fuhr ab. Er hielt an dem unbefestigten Fahrbahnrand.
„Wir müssen uns eine Pension suchen“, sagte er, „und hoffen, dass es bis morgen aufklart. Vielleicht muss ich eine Kreditkarte benutzen, was ich nicht will. So hätte das eigentlich nicht laufen sollen.“
„Tommaso nimmt uns auf“, sagte Gabriel. „Am Wochenende ist er oft bei seiner Mutter. Das ist nicht weit von hier, in der Nähe von Vipiteno.“
Whyte sah ihn zweifelnd an. „Tommaso?“
„Ich dachte, Sie würden die Freunde von Großvater kennen?“
„Dein Großvater hat immer schön dicht gehalten. Ich weiß nichts über sein Privatleben.“
Gabriel sah auf sein Handy. „Tommaso ist Großvaters Patensohn. Er hat versucht, mich anzurufen.“ Er klickte sich zu der Nummer, aber sein Daumen schwebte einige Sekunden über dem Anrufknopf. „Oder vielleicht suchen wir uns doch eine Pension“, sagte er mit gesenktem Kopf.
Eine Weile herrschte Stille.
„Das ist normal“, sagte Whyte.
Gabriel sah auf.
„Dass man nicht darüber reden will“, fuhr Whyte fort. „Nicht mal mit der Familie. Trauer ist egoistisch.“
Gabriel sah einen Moment lang verwundert aus. Dann nickte er und drückte auf den Knopf. „Ich kann ihn nicht ignorieren“, sagte er. „Nicht Tommaso … Hallo“, sagte er in sein Handy. „Signora Zennetti? Hier ist Gabriel Schopenhauer … Hallo? … Signora, Tommaso hat versucht, mich anzurufen. Kann ich ihn bitte sprechen? … Oh … Gut … Ich ruf ihn dann dort an … Nein, ich bin nicht in Pistoia. Eigentlich bin ich gerade mal dreißig Kilometer vor Vipiteno … Wir wollen nach Lech, aber Nebel hat uns aufgehalten. Wissen Sie vielleicht eine Pension in …“
Whyte sah zu, wie Gabriel das Handy fester ans Ohr drückte und sich seine Augenbrauen zusammenzogen.
„Aber Signora …“ Gabriel hörte mit geschlossenen Augen zu. Dann verabschiedete er sich und legte auf.
„Was?“, fragte Whyte.
„Tommaso ist dieses Wochenende in Florenz. Um mit mir zu reden … Aber sie hat darauf bestanden, dass wir bei ihr übernachten.“
„Das scheint dich nicht richtig froh zu machen“, sagte Whyte.
„Als ich ihr gesagt habe, dass wir auf dem Weg nach Lech sind, hat sie Italienisch gesprochen.“
„Sie glaubt, dass du lange genug hier wohnst, um wenigstens ein bisschen was zu verstehen.“, sagte Whyte trocken.
„Hab ich auch. Es waren die ersten Worte auf Italienisch, die ich gelernt habe. Aber ich hab sie noch nie von einer alten Frau gehört.“
„Was?“
„Obszönitäten. Und dann sagte sie auf Englisch: Gabriel, wir müssen reden.“
In der Nähe von Vipiteno – 23. Februar 2003
Signora Zennettis Häuschen stand am Ende eines Feldwegs, der sich durch eine bergige Region wand, die in den Tälern und Schluchten von reißenden Bächen und kleinen Seen durchzogen war. Gabriel erinnerte sich daran, gelesen zu haben, dass diese Seen nicht von alpinem Tauwasser, sondern von Thermalquellen gespeist wurden. Er öffnete das Fenster und atmete die nach Pinien duftende Luft tief ein. Er erklärte Whyte den Weg, wie Tommasos Mutter ihn ihm erklärt hatte. Um kurz vor sechs verlangsamte Whyte das Tempo und bog in die Einfahrt.
Tommasos Mutter stand in der Tür, als sie anhielten. Signora Zennetti war eine große, gepflegte Erscheinung mit einer dichten weißen Mähne und Tommasos schwarzen Augen. Sogar auf die Entfernung hatte sie die furchteinflößende Ausstrahlung einer pensionierten Schulleiterin. Bei ihrem Anblick dachte Gabriel mit einem Mal, dass es vielleicht doch eine bessere Idee gewesen wäre, im Auto zu schlafen. Whyte schien es genauso zu gehen.
„Sie gehört dir“, sagte er grimmig. „Ich bin nur der Chauffeur.“
„Haben Sie Angst vor Frauen?“
Whyte schnaubte. „Gelegentlich. Tödlicher als Männer.“
Aber als Gabriel näher trat, beruhigte ihn die Wärme ihrer Begrüßung sofort wieder. Signora Zennetti streckte ihm beide Hände entgegen, schenkte ihm ein mütterliches Lächeln und betrachtete sein Gesicht. „Ich bin so froh, dich endlich wiederzusehen, Gabriel“, sagte sie mit ihrer tiefen, melodischen Stimme. „Nur die Umstände machen mich sehr traurig.“
Sie führte die beiden Männer ins Haus und eine enge Treppe hinauf, um ihnen die beiden Gästezimmer zu zeigen. Eine halbe Stunde später saßen sie an einem Holztisch mit dicken Tischbeinen, der mitten in einem langgezogenen Raum stand. Eine offene Küche befand sich an einem Ende, ein Kamin mit zwei Rohrsesseln am anderen. Die Decke zeigte freiliegende Holzbalken voller Wurmlöcher. Die einzige Dekoration an der Wand war eine Serie eindrucksvoller Farbfotografien von Fresken, die Gabriel an etwas erinnerten.
Während Whyte und er die Penne mit Pesto herunterschlangen, schielte er verstohlen zu ihrer Gastgeberin. Er versuchte, aus ihr schlau zu werden. Obwohl es in dem Zimmer warm war, trug Signora Zennetti einen Umhang über ihren dünnen Schultern. Sie hielt sich mühelos aufrecht und gerade und sah ihnen beim Essen zu. Er hatte erwartet, dass sie in Erinnerungen an seinen Großvater schwelgen würde, aber sie sprach kaum, ignorierte Gabriel mehr oder weniger und sah Whyte nachdenklich an.
Whyte schien ihre prüfenden Blicke nicht zu bemerken. Wie bei Gabriel war es für ihn das erste Essen seit dem Frühstück. Er verschlang zwei Teller Pasta und trank mehrere Gläser Wein, die er sich aus einem Keramikkrug nachschenkte. Dann lehnte er sich zurück, bedeckte ein Rülpsen mit seiner Serviette und deutete auf die Bilder an der Wand.
„Ich hab’ schon viele Fotos von der Brancacci Kapelle gesehen“, sagte er. „Aber diese hier sind so echt, als wäre man dort. Wer hat sie gemacht? Wissen Sie das?“
„Ja. Ich.“
„Sie?“ Whyte hob die Augenbrauen. Dann prostete er ihr zu, verschüttete dabei etwas Wein, trank und füllte sein Glas wieder auf. Signora Zennetti betrachtete ihn mit einem Ausdruck, der Gabriel mit seinem Stuhl vom Tisch zurückweichen ließ, als müsse er sich aus der Schusslinie begeben.
„Sie scheinen überrascht, Mr. Whyte“, sagte sie leise.
„Nein, nein.“
„Frauen können eine Kamera bedienen.“
„Ich erzähl’ Ihnen mal was. Ich bin immer wieder erstaunt, was Frauen alles können. In Glasgow kannte ich mal ein Mädchen …“
Gabriel unterbrach ihn eilig: „Sie waren Profifotografin, Signora? Sind diese hier veröffentlicht worden?“
„… die war unglaublich gelenkig, falls sie überhaupt Gelenke hatte!“, fuhr Whyte fort. „Sie konnte ihr Bein – und zwar gerade ausgestreckt – hochheben bis hinters Ohr. Ich schwör’s.“
Beschämt schloss Gabriel die Augen. Als er sie wieder öffnete, sah er, wie Tommasos Mutter Whyte mit einem wissenden Blick betrachtete. Und Whyte sah sie mit offener Bewunderung an.
„Mr. Whyte“, sagte sie zu Gabriel, „ist das, was Feministinnen ein sexistisches Schwein nennen.“
„Sie sind zu feminin, um eine Feministin zu sein, Signora“, sagte Whyte. „Außerdem haben Sie viel zu schönes Haar. Ich habe noch nie eine Feministin mit schönem Haar getroffen. Die Pasta war übrigens ganz unglaublich.“ Er grinste und hob beide Hände. „Ich bin allerdings wirklich irgendwie ein Schwein, das stimmt. Das sind verdammt gute Fotos. Verdammt gut.“ Er rülpste noch einmal, diesmal jedoch, ohne seinen Mund zu bedecken. In der Zwischenzeit blieb sein umherschweifender Blick an einem bestimmten Foto hängen. Es zeigte einen ernst aussehenden, weißbärtigen Mann, der gerade Wasser aus einer Schale über einen Jugendlichen goss, der in einem Fluss kniete.
„Die Taufe des Neophyten“, sagte Signora Zennetti, die seinem Blick gefolgt war. „Vielleicht ist das Ihre selbsterwählte Rolle, Mr. Whyte. Sie als der heilige Petrus, und Gabriel als der junge Akolyth? Jetzt, da Maximilian gestorben ist, nehme ich an, Sie werden seinen Enkel in Ihre … Ihre Welt einführen.“ Sie zog die letzten Worte bedeutsam in die Länge.
Whyte hatte sein Glas zum Mund geführt, ließ es dann aber wieder sinken, ohne davon getrunken zu haben. Er zog die Augenbrauen nachdenklich zusammen.
„Vielleicht wissen Sie es nicht, Signora“, sagte er, „aber Ihre letzte Bemerkung trifft mich doch sehr …“
„Wenn das auf dem Bild Wein wäre statt Wasser“, unterbrach Gabriel mit einem kleinen, nervösen Lachen, „würde er es sich natürlich lieber in den Hals schütten.“
Seine Gastgeberin ignorierte ihn. „War es Ihre Idee, Gabriel nach Lech zu bringen?“, fragte sie Whyte.
„Meine“, sagte Gabriel rasch.
Sie wandte sich zu ihm. „Dann überleg es dir anders. Morgen fährt um halb sieben ein Zug von Vipiteno. Du musst zweimal umsteigen, aber bis zum Mittag bist du in Florenz. Ich kann dich zum Bahnhof bringen.“
Es folgte eine bedrückende Stille. Signora Zennetti wandte sich wieder zu Whyte und starrte ihn an. Er sah auf und hielt ihrem Blick einen Moment lang stand. Dann trank er den letzten Schluck Wein aus, erhob sich, bedankte sich für das Essen und entschuldigte sich. Er schwankte etwas und hielt sich am Geländer fest, als er die Treppen hinaufstieg.
Signora Zennetti sah ihm mit steinernem Gesicht nach, bis er verschwunden war. Dann wandte sie sich an Gabriel. Der Schulleiterinnenausdruck kehrte in ihr Gesicht zurück.
„Also?“, fragte sie.
„Signora, ich fahre nur für einen Tag nach Lech, um Großvaters Sachen durchzusehen. Vielleicht gibt es da etwas, das er mir hinterlassen hat, und ich will es vor der Polizei finden.“
Sie stand mit blassem, bestimmtem Gesicht auf und fing an, den Tisch abzuräumen. Gabriel erhob sich unsicher und folgte ihr mit seinem Geschirr in die Küche. Er murmelte Dankesworte für das leckere Essen und fügte hinzu, dass es spät war und er ebenfalls schlafen gehen würde. Sie schüttelte den Kopf.
„Wir müssen reden.“
Gabriel spürte die Erschöpfung wie mit eisernen Ketten an all seinen Gliedern zerren. Er wollte nur noch hochgehen und ins Bett fallen. Stattdessen schlurfte er gehorsam zurück zum Esstisch, setzte sich, und gleich darauf gesellte sich seine Gastgeberin zu ihm. Sie sah nun so erschöpft aus, wie er sich fühlte.
„Gabriel, es tut mir so leid. Es tut mir so wahnsinnig leid.“ Sie sprach mit der Stimme einer alten Frau, die keine Tränen der Trauer mehr übrig hatte. „Aber das Leben geht weiter …“ Sie betrachtete ihn einen Moment lang. „Du ähnelst deinem Großvater sehr“, sagte sie ernst. „Breite Schultern, dieselbe Nase, dieselben Augen, auch wenn die von Maximilian kälter waren. Der Krieg hat ihm das angetan.“ Sie sah kurz zur Treppe hinüber. Ihr Blick wurde hart. „Aber nicht einmal Maximilian hätte zugelassen … “
„Sie meinen, weil ich nach Lech will. Mr. Whyte hat keine Schuld daran. Er wollte nicht, dass ich …“
„… wenn noch ein Mörder da draußen herumläuft. Was sagt deine Frau dazu?“
„Also, sie … Ich hab ihr eine Nachricht hinterlassen.“ Er wich ihrem Blick aus.
„Du hast ihr eine Nachricht hinterlassen“, sagte sie mit Nachdruck.
„Wie auch immer, Signora, das ist doch keine große Sache. Die Polizei kommt auch dorthin … bald.“
„Die Polizei kommt immer dann“, sagte sie und betrachtete ihn mitleidig, „wenn es zu spät ist. So wie 1969.“
„Was?“
Sie setzte sich wieder aufrecht hin und zog den Umhang fester um ihre Schultern. „Tommaso würde mir jetzt sagen, ich solle den Mund halten. Es gehe mich nichts an, da es nicht meine Familie sei. Aber es ist meine Familie, und er sollte so nicht mit seiner Mutter reden.“ Ihre wässerigen Augen hörten auf, durch den Raum zu irren und blieben auf Gabriels Gesicht ruhen. „Maximilian hat es dir nie erzählt, da bin ich mir sicher. Verschlossen wie der Vatikan, der Mann.“
„Signora?“
Sie legte ihre Hände flach auf den Tisch und betrachtete sie eine Weile. „Aber ich werde es dir erzählen“, sagte sie leise. „Und wenn dich das nicht zurück nach Pistoia bringt … Gabriel“, sagte sie und sah ihn an. „Dein Urgroßvater, Armande Montmorency, was weißt du über ihn?“
Gabriel zuckte zusammen. „Großvaters Schwiegervater? Nichts. Warum? Ich meine, er ist vor langer Zeit gestorben. Bevor ich geboren wurde.“
„Er starb 1969, vor vierunddreißig Jahren. Aber er ist nicht ‚eingeschlafen‘. Er wurde ermordet. Erschossen. In Florenz, direkt vor mir.“ Sie hielt inne. Ihre Augen suchten sein Gesicht. „Wenn du morgen nicht den Zug nimmst, wird mit dir dasselbe geschehen.“
Er wusste nicht, wie lange er sie anstarrte, ohne zu atmen.
„Ermordet? Warum?“
„Um das zu bekommen, wonach du suchst. Sie haben Armande deshalb getötet – und sind gescheitert. Maximilian bekam es. Sie haben ihn deshalb getötet. So, wie ich Max kenne, sind sie wieder gescheitert. Und jetzt erbst du. Du bist an der Reihe.“
In dem Zimmer war es so still, dass Gabriel glaubte, die Luft wäre daraus entwichen.
„Um was geht es da?“, fragte er.
Feuer schoss aus ihren Augen. Sie war sichtlich bis aufs Mark erschüttert. „Porca vacca!“, blaffte sie. „Ist das nicht egal? Darum geht es gar nicht. Wichtig ist nur, dass es dich umbringen wird. Willst du das? Die Tradition aufrechterhalten? Den Familienfluch weitertragen? Basta.“
Gabriel nahm ihren Zorn kaum wahr. Er starrte sie mit offenem Mund an. „Sie waren dort? Sie kannten meinen Urgroßvater?“
Ihr Ärger verrauchte mit einem Mal. Sie blickte still in die Ferne. „Wir haben uns geliebt, Armande und ich.“ Sie sah Gabriel rasch an und fügte hinzu: „Nach dem Tod seiner Frau.“
Gabriel blinzelte. Dann riss er die Augen auf. „Tommaso …“, begann er und hielt inne.
„Nein.“ Sie lächelte leicht. „Armande hat ihn wie einen Sohn behandelt, aber Tommasos Vater war … jemand anderes.“ Ihr Lächeln verschwand. „Und ja, ich war dabei, als sie Armande erschossen haben. Nicht nur da …“ Signora Zennetti wirkte nun so mitgenommen, als wäre der Schmerz noch frisch. „Du solltest wissen, was geschehen ist. Vielleicht wird dir das genug Angst machen, um dich zur Vernunft zu bringen. Es war nämlich kein Überraschungsangriff, bei dem ein Mann in seinem Auto oder auf der Straße von einem Gangster erschossen wird. Armande ging zu den Männern, die ihn ermordeten. Er hatte seine Arme weit ausgebreitet. Und ich musste vom Fenster meiner Wohnung aus zusehen …“
„Er ist auf sie zugegangen?“
„Um Maximilian Zeit zu geben, zu verschwinden – und um Tommaso und mich zu schützen. Armande stieß Maximilian zur Tür unseres Hauses hinein, dann verschloss er sie. Maximilian hatte keine Wahl. Er rannte die Treppen hinauf, verbarrikadierte die Eingangstür und rief die Polizei. Sie kamen gerade, als die Schützen gegen unsere Tür schlugen. Tommaso und ich waren in der Küche, Max draußen, nur mit einem Küchenmesser bewaffnet. Die Mörder rannten davon. Tommaso war zehn …“
Gabriel wagte lange Zeit nichts zu sagen.
„Haben sie sie gefangen?“, fragte er schließlich.
Sie brauchte einen Moment, um zu antworten. „In Palermo, wo meine Mutter herkommt, übt man selbst Rache.“
Gabriel zögerte überrascht. „Haben Sie das getan?“
„Maximilian hat es, hoffe ich, obwohl ich ihn nie gefragt habe. Er hatte das Foto, das ich gemacht habe.“ Ihre Stimme wurde so leise, dass Gabriel sich vorbeugen musste, um sie zu verstehen. „Armande hatte mich gebeten, dieses Foto zu machen. Er rief mich voller Panik an, nur Minuten, bevor … Es wurde so scharf wie ein … wie nennt man das, ein Fahndungsfoto. Ich war im vierten Stock und lehnte mich aus dem Fenster. Der Platz war dunkel wie die Sünde. Aber das Gesicht des Mannes, der hinaufsieht … Ich sehe es immer noch … und sein Haar.“
Ihre Finger griffen nach Gabriels Hemd. Ihr Gesicht war blutleer, ihre Augen so groß wie die eines erstaunten Kindes, das sich an seiner Mutter festklammert. „Eine Frau schenkt einem Mann ihr Herz, und dieser Mann bittet sie darum, ein Foto von seinem Mörder zu machen. Was hält man von einem Mann, der so etwas macht?“
Am nächsten Morgen stand Gabriel am Schlafzimmerfenster und rollte die nackten Zehen gegen die Kälte des Fußbodens ein. Signora Zennettis Geschichte ratterte durch seinen Kopf. Mord, der drei Generationen zurückreichte und eine Generation ausgelassen hatte: Gabriels Vater, der sein Leben selbst mit Drogen beendet hatte, bevor er irgendetwas erben konnte, das wertvoll genug war, um dafür ermordet zu werden. Mord wegen „irgendetwas“, etwas von Wert. Interpol dachte, es ginge um Geld, aber Interpol hatte auch von ‚Kultur für alle‘ gesprochen. Bezeichnet ‚Kultur für alle‘ ein Kunstwerk? Aber warum sollte Interpol lügen?
Er tippte eine kürzlich gewählte Nummer in sein Handy.
„Gabriel! Wo bist du?“
Emilys raue Morgenstimme rief ein Bild von ihr auf, wie sie am Frühstückstisch seitlich auf dem Stuhl saß und eine Hand um die Tasse mit grünem Tee gelegt hatte.
Gabriel erzählte ihr alles. Von dem Treffen mit Arthur Whyte über die Kassette, die er der Polizei in Florenz übergeben hatte, bis zu der Geschichte von letzter Nacht, in der es um einen vierunddreißig Jahre alten Mord ging. „Weißt du“, fügte er hinzu, „Tommaso hat mir immer nur von dem Mehrfamilienhaus erzählt, in dem er aufgewachsen ist. Es wurde ‚Bargello‘ genannt, wie das Museum. Aber er hat mir nie von dem Mord dort erzählt. Großvater auch nicht.”
Er hörte, wie ein Stuhl zurückgeschoben wurde. „Inspector Roark war gestern hier“, sagte sie mit angespannter Stimme. „Die Kassette, die du ihm gebracht hast. Da war Musik drauf. Es geht ihm nicht um dich. Er will mit Arthur Whyte sprechen.“
„Musik?“
„Finlandia, wie in einem indischen Callcenter … Gabriel, einfach so abzuhauen, das ist nicht richtig. Ich will, dass du nach Hause kommst! Jetzt!“
„Arthur Whyte hat eine Waffe“, sagte er und bereute es sofort. „Mein Akku hält nicht mehr lange durch.“
„Meine Geduld auch nicht.“
„Es wird nichts passieren. Mach dir keine Sorgen!“
„Dir könnte etwas passieren. Und wozu? Glaubst du, dein Großvater hat dir ein Bündel Geld unter seinem Bett vermacht?“
„Ich muss los.“
„Verdammt.“ Sie legte auf.
Gabriel schluckte den sauren Geschmack im Mund runter, den ihre seltenen Streits mit sich brachten. Er zog sich an, fragte sich, was er sagen könnte, wie er sich bei ihr entschuldigen würde. Sein Handy piepte. Er hatte eine Nachricht bekommen.
„Ruf mich heute Abend an. In Liebe, E.“
Ich muss in einem früheren Leben eine Menge gutes Karma angesammelt haben, dachte er, dass ich eine Frau wie sie verdient habe.
Dreißig Minuten später fuhr Whyte den Wagen vorsichtig rückwärst aus der Ausfahrt. Die Reifen knirschten durch den Schnee, der über Nacht gefallen war.
„Was hat sie dir gegeben?“, fragte er.
Gabriel sah auf den Umschlag auf seinem Schoß, dann wieder zu Signora Zennetti, die im Türrahmen stand. „Einen Talisman. So hat sie es genannt. Vielleicht ist sie eine Hexe.“ Er betastete den Umschlag, aber nichts Festes war darin.
„Sie ist Fotografin. Ich vermute mal, dass es das Foto von dem Mann ist, der deinen Urgroßvater erschossen hat.“
Gabriel sah ihn an.
„Ich saß auf der Treppe und hab’ gelauscht“, sagte Whyte. „Es war so klar, dass sie dir was unter vier Augen erzählen wollte. Deshalb bin ich verschwunden.“
Gabriel blies Luft aus. „Wissen Sie, was ich an Ihnen so mag?“
„Nichts?“
Gabriel wog den Umschlag in der Hand.
„Willst du’s dir nicht ansehen?“, fragte Whyte.
„Ja. Ich werde es mir ansehen.“
Aber als Gabriel auf den Umschlag auf seinem Schoß sah, war er mit den Gedanken woanders. Whyte manövrierte den Wagen durch die engen Kurven der Landstraße, die am Hang hinunter nach Vipiteno entlangführte. Zur Linken blockierte ein hoher Bergkamm das Licht der Morgensonne. Zur Rechten war ein steiler Abhang, der zu einem trockenen Flussbett hinabführte. Gabriel sah Whyte an.
„Großvater hat mir erzählt, dass Sie gern malen. Sie sehen gar nicht aus wie ein Maler.“
Whyte hob die Augenbrauen.
„Ein Mann, der sich wie ein Gentleman kleidet“, fuhr Gabriel fort, „einen Oldtimer fährt, Kunsthändler ist … Ich hätte einen Ästheten erwartet. Stattdessen … sind Sie eher wie so ein rauer Typ aus einem Mickey Spillane-Roman.“
Whyte hob die Schultern. „Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust. Gerade jetzt hat eine die Oberhand.“
Gabriel sah ihn verwundert an, doch dann lenkte ihn eine Bewegung vor dem linken Fenster ab, zu der das Geräusch eines schweren Motors gehörte. Er hatte den flüchtigen Eindruck eines großen, schwarzen Fahrzeugs, das links an ihnen vorbeirauschte.
Es fuhr eine halbe Wagenlänge vor dem BMW, als es plötzlich scharf rechts ausscherte. Seine hintere Tür rammte den linken Kotflügel des BMW mit einem lauten Knall. Whyte schrie auf. Es gab ein schreckliches, mahlendes Geräusch, und Gabriel wurde nach links geworfen. Dabei schlug er gegen Whytes Schulter. Der BMW kam von der Straße ab und kippte der Länge nach zur Rechten. Gabriel wurde gegen die Beifahrertür geschleudert und schlug sich den Kopf am Seitenfenster an. Kiesel regnete auf die Windschutzscheibe, und der hintere Teil des Wagens rutschte weg. Gabriels Gesicht war gegen das Seitenfenster gedrückt. Er erhaschte einen kurzen, erschreckenden Blick auf den felsigen Abhang unter ihnen. Instinktiv zog er schützend die Schultern hoch und erwartete den Sturz in die Schlucht, als sich der Wagen mit einem Mal wieder stabilisierte, die Hinterräder Bodenkontakt bekamen und der BMW auf die Straße zurückzuspringen schien. Zugleich rollten sie auf ebenem Boden vorwärts und blieben dann auf der rechten Spur stehen. Von weiter weg, hinter einer Kurve, war abgeschwächtes Hupen zu hören.
Starr saß Gabriel mit einem Arm gegen das Armaturenbrett gestützt da. „Was zum Teufel war das?“, keuchte er.
Whyte sagte nichts. Er sprang aus dem Wagen und zog mühsam den linken Kotflügel ein paar Zentimeter vom Reifen weg, stieg wieder ein und fuhr langsam bis zur Ortsmitte. An einer Tankstelle blieb er stehen und parkte neben der Waschanlage. Seine Hände lagen auf dem Lenkrad, als er zu Gabriel hinübersah, der die Schwellung an seiner rechten Schläfe befühlte.
„Was?“, fragte Gabriel, als hätte Whyte ihn angegriffen.
„Das war nicht einfach ein rücksichtsloser Fahrer. Er hat versucht, uns da in den Abgrund zu drängen“, sagte Whyte. Er stieg aus und inspizierte den Kotflügel.
Nachdem er sich von dem Schock erholt hatte, ging Gabriel zu ihm. Er sprach zu Whytes Rücken, da der sich hingehockt hatte, um sich den Unterboden anzusehen. „Er ist uns gefolgt?“
„Seit Florenz, nehme ich an“, sagte Whyte, richtete sich auf und klopfte sich die Hände ab.
„Als er zum ersten Mal vom Band lief, da nannten sie den BMW 502 ‚Barockengel‘. Jetzt ist er ein Engel, dem ein Flügel fehlt. Wo zum Teufel soll ich einen original linken Kotflügel für den 502 herbekommen? Wir fahren weiter. Es sei denn …“
Gabriel sah ihn ein paar Sekunden lang verwundert an. Dann verstand er. „Es sei denn gar nichts“, sagte er. „Sie werfen mich nicht am nächsten Bahnhof raus.“
Gleich hinter Vipiteno kamen sie wieder auf die vierspurige A22, die nach Norden zur österreichischen Grenze führte. Der Himmel war wolkenlos, die Straßen frei von Schnee und Eis, aber Whyte fuhr konstant 120. Regelmäßig schaute er dabei in den Rückspiegel. Mit ihren jeweiligen Gedanken beschäftigt, schwiegen sie. Es war fast zehn Uhr, als sie südlich an Innsbruck vorbeikamen und in westlicher Richtung auf der Mautstraße auf den Arlberg zufuhren.
„Ich nehme an, der Typ könnte auch Ihnen gefolgt sein“, sagte Gabriel, „und nicht mir … Sie konnten ihn nicht sehen, oder?“
Whyte schüttelte den Kopf.
„Der Wagen war schwarz“, sagte Gabriel. „Ein SUV, denke ich.“
„Ein Mercedes SUV“, sagte Whyte, „mit kohlschwarzgetönten Fenstern und einem Frankfurter Kennzeichen.“
Sie schlängelten sich durch eine Bilderbuchlandschaft mit kleinen Ortschaften und Zwiebelturmkirchen. Auf einem Schild stand: „St. Anton am Arlberg 100 km“. Der linke Kotflügel fing an zu rattern, und Whyte fuhr auf den nächsten Rastplatz. Ein Tankwart half ihnen mit Klebeband aus, um den Kotflügel an seinem Platz zu halten. Gabriel erzählte Whyte, dass er Emily morgens angerufen hatte. Sie hatte ihm erzählt, dass sich die Polizei die Kassette angehört hatte, allerdings war nichts darauf zu hören gewesen.
„Außer Musik“, fügte er hinzu und sah Whyte scharf an. „Sie haben doch wohl nichts mit der Kassette angestellt, oder?“
Whyte schwieg.
„Hast du zwanzig Euro?“, fragte er schließlich.
„Äh … ja.“
„Gib sie dem Mann.“
Gabriel wollte seine Frage nach der Kassette wiederholen, aber der Ausdruck in Whytes Gesicht hielt ihn davon ab. Er gab dem Tankwart das Geld, und sie stiegen wieder in den BMW.
„Der Inspector von Interpol, Roark, will mit Ihnen reden.“
Whyte sagte nichts, bis sie wieder auf der Straße waren. „Der Kassettenrekorder auf dem Schreibtisch deines Großvaters in München hat eine Weiterleitung. Max könnte sie eingerichtet haben, um die Aufnahme woandershin zu schicken.“
Gabriel starrte ihn von der Seite an.
„Es gibt einen Rekorder in Lech“, sagte er. „Aus irgendeinem Grund hat Großvater ihn in seinem Schlafzimmerschrank aufbewahrt.“