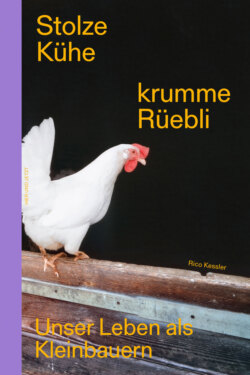Читать книгу Stolze Kühe, krumme Rüebli - Rico Kessler - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Glücklicher Fehlschlag Woher wir kamen
ОглавлениеClaudia und ich lebten damals im hintersten Winkel des Berner Jura, in Renan im Vallon de Saint-Imier. Wir kamen beide nicht aus bäuerlichen Familien. Claudias Vater entstammte einer Arbeiterfamilie. Er war gelernter Küfer und als Kellermeister bei einem Grossverteiler angestellt. Mein Vater hatte als jüngster Spross einer 13-köpfigen Bergbauernfamilie eine Schlosserlehre bei der Rhätischen Bahn absolvieren können. Er arbeitete später als Konstrukteur in der Textilmaschinenindustrie. Unsere Mütter, ursprünglich Büroangestellte und Fabrikarbeiterin, fügten sich in die klassische Hausfrauenrolle. Die Familienfotos der Staubli und Kessler aus den 1970er-Jahren gleichen sich wie ein Ei dem anderen. Helvetisches Mittelstandsleben mit karierten Tischdecken aus Wachstuch, Sonntagsspaziergängen in Anzug und Kleid, sommerlichen Bergwanderungen zu SAC-Hütten. Und langsam wuchs der materielle Wohlstand. Mit dem Ersparten gönnte sich Claudias Familie alljährlich drei Wochen Sommerferien. Meine Eltern verwirklichten den Traum vom Eigenheim. Die Welt der Landwirtschaft war in beiden Familien jüngste Geschichte, Ferienerlebnis oder beruflicher Bezug. Sie war aber nicht mehr Teil der täglichen Lebenswelt.
Es war kein romantischer Zufall, dass sich 1993 die angehende Berner Landwirtin und gewesene Krankenschwester Claudia und der gelernte Historiker und Aargauer Naturschützer Rico begegneten. Vielmehr stand am Anfang dieser Geschichte ein simples Zeitungsinserat in der linken Wochenzeitung WOZ. Ich suchte, damals ganz städtisch-grüner Single, eine Begleitung für eine Velotour an den Ufern des Flusses Allier im Herzen Frankreichs. Claudia hatte Lust, neue Leute kennenzulernen. Sie las meine Annonce und schrieb mir spontan. Auf den handschriftlichen Brief folgte der Anruf mit dem Wählscheibentelefon. Aus der gemeinsamen Velotour wurde dann mehr. Ich lernte durch Claudia die praktische Landwirtschaft kennen. Erlebte mit, wie sie sich in der konservativen, männlich dominierten Welt der behäbigen bernischen Landwirtschaftsschulen Rütti und Waldhof behauptete. Gemeinsame Monate in Kanada zwischen Landwirtschaft und Wildnis prägten uns. Wir träumten fortan in unserer gemieteten Altliegenschaft bei Aarau von einem eigenen Hof und einem Leben nahe an der Natur. Kein einfaches Unterfangen, wenn man weder einen Betrieb in der Familie noch Millionen auf dem Konto hat. Wir durchkämmten Inserate in der landwirtschaftlichen Presse, nutzten unsere persönlichen Beziehungen, besichtigten da und dort Bauernhöfe. Schliesslich hatten wir Glück. Zusammen mit einem anderen, uns nur flüchtig bekannten Paar aus dem Aargau konnten wir einen Milchwirtschaftsbetrieb im Berner Jura pachten. Wir hatten uns unabhängig voneinander um die Pacht beworben. Unser schnell entworfenes Konzept, den Hof zu viert zu führen, überzeugte schliesslich die Besitzer des frisch renovierten Betriebs. Wir konnten als neue Pächterinnen und Pächter unterschreiben.
Ich gab für diesen neuen Lebensplan meinen Job als Geschäftsführer von Pro Natura Aargau auf. Claudia hatte soeben ihre Landwirtschaftsausbildung abgeschlossen. Es sollte der Start in einen Lebensentwurf werden, den wir nicht zuletzt als Alternative zur Welt von «Hüslitraum», Geldscheffeln und Krawattenkarriere verstanden. Selbstverständlich schlugen wir die Bedenken jener Freunde und Familienangehörigen in den Wind, die das Projekt als ziemlich gewagt, naiv oder riskant einschätzten.
Im Herbst 1996 zogen Claudia und ich, nach einem herrlichen Alpsommer in der Bündner Bergwelt, auf dem Demeter-Hof Jolis Terras ein. Der Winter stand schon vor der Tür. Das Dorf Renan liegt auf 900 Metern über Meer. Das Klima ist ruppig, der Winter lang. Der Tagesablauf für die Stallverantwortlichen: Tagwache um 5.15 Uhr, dann Füttern, Misten und Melken eines Dutzends Milchkühe und der zughörigen Aufzuchtrinder und Kälber. Das klingt überschaubar. Doch unser Stall war zwar neu gebaut, aber sehr arbeitsintensiv eingerichtet: Anbindehaltung der Kühe, Melken mit der Standeimer-Melkmaschine, Heurüsten und Ausmisten von Hand. Als Bio-Betrieb mussten wir ausserdem die Milch in der zwei Kilometer entfernten Dorfmolkerei abgeliefert haben, bevor die konventionellen Kollegen vorfuhren. Vor 6.30 Uhr also wuchtete der oder die Melkverantwortliche die vierzig Kilogramm schweren Milchkannen aus unserem klapprigen Subaru und entleerte sie mit dem Käser durch ein Milchsieb. Wieder zurück auf dem Hof, waren nach dem Frühstück die Kühe einzeln loszubinden und in den Winterauslauf zu entlassen. Während die Horntiere mehr oder weniger vergnügt an der frischen Luft wiederkäuten, musste der Stall geputzt und eingestreut, das Milchgeschirr gewaschen werden. Hühner, Schweine und Milchschafe waren auch noch zu besorgen. Bis dann wieder jede Kuh an ihrem Platz angebunden war, ging es meist schon gegen 10.30 Uhr. Und ab 16.30 Uhr begann das Prozedere von Neuem, lediglich gekürzt um den Auslauf. Ausserdem betreuten wir stundenweise Marcel, einen geistig beeinträchtigten Bewohner der nahe gelegenen Werksiedlung, einer anthroposophischen Behinderteneinrichtung.
1996 gab es noch zahlreiche mittlere Milchwirtschaftsbetriebe, die ungefähr so funktionierten. Besonders war nur der tägliche Auslauf, den wir den Kühen gewährten. Das waren wir den Tieren schuldig, wenn sie schon im Anbindestall leben mussten. Wenigstens waren wir zu viert und konnten uns im Gegensatz zu den meisten Bauern beim Melken abwechseln. Ausserdem brachten wir die Berufskombination Landwirtin, Tierärztin, Mechaniker und Schreiberling auf den Hof. Eine gute Voraussetzung, um sich zu ergänzen und auch ein Einkommen ausserhalb der Landwirtschaft zu erwirtschaften. So dachten wir jedenfalls.
Ein schneereicher Winter stellte uns vor allerlei Herausforderungen. Einmal riss der schwere Schnee die Entlüftungskamine vom Stall, worauf eine Ladung der weissen Pracht durchs Dach in den Stallgang rauschte und die Kühe in Panik versetzte. Die Holzzentralheizung funktionierte nie richtig und setzte im Kessel viel zu viel Teer an. Der leise fluchende Heizungstechniker brauchte einen halben Tag, um den Kessel wieder auszukratzen. Am steilen Talhang schlugen wir Nadelbäume im tiefen Schnee. Einmal entastet, sausten die Stämme durch den Wald hinunter ins angrenzende Wiesland. Das war die ortsübliche Praxis, die wir übernahmen. Einmal schrammte ein unverhofft losrutschender Stamm allerdings über Claudias Holzerstiefel. Eine schmerzhafte Delle am Schienbein und ein ordentlicher Schreck waren der Preis für diese glimpflich abgelaufene Erfahrung. Es hätte weitaus schlimmer kommen können.
Für mich waren diese Monate in Renan eine anstrengende Lehrzeit. Sehr anstrengend. Zum morgendlichen Stalldienst wankte ich eher schlafwandlerisch in den Stall. Wenn nach dem «Abeschorre» des Mistes und dem Herumschleppen der Melkeimer die ersten Schweissperlen auf meine Stirn traten, war ich wach. Und spätestens nach dem Mittagessen eigentlich schon wieder bettschwer. Immerhin: Ich lernte innert kurzer Zeit, Kühe einigermassen routiniert zu melken, Traktor zu fahren, Milchschafe von Hand zu melken, Tiere zu füttern, Brennholz zu verarbeiten, Schweine und Hühner zu betreuen. Und ich machte zum ersten und zum letzten Mal die Erfahrung, Schweine in einen Schlachthof zu bringen.
Der Dorfkäser in Renan verarbeitete unsere Milch zu Käse. Nach dem Käsen bleibt eine wässrige Restflüssigkeit zurück, die sogenannte Schotte. Diese Schotte kann als Schweinefutter genutzt werden. Wenn ein Käser nicht selbst Schweine hält, ist er froh, wenn seine Bauern ihm die Schotte für diesen Zweck abnehmen. Deshalb – und weil wir alle Freude an Schweinen hatten – kauften wir im Herbst vier Ferkel. Die fidele Truppe brachten wir in einem Vorbau neben dem Kuhstall unter. Über eine Treppe konnten die Schweinchen in einen Wiesenauslauf gelangen, den sie emsig umgruben. Gelegentlich brach die Viererbande aus und wuselte zwischen den Kühen herum, die ihren morgendlichen Winterauslauf genossen. Wir verfütterten den Schweinen ausser der Schotte Futterkartoffeln, die wir in einem alten Wäschekocher auf dem Hofplatz garten. Schweine vertragen keine rohen Kartoffeln. Im Winter kuschelten sich die vier Schweine tief in ihrem Strohbett eng zusammen. Nur die vier rosigen Stupsnasen lugten noch aus dem Stroh. Dank viel Bewegung, Aussenklima und mässiger Fütterung wuchsen unsere Schweine viel langsamer als Schweine in herkömmlicher Haltung. Und doch kam der Tag, an dem die Tiere im Schlachthof von Saint-Imier zu Fleisch und Wurst verarbeitet werden sollten.
Man hiess uns, die Tiere am Vorabend des Schlachttermins im Schlachthof abzuladen, es habe dort Warteräume. Es war schon dunkel, als wir mit unseren Schweinen bei dem schönen, menschenleeren Jugendstilgebäude beim Bahnhof vorfuhren. Wir entluden die Tiere am vorgesehenen Eingang. Im Dämmerlicht erkannten wir nur allmählich, dass in den Warteräumen und -gängen des Schlachthofs schon zahlreiche Schweine lagen. Sie musterten uns interessiert, grunzten ab und an, blieben aber ruhig. Unseren Schweinen hatten wir für ihre letzte Fahrt im Anhänger Stroh eingestreut. Das gaben wir ihnen in ihr letztes Nachtlager mit. Anschliessend besichtigten wir – da wir nun schon einmal vor Ort waren – die übrigen Räume des Schlachthofs. Treibgänge, Betäubungszange, Brühwanne, Verarbeitungstische. Alles sauber, still, in fahlen Lichtschein von aussen getaucht. Morgen früh würde alles anders sein: Dampf, Lärm, Blutgeschmack, hart arbeitende Menschen und schreiende Schweine.
Wir haben später immer wieder Rinder, Kühe, Schafe oder Hühner zur Schlachtung gebracht und deren Fleisch verarbeitet. Wir tun es nicht mit Leichtigkeit, aber mit Überzeugung. Aber nie mehr Schweine. Wer einem Schwein tief in die Augen schaut, wird das vielleicht verstehen. Schweine sind uns Menschen in vieler Hinsicht sehr ähnlich. Ich finde es entsetzlich, wie mit ihnen weltweit umgegangen wird. Und freue mich über jene Bäuerinnen und Bauern, die diesen fröhlichen, gescheiten Tieren ein wirklich artgerechtes Leben ermöglichen.