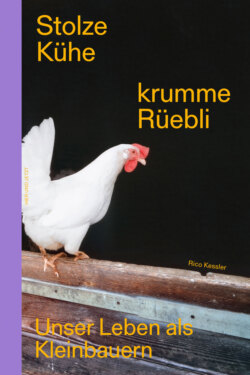Читать книгу Stolze Kühe, krumme Rüebli - Rico Kessler - Страница 26
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Wie wir den Hof Berg bezahlten
ОглавлениеAls wir im Frühjahr 1998 die Hofarbeit anpackten, hatten wir weder Vermögen noch ein geregeltes Nebeneinkommen. Ich rief also mit eher bangen Gefühlen die beiden ökologisch orientierten Banken an, denen ich die Finanzierung unseres Projekts überhaupt zutraute. Doch welch Wunder: Schon nach drei Tagen sassen wir auf unserem Hofplatz einem freundlichen jungen Berater der Basler Freien Gemeinschaftsbank in der warmen Frühlingssonne gegenüber. Der Mann schaute sich alles an, interessierte sich für unsere Absichten und ging dann mit beruhigenden Zusicherungen von dannen. Wir waren verblüfft und erleichtert. Nun galt es, die Bewilligung für den Erwerb des Hofs einzuholen. Landwirtschaftsland dürfen in der Schweiz grundsätzlich nur jene erwerben, die es selbst bewirtschaften und dazu die nötigen beruflichen Voraussetzungen mitbringen. Mit Claudia als gelernter Landwirtin war das keine Hürde. Dann legte der Staat die maximale Belehnungsgrenze für den Hof auf 220 000 Franken fest. Dieses rechtliche Instrument stammt aus Krisenzeiten und soll die Überschuldung von Bauernfamilien verhindern. Weil sich die Belehnungsgrenze daran orientiert, wie viel Geld sich mit einem Hof erwirtschaften lässt, liegt sie besonders bei Kleinbetrieben meist meilenweit unter dem marktüblichen Verkaufspreis der Höfe. Für Kaufwillige ist es dann sehr schwierig, das nötige Geld aufzutreiben.
Die letzte mögliche Hürde für unseren Hofkauf bereitete uns am meisten Kopfzerbrechen. Es handelte sich um ein Vorkaufsrecht für die Nachkommen des früheren Hofbesitzers, das noch bis 2005 gültig war. Wir streckten also vorsichtig die Fühler in Richtung der beiden infrage kommenden Männer aus. Dabei erfuhren wir zu unserer Erleichterung, dass sie ihr Vorkaufsrecht nicht nützen würden. Es war zugleich auch unser erster Einblick in die jüngere, nicht ohne Brüche verlaufene Hofgeschichte. Inzwischen sind wir längst befreundet mit Paul, der einst auf dem Hof Berg aufwuchs und immer noch in Rünenberg lebt. Schon oft hat er uns Einblicke gewährt in die versunkene bäuerliche Welt, die er auf dem Hof noch erlebt hat.
Im September 1998 waren die Geldfragen schliesslich geklärt. Die Bank sprach nach Vorliegen aller Unterlagen ein Hypothekardarlehen von 200 000 Franken. Das versetzte mich damals, unbefleckt von jeder bankfachlichen Kenntnis, in freudiges Erstaunen. Inzwischen ist mir klar, dass das Risiko für die Bank gleich Null war. Wären wir in finanzielle Schieflage geraten, hätte allein der Marktwert des Hofgebäudes unsere potenziellen Schulden um ein Mehrfaches überstiegen.
Es waren also noch 80 000 Franken Eigenkapital zum Kaufpreis von 280 000 Franken beizusteuern. Auch die hatten wir nur ansatzweise. Die Lösung bestand in einem grosszügigen Kredit meines Freundes Jörg und einem Beitrag von Claudias Mutter. Den Rest kratzten wir irgendwie zusammen. Am 26. Oktober 1998 konnten wir den Kaufvertrag unterzeichnen.
Parallel zu den Kaufverhandlungen schaute ich mich nach einem Nebenerwerb um. Als wir auf den Hof Berg gekommen waren, hatten Claudia und ich ausführlich erwogen, ob wir trotz der geringen Grösse des Hofs nicht von der Landwirtschaft allein leben könnten. Auch in den Jahren danach haben wir diese Frage immer wieder einmal aufgegriffen. Wir könnten doch einige Kühe melken, selbst käsen und alles direkt vermarkten? Oder in den Kräuteranbau einsteigen, eine Gemüsekooperative aufziehen, mit Milchziegen ein Nischenprodukt herstellen? Wie wir es auch drehten und wendeten, das glasklare Resultat blieb dasselbe. Eine naturfreundliche, wenig mechanisierte Bewirtschaftung würde sich nur schwer mit der existenzsichernden Produktion von irgendwelchen Spezialitäten in der erforderlichen Menge kombinieren lassen. Ganz zu schweigen davon, dass für die Käseherstellung oder die Kräutergewinnung zuerst einmal grosse Investitionen angefallen wären. Wir waren auch nicht sicher, ob wir einer Kombination aus sehr viel Arbeit und sehr wenig Einkommen gewachsen wären. In Renan hatten wir gelernt, dass die gesellschaftskritische Abkehr von der Geld- und Konsumwelt ganz unverhofft dazu führen kann, dass man sich erst recht mit Geld – oder vielmehr dessen Abwesenheit – auseinandersetzen muss. Das führt zu schmerzhaften Zielkonflikten. Darauf hatten wir keine Lust mehr. Von vornherein ausgeschlossen haben wir zudem einen Betriebszweig, der in der Schweiz stetig wächst und für viele Höfe ein lukratives Geschäft geworden ist. Das ist die Haltung von Pensionspferden. Mit der Pflege eines Freizeitpferdes lässt sich ein Mehrfaches dessen verdienen, was ein Rind im Stall einbringt. Aber unser Ding ist das nicht, das war uns klar. Länger diskutierten wir über die Möglichkeit, durch die Aufnahme und Betreuung von bedürftigen Menschen oder Pflegekindern ein Zusatzeinkommen zu erzielen. Dieser Aufgabe fühlten wir uns aber nicht gewachsen, erst recht nicht mehr nach der Geburt unserer eigenen Kinder. Zwar nahmen wir regelmässig Menschen auf dem Hof auf, doch meist ohne Betreuungsaufgaben und ohne grossen Geldfluss in die Hofkasse.
In unserem Stall in Renan hatten wir erlebt, was es heisst, auf Gedeih und Verderb vom finanziellen Ertrag aus der landwirtschaftlichen Produktion abhängig zu sein. Als wir dort unser erstes Kalb verkauften, bot uns der Viehhändler, klassisch in einen blauen Kittel gewandet, um die 200 Franken für das Tier. 200 Franken für ein munteres Lebewesen, das neun Monate ausgetragen, unter Schmerzen geboren, liebevoll gesäugt und während einiger Wochen von uns gehegt worden war! Ich war empört, aber was blieb uns übrig? Wir konnten das Kalb nicht behalten. Der Händler wunderte sich vermutlich über diesen störrischen Neubauern, dem man den Städter von Weitem ansah. Er legte noch ein paar Franken drauf, ich schlug ein, und er nahm Kälbchen Babona mit. Es würde ein kurzes, trostloses Leben auf einem Kälbermastbetrieb verbringen. Ich stand im Stall, kam mir töricht vor und hatte gelernt, was jeder geborene Bauer von jeher weiss: Wir sind am kürzeren Hebel, wenn wir Produkte in den Handel verkaufen müssen. Die Freiheit, nach eigenen Wertvorstellungen und mit Rücksicht auf Tiere und Natur bauern zu können, würden wir uns daher zukünftig durch ein ausserlandwirtschaftliches Einkommen und durch Direktvermarktung sichern. Claudia würde als gelernte Landwirtin den Hof führen, ich einen Teilzeit-Bürolohn einbringen.