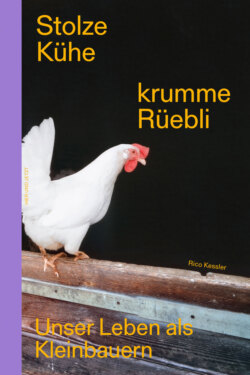Читать книгу Stolze Kühe, krumme Rüebli - Rico Kessler - Страница 25
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Ein neuer Stall muss her
ОглавлениеNoch während unsere Aufzuchtrinder auf saftigen Weiden grasten und Peperoni über die Wiesen tollte und manchmal auch durch die Zäune brach, machten wir uns Gedanken darüber, wie diese Tiere die Wintermonate auf unserem Betrieb verbringen würden. Unsere typische Baselbieter Gebäudezeile bestand in nordwestlicher Ausrichtung aus Wohnhaus, Nebenstall, Futtertenn, Anbindekuhstall, Lagerraum und westlich abschliessend aus einem geräumigen Schopf mit Naturboden. Dort waren im Erdreich zwei Silos eingelassen. Daneben lagerte unsere Hofbesitzerin Margrit das Brennholz. Unser Ziel war klar. Wir wollten unser Vieh weiterhin im Anbindestall füttern, um mit den Tieren in vertraulichem Kontakt zu bleiben. Ausserhalb der Fütterungszeiten sollten die Rinder sich frei in einem Laufstall bewegen können. Baulich gab es mehrere mögliche Varianten, um diese Ansprüche befriedigen zu können. Wir entschieden uns für die vermeintlich einfachste Lösung. Der Schopf am westlichen Ende des Hofgebäudes sollte einen festen Boden mit Ablauf ins «Güllenloch» erhalten und als Liegehalle dienen. Der darüber liegende Dachboden würde als Strohlager genutzt. Allerdings hielt der Gebäudeteil eine unliebsame Überraschung bereit. Der Firstbalken war auf einer Länge von rund zwei Metern komplett durchgefault. Dort war über einen längeren Zeitraum unbemerkt Wasser durch eine undichte Stelle eingedrungen. Überhaupt war die ganze Konstruktion in den 1940er-Jahren zwar solide, aber mit einfachsten Mitteln und äusserster Sparsamkeit durch die damalige Bauernfamilie ausgeführt worden. Die Rundholzkonstruktion aus Fichtenholz war sehr knapp dimensioniert. Wir entschieden uns also, den ganzen Gebäudeteil abzubrechen und in der gleichen äusseren Form neu aufzubauen. Es sollte der Auftakt zu einer Fülle grösserer und kleinerer Um- und Ausbauten werden, die wir damals zum Glück noch nicht so klar vor Augen hatten.
Für unser Projekt war ein Baugesuch erforderlich. Auch ohne Komplikationen dauert es seine drei Monate, bis die Bewilligung vorliegt. Das bedeutete, dass sich die Bauarbeiten zeitlich bis in die Periode der Winterfütterung erstrecken würden. Nicht sehr praktisch, aber wir wagten es nicht, schon vor Eintreffen der Baubewilligung mit den Arbeiten loszulegen. Claudia zeichnete die Pläne für die Baueingabe. Die Bewilligung wurde ohne Umstände erteilt. Die Hauptarbeiten an unserem ersten grösseren Bauprojekt fielen in den regnerisch-kühlen, stürmischen Herbst 1998. Befreundete Handwerker und Bauern führten die Hauptarbeiten aus, Claudia arbeitete täglich tatkräftig mit, fütterte die Rinder und kochte für die ganze Truppe. Ich verdiente an drei Tagen pro Woche Geld mit meinem neuen Job bei Pro Natura, um den ganzen Neubau dann auch bezahlen zu können. Daneben war ich Handlanger. Margrit entnagelte geduldig unzählige Bretter und Balken. Dieses unbehandelte Holz würde im kommenden Winter seinen letzten Zweck erfüllen und uns als Brennholz die Stube wärmen. Mitten im Winter war es dann so weit. Das letzte Brett der Aussenwände war angeschraubt, die Liegehalle mit frischem Stroh eingestreut. Die Rinder konnten einziehen. Der Anblick der ausgelassen herumtollenden, begeistert schnaubenden Herde entschädigte uns für die zeitweiligen Strapazen. Das Stallkonzept mit Liegehalle, freiem Auslauf und Fütterung im alten Anbindestall hat sich über all die Jahre bewährt.
Nur zwei grössere Änderungen waren noch nötig. Den Winterauslauf hatten wir nicht betoniert, sondern als Mergelplatz gestaltet. Das bewährte sich nicht lange. Erstens war das tägliche Aufnehmen der Kuhfladen kaum möglich, ohne zugleich eine Handvoll Mergel in die Karrette zu schaufeln. Zweitens versumpfte die Fläche, wenn der Boden über längere Zeit nicht gefror. Auch plagte uns ein zunehmend schlechtes Gewissen angesichts des versickernden Mistwassers. Nach zwei Wintern betonierten wir also den Auslauf und versahen ihn mit einer Entwässerung ins «Güllenloch». Ebenfalls eine Nachbesserung benötigte der alte Anbindestall. Das individuelle Anbinden der Tiere mit einfachen Halsstricken ging so lange gut, wie wir ausser unserer gutmütigen Pipi nur handzahme Aufzuchtrinder aus der Milchwirtschaft hielten. Kaum nahmen wir zwei Rinder von einem befreundeten Demeter-Mutterkuhbetrieb dazu, war es vorbei damit. Die Tiere waren keine Anbindehaltung gewöhnt. Sie gebärdeten sich entsprechend, wenn wir sie für die Fütterung im Stall fixieren wollten. In lebhafter Erinnerung ist uns das Rind Patagonia. Patagonia erschien uns wie ein Pferd, das aus einer Laune der Natur heraus im Körper eines Rindes geboren worden war. Wenn Patagonia in Aufruhr war – und dafür genügte der kleinste Anlass – trabte sie wie ein Pferd kraftvoll, schnaubend und hocherhobenen Hauptes über die Weide. Wie es uns je gelang, sie bei Beginn der Stallfütterung an den Riemen zu nehmen, weiss ich nicht mehr. Jedenfalls war nicht nur das An-, sondern auch das Losbinden der schnaubenden, tänzelnden Patagonia ein Abenteuer. Ungefährlich war die Sache auch nicht, denn Patagonia war behornt. Wir schufen also schleunigst Abhilfe und montierten im Stall ein Selbstfanggitter. Die Kühe betreten jetzt also zur Fressenszeit den Stall, suchen ihren Platz auf und senken ihren Kopf durch das Gitter ins Heu. Dadurch schliessen sie einen beweglichen Metallbügel und sperren sich selber ein. Je länger die Hörner, desto geschickter müssen ihre Trägerinnen sich einfädeln. Im Moment ist unsere Hinterwälderkuh Fosca die unbestrittene Meisterin in dieser Disziplin. Sie steuert jeweils strammen Schrittes auf ihren Platz zu, schwingt ihre weit ausladenden Hörner millimetergenau und blitzschnell durch die Stahlrohre – und los geht’s mit der Mahlzeit. Übrigens betreten Kühe einen solchen Stall fast immer in streng hierarchischer Reihenfolge. Das hat gute Gründe. Wer an seinem Platz eingesperrt ist, kann ranghöheren Tieren nicht ausweichen. Leichtsinnigen Jungkühen drohen also im schlimmsten Fall Hornstösse durch später eingetretene, ranghöhere Kühe. Umgekehrt wagen es untergeordnete Kühe kaum, ihre Chefinnen zu belästigen, wenn diese schon am Platz stehen.
Apropos Kuhhörner: Sie sind nicht einfach ein Kopfschmuck, sondern ein gut durchblutetes Organ mit einer offenen Verbindung in den Schädel. Hätten sie keine Funktion, wären diese Hörner nicht da. Was sagt es über unser Verhältnis zu den Kühen aus, wenn heute den meisten Kälbern im jungen Alter die Hornanlage ausgebrannt wird?
Wer sein Leben nicht mit Kühen teilt, ist oft erstaunt darüber, dass es unter diesen so sanft und verträumt wirkenden Wiederkäuern überhaupt so etwas wie eine Hierarchie gibt. Tatsächlich aber sind die Spielregeln knallhart. Jedes Tier hat seinen Platz in der Herde. Wenn sich die Leitkuh einer rangniedrigen Gefährtin nähert, genügt ein leichtes Neigen des Kopfes, damit der Weg freigemacht wird. Die Hörner verstärken das Signal. Sie müssen gar nicht als Waffe eingesetzt werden, um Wirkung zu erzielen. Die Hierarchie verbietet aber nicht, dass unterschiedlich positionierte Tiere nicht auch befreundet sein könnten. Unsere Kühe Fosca und Mia putzten einander in ruhigen Minuten hingebungsvoll die Ohren oder schleckten einander mit rauer Zunge die struppigen Hälse ab. Doch diesen Liebkosungen musste das klare Signal der ranghöheren Fosca vorangehen, dass jetzt gerade Vertraulichkeiten gewünscht werden. Wer sich immer wieder Zeit nimmt, eine Kuhherde zu beobachten, wird nach und nach die ausgeklügelte Körpersprache dieser so lange und auch heute oft noch missverstandenen Tiere immer besser verstehen.
Während wir also auf dem Hof Berg die Stallhaltung nach unseren Vorstellungen umbauten, hatte sich auch eine andere wichtige Frage geklärt. Wir waren trotz weitgehender Ebbe auf unseren Konten inzwischen Eigentümerin und Eigentümer des Hofs geworden.