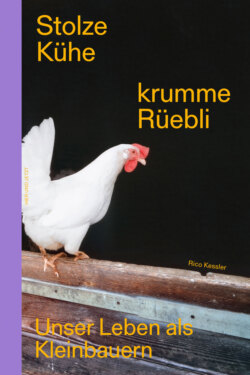Читать книгу Stolze Kühe, krumme Rüebli - Rico Kessler - Страница 22
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Watschelnde Einfalt und bohrende Gartensorgen
ОглавлениеIch vermute, dass Laufenten die dümmsten Tiere sind, die auf diesem schönen Planeten herumwatscheln. Bei der kleinsten Aufregung rennen sie heiser kreischend durcheinander, sausen in Zäune und Wände, purzeln durcheinander und bleiben nicht selten atemlos und scheintot liegen. Drei Minuten später springen sie wieder auf, und die Panik beginnt von vorne. Laufentenmütter schaffen es, ihre Jungen innert kürzester Zeit in kleinsten Tränkebecken ersaufen, von anderen Enten zertrampeln oder sonstwie zu Tode kommen zu lassen. Der viel gerühmte Einsatz von Laufenten als biologische Schneckenbekämpferinnen im Garten entpuppte sich bei uns schnell als Legende. Sie stammt vermutlich aus der Feder von Leuten, die nie Laufenten in ihrem eigenen Garten eingesetzt haben. Sonst wüssten sie, dass die Enten eine ganz besondere Methode haben, zarte Salatsetzlinge vor Schnecken zu schützen: Sie zertrampeln nämlich alles mit ihren Watschelflossen oder fressen den Setzling gleich selbst. Wir liessen unseren Entenbestand daher langsam auslaufen. Eines frühen Abends war es so weit. Ich erblickte vor dem Küchenfenster einen Fuchs. In seiner stolz erhobenen Schnauze zappelte unser letzter Laufentenerpel. Ich gestehe, dass ich der Natur tatenlos ihren Lauf liess.
Am meisten Arbeit steckten wir in den ersten Wochen auf dem Hof Berg in den Garten. In leichter Hanglage in der Verlängerung des Hofplatzes gab es eine ganze Reihe brachliegender Beete. Daneben stand ein hübsches Treibhaus aus alten Fensterscheiben. Der Garten war mit einem metallenen Schneckenzaun eingefasst. Hahnenfuss, Klee, Löwenzahn und allerlei andere Wildpflanzen hatten seit dem Vorjahr Zeit gehabt, den Flecken in Besitz zu nehmen. Wir jäteten also tüchtig, stachen auch einige Beete um und brachten dann Samen und Setzlinge in den Boden. Die Keimlinge und Jungpflanzen hatten mit grossen Widrigkeiten zu kämpfen. Erstens waren wir im Gartenbau nicht sonderlich erfahren (Claudia immerhin bedeutend mehr als ich). Zweitens sperrte der Schneckenzaun eher Schnecken ein als aus. Das Schneckenvolk im Garten war gross, einzelne Exemplare wurden vermutlich mit Mist und Kompost immer wieder neu eingebracht. Und ein zweiter arger Feind riss grosse Lücken in unsere Saaten. Plötzlich welkte ein Salat da, verschwand einer dort. Bleistiftdicke Tunneleingänge liessen uns bald erkennen, mit wem wir es zu tun hatten. Maulwurfsgrillen, auch Werren genannt, taten sich an den Pflanzenwurzeln gütlich. Ich hatte zuvor noch nie ein solches Grossinsekt gesehen. Sein urweltliches Aussehen faszinierte mich. Ausserdem sind Maulwurfsgrillen eine beliebte Nahrung für den Wiedehopf, der sie mit seinem langen Schnabel aus dem Boden stochert. Claudia teilte meine Freude an den Werren ganz und gar nicht. Sie fand sie nicht nur hässlich, sondern stellte zu Recht fest, dass es bei uns schon längst keine Wiedehopfe mehr gab. Fortan zogen wir also nicht nur gegen die Schnecken, sondern auch gegen die Werren zu Felde. Als wirkungsvollste Methode erwies es sich, etwas Salatöl in ein Werrenloch zu giessen und dann mit Wasser aus der Giesskanne den Gang zu fluten. Das töte die Tiere auf umweltverträgliche Weise, hatten wir gelernt. Das taten wir so lange, bis wir eines Tages eine Werre beobachteten, die sich aus einem gefluteten Gang durchs Erdreich ans Tageslicht ruderte. Das Tier versuchte, seinen ölverschmierten Kopf zu reinigen, um wieder Sauerstoff aufnehmen zu können. Immer langsamer wurden seine Bewegungen. Schliesslich starb das Tier. Wir hörten dann leicht betreten auf mit dem Öl. Inzwischen sind wir weitgehend pazifistisch, wenn es um die Bekämpfung von Pflanzenschädlingen geht. Schnecken evakuieren wir, Werren lassen wir Werren sein. Wir sorgen dafür, dass ihnen die schiere Zahl der gepflanzten Setzlinge buchstäblich über den gefrässigen Kopf wächst. Auch Mäuse fangen wir in den Wiesen und Weiden nicht – im Haus gibt es für sie allerdings kein Pardon. Unnachsichtig sind wir eigentlich nur noch im Umgang mit Kartoffelkäfern und ihren Larven, wenn sie zu früh und zu zahlreich über unsere Kartoffelbeete herfallen. Dann werden Käfer und Larven, so prächtig sie auch aussehen, gesammelt und ins Jenseits befördert.
Ausser mit Federvieh und Gartenarbeit beschäftigten wir uns in den ersten Wochen hauptsächlich mit den Vorbereitungen auf den grossen Tag, an dem Oswalds Rinder bei uns einziehen sollten. Das bedeutete vor allem, die Zäune der Dauerweiden zu kontrollieren und instand zu stellen, wo das nötig war. Die meisten Weiden waren mit Stacheldraht umzäunt. Davon gibt es bei uns jetzt schon seit vielen Jahren keinen einzigen Meter mehr. Aber in der Anfangszeit reparierten wir diese Verhaue fleissig. Wir kauften sogar eine Rolle blitzenden neuen Stacheldraht für ein frisch angelegtes Zaunstück. Es ist eine erlesene Mühsal, eine Stacheldrahtrolle zu einem Zaun zu ziehen. Der Draht windet und ringelt sich nach allen Seiten, verheddert sich in Jacke, Hose, Handschuhen. Nach viel Gezerre und Gefluche hängt er dann eher schlaff in den Agraffen. Ich weiss nicht, warum wir uns das antaten. Es war jedenfalls in späteren Jahren ein Vergnügen, Stück um Stück dieses zweifelhaften Materials in unsere Altmetalltonne zu befördern. Heute hängen alle unsere Zäune bedarfsgerecht am zentralen elektrischen Viehhüter. Wir nutzen nur noch Zaunschnüre und stachellosen Draht.
In ihren ersten Kälbertagen machen unsere Rindviecher jeweils die erste schmerzliche Bekanntschaft mit dem Elektrozaun. Es tut uns immer selbst fast weh, die Kälblein hochbeinig und nichtsahnend Richtung Zaun staksen zu sehen, wo sie unweigerlich mit ihrer zartfeuchten Nase an den Draht stupsen – und zack! In der Regel verstehen die Tiere nach zwei, drei Erfahrungen dieser Art, was da passiert. Fortan reicht ein dünner Draht, um auch Kühe von einer halben Tonne Gewicht zuverlässig im Zaum zu halten. Ausnahmen bestätigen die Regel, sind aber zum Glück selten. Ausgebrochenes Rindvieh packt nämlich sofort eine unbändige Wanderlust. Es gab in unserer Gegend einmal einen Trupp von drei ausgebrochenen Rindern, die monatelang durch die Gegend streiften. Geradezu geisterhaft tauchten sie hier und dort auf, verschwanden und zeigten sich ganz unverhofft an anderen Ecken wieder. Sie liessen sich die längste Zeit weder mit Lockfutter noch mit sinnreich konstruierten Zaunlabyrinthen einfangen.
Es wäre höchst unfair, hier die Zaunbaukünste unserer Hofvorgänger zu kritisieren. In den 1980er-Jahren war Stacheldraht noch vielerorts das Mittel der Wahl. Als unsere Vorbesitzerin Margrit mit ihrem Mann den Hof erwarb, standen die beiden schon in den Sechzigern. Sie liessen die nötigen Zäune von einem Arbeiter aus Serbien erstellen. Und dieser Mann hat aus hervorragenden Eichenpfählen fantastische Zäune gebaut. Wahrlich, er verstand sein Handwerk. Heute, nach vierzig Jahren, stehen immer noch einige seiner Zaunabschnitte. Jeder der alten Zaunpfosten ist inzwischen eine kleine Welt für sich. Aus nächster Nähe betrachtet, wächst ein wundersamer Wald aus unterschiedlichen Flechten, Pilzen und Moosen darauf. Allerlei Insekten nisten in Löchern und Spalten. Spechte hinterlassen ihre Spuren am Holz.
Wenn wir nicht im Garten oder an Zäunen werkten, Lampen installierten oder Bücher auspackten, dann erkundeten wir im erwachenden Frühling die Pflanzen- und Vogelwelt unserer fünf Hektaren Land. Wiesen und Weiden hielten keine atemberaubenden Seltenheiten bereit. Das war auch nicht zu erwarten. Der Boden ist nirgends sehr mager oder trocken, auch liegt unser Hof am Nordhang. Entsprechend dominierte im Frühling nach dem ersten violetten Hauch von Wiesenschaumkraut das satte Gelb von Löwenzahn und Hahnenfuss die Wiesen und Weiden. Wir nahmen uns vor, in den kommenden Jahren mehr Vielfalt und Farbe in dieses Grünland – oder besser «Gelbland» – zu bringen. Zahlreich sind hingegen die Gehölzarten an unserem Waldrand, entlang des «Bärgbächli» und im Feldgehölz, das sich an eine kleine Felsnase klammert. Auch die Vogelwelt erschien uns fürs Erste ganz vielversprechend. Stattliche Rotmilane segelten niedrig übers Land, Grünspechte riefen gellend durch Wald und Obstgarten. In der zweiten Aprilhälfte machten die ersten Mehl- und Rauchschwalben Nistmöglichkeiten ausfindig. Es ist für uns immer ein besonderer Tag, wenn zum ersten Mal im Jahr die Schwalben um den Hof zwitschern. Es ist die Zeit, in der auch ihr nachtaktives Pendant bei uns einzieht, das Volk der Zwergfledermäuse. Aus ihren Winterquartieren kehren sie zurück hinter die Fensterläden an unserem Haus. Im schmalen Spalt zwischen der rauen Hausfassade und dem hölzernen Laden machen sie es sich bequem. Später wird dieser Platz ihre Kinderstube, und die Zahl der schwarzbraunen Flattertiere wächst bis gegen hundert Exemplare an. In der späten Abenddämmerung quellen sie hinter den Fensterläden hervor und machen sich in rasantem Flug auf Insektenjagd. Solange es noch genug Insekten gibt, jedenfalls.
Übrigens begleitete uns auch unser treuer Hofhund auf unseren Entdeckungstouren: der stattliche Mischlingsrüde Max, der schon 1996 mit unserem Umzug nach Renan vom Bürozum Hofhund aufgestiegen war. Auf dem Hof Berg erschnüffelte er sich innert weniger Tage seine Beobachtungsplätze, von denen aus er jederzeit den Überblick über das Kommen und Gehen auf dem Hof behielt. An einem dieser Plätze ruht er heute unter einem kleinen Steinhügel.