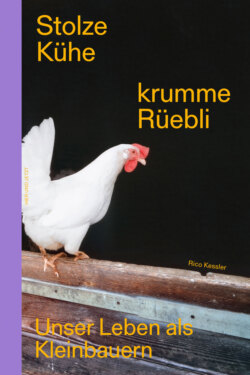Читать книгу Stolze Kühe, krumme Rüebli - Rico Kessler - Страница 23
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Rinder kommen!
ОглавлениеAm 28. April 1998 war es dann so weit: Neun Braunviehrinder hielten Einzug auf dem Hof Berg. Seither gab es keinen einzigen Tag, an dem nicht irgendwo auf unserem Hof Rindviecher grasten, im Stroh dösten, über Weiden stapften, ein Kalb zur Welt brachten, widerwillig in einen Viehanhänger stiegen, sich sommers der Fliegen erwehrten oder im Winter mit Dampfwölklein vor den Nasenspiegeln die frostige Wintersonne genossen. Und an jedem dieser Tage kümmerten sich Menschen (meist wir …) um diese stattlichen Wiederkäuer. Erst die Domestizierung des Rindes ermöglichte dem Menschen die Sesshaftigkeit. Die Rinder stehen am Anfang des kometenhaften Aufstiegs des Homo sapiens. Nach Jahrtausenden einer oft kargen gemeinsamen Existenz hat unsere Spezies jüngst mit titanischen Veränderungen von Erdoberfläche, Untergrund, Biodiversität und Klima ein neues Erdzeitalter eröffnet, das Anthropozän. Die Rinder spielen dabei weiterhin eine tragende, aufgrund ihrer viel zu grossen Zahl leider zunehmend unheilvolle Rolle. Das israelische Weizmann Institute of Science schätzte 2018 den weltweiten Anteil von Nutztieren an der nichtmenschlichen Biomasse von Säugetieren auf 94 Prozent. Der Löwenanteil davon sind Rinder.
Um die Kühe dreht sich eigentlich fast alles auf unserem Betrieb. Es ist dieses «Angebundensein», das so gar nicht mehr in die heutige Welt zu passen scheint. Und das uns zugleich zuverlässig eine Ruhe und Regelmässigkeit schenkt, die wir nicht missen möchten. Unser Bauernsommer ist geprägt durch die Gewinnung von Futtervorräten, um diese grossen, andauernd fressenden oder verdauenden Tiere durch den unweigerlich wiederkehrenden Winter zu bringen. Die biologisch-dynamische Landwirtschaft hat den Begriff des «Hoforganismus» geprägt. Ein schönes Bild; wenn der Hof ein Organismus ist, dann ist die Kuh ganz eindeutig dessen Verdauungssystem. Ganz so führten sich dann im Frühling 1998 auch unsere munteren Neuankömmlinge auf. Mit gesegnetem Appetit machten sie sich über die saftigen Frühlingsweiden her. Wir hatten alle Hände voll damit zu tun, schleunigst alle jungen Obstbäume besser auszuzäunen. Es ist erstaunlich, wie gelenkig ein Rind sein kann, wenn es an einen saftigen Obstbaumzweig gelangen oder eine zarte Baumrinde abknabbern will.
Die Haltung von Aufzuchtrindern für den damaligen Demeter-Milchwirtschaftsbetrieb unserer Freunde Natalie und Oswald entsprach ganz unserer Idealvorstellung von ökologisch sinnvoller Rindviehhaltung. Wir waren Teil eines Systems, das auf der Grundlage von Gras und Heu vielfältige Produkte von Milch über Quark und Joghurt bis zu Fleisch hervorbrachte. Im Vordergrund standen die Milchprodukte, während das Fleisch ein Nebenprodukt war. Unser Hof war damals noch fast ausschliesslich von Milchwirtschaftsbetrieben umgeben. Erst ein Nachbar hielt Mutterkühe, betrieb also reine Fleischproduktion. Innert zwanzig Jahren hat sich dieses Bild komplett gewandelt. Keiner unserer Nachbarbetriebe hält noch Milchkühe. Vielfach haben anstelle des Milchviehs Mutterkühe Einzug gehalten. Mutterkuhhaltung ist Fleischproduktion. Fleisch wird damit vom «Nebenprodukt» der Milchproduktion zum alleinigen Zweck der Kuhhaltung. Dieser Trend besteht in der ganzen Schweiz. Die Zahl der Milchkühe im Land sinkt kontinuierlich. Wundern darf man sich darüber nicht. Milchviehhaltung ist arbeits- und kostenintensiv. Der Milchpreis dagegen ist ein Hohn. Für eine Flasche gezuckertes «Blöterliwasser» bezahlt die Bäuerin als Kundin im Dorfladen mehr, als sie als Produzentin für einen Liter Milch ausbezahlt erhält. Etwas besser geht es immerhin (noch) den Bio-Milchviehbetrieben. Ihnen gelingt eine wirkungsvolle Mengensteuerung. Sie sind gegenüber den grossen Abnehmerinnen nicht so hoffnungslos am kürzeren Hebel wie die konventionellen Betriebe. Den Druck müssen am Schluss diejenigen aushalten, die sich nicht wehren können – die Milchkühe. 1998, als wir den Hof Berg übernahmen, gab es in der Schweiz noch rund 727 000 Milchkühe. 2020 waren es noch 546 000.* Die produzierte Milchmenge ist, von jährlichen Schwankungen abgesehen, in diesem Zeitraum nicht gesunken. Das ist nur möglich, weil ein Teil der Milchkühe artwidrig auf maximale Milchleistung getrimmt wird.
Nun sind grasende Mutterkuhherden mit zufriedenen Kühen, fröhlich herumtollenden Kälbern und einem lässig alles überschauenden «Muni» zwar für alle Kuhfans ein herzerwärmender Anblick. Ökologisch ist die Entwicklung aber nachteilig. Die Kalorienproduktion für die menschliche Ernährung sinkt bei der Umstellung auf Mutterkuhhaltung deutlich, ohne dass entsprechend Kalorien in der Viehfütterung eingespart werden könnten. Oder, wie es ein bäuerlicher Freund einmal kurz und bündig zusammenfasste: «Mutterkuhhaltung ist die ineffizienteste Form der Rindfleischproduktion.» Kommt hinzu, dass die weiter voranschreitende Spezialisierung in der Viehzucht immer extremere Auswüchse hervorbringen wird: hier maximal mastfähige Fleischlieferanten, da knochendürre Geschöpfe mit obszönen Balloneutern. Schon heute lehren uns die Bilder in den Stierenkatalogen der Besamungsfirmen das Grauen. Ein Ende dieser unheilvollen Entwicklung ist nicht absehbar. Tröstlich immerhin, dass viele Landwirtinnen und Bauern diese züchterischen Exzesse nicht mitmachen, zumal sie sich meist auch nicht lohnen.
*Wo nicht anders vermerkt, stammen die verwendeten Zahlen aus offiziellen Quellen, namentlich aus dem jährlichen Agrarbericht des Bundesamtes für Landwirtschaft und den zugrundeliegenden Erhebungen des Bundesamtes für Statistik.