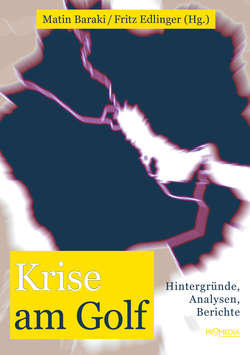Читать книгу Krise am Golf - Robert Fitzthum - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Das Konzept von Sicherheit am Golf
ОглавлениеDie Theorie der Versicherheitlichung scheint besonders gut geeignet, um zu verstehen, wie hinter verschlossenen Türen, in kleinen, sehr zentralisierten Kreisen um einen Monarchen am Golf seit jeher Sicherheitslagen und Bedrohungen definiert wurden. Im Sinne der konstruktivistischen Idee ist Sicherheit kein absolutes, sondern ein relatives Konzept, das gesellschaftlich im Rahmen eines Sicherheitsdiskurses konstruiert wird. Die Protagonisten dieses Diskurses bestimmen, wie Sicherheit definiert wird, wer oder was eine Bedrohung darstellt, und wen oder was man wie schützen sollte. Das Konzept von Sicherheit ist hierbei an den Kontext gebunden, in dem dieser Diskurs stattfindet, der wiederum von ontologischen, weltanschaulichen und persönlichen Faktoren der Protagonisten beeinflusst wird. Der »globale Krieg gegen den Terror« nach dem 11. September 2001 ist ein gutes Beispiel dieser Versicherheitlichung, wobei insbesondere durch die amerikanische Bush-Regierung die Welt in Freunde und Feinde unterteilt und der gesamte Sicherheitsapparat der USA für die Bekämpfung dieser einen immateriellen und ungreifbaren Bedrohung gleichgeschaltet wurde.
In den autokratischen Monarchien des Golfs ist dieser Sicherheitsdiskurs traditionell einer kleinen Elite vorbehalten, die zumindest im analogen Zeitalter ohne »soziale Medien« nie auf die öffentliche Meinung Rücksicht nehmen musste. Der König, der Emir oder der Sultan und seine direkten Berater treffen Entscheidungen oft ohne die jeweiligen Ministerien heranzuziehen, die oft nur mit der Umsetzung betraut werden. Obgleich der Kreis derer, die zu diesem Diskurs beitragen, auch in liberalen Demokratien meist sehr übersichtlich ist, so gewährleistet zumindest in der Theorie der demokratische Prozess einen Grad von Kontrolle. Ohne demokratische Kontrolle und Verantwortung findet die Versicherheitlichung am Golf oft in den Köpfen einiger weniger statt, die Konzepte von nationaler Sicherheit und Regimesicherheit miteinander gleichsetzen. Das Überleben des Regimes wird zu einem Faktor nationaler Sicherheit hochstilisiert. Die Grenzen zwischen internen und externen Bedrohungen verschmelzen.11
Das Verständnis von Sicherheit als die Abwesenheit von Bedrohung gegen das Fortbestehen der Stammesmonarchien war und ist immer noch weit verbreitet. Obwohl es bereits seit der Unabhängigkeit der kleineren Emirate in den 1960er und 1970er Jahren große Unterschiede in der Bewertung der Bedrohungslage gibt, so besteht dennoch einen Konsens, dass das Überleben des Regimes oberste Priorität hat – ein Konsens, den nur die regionale Supermacht Saudi-Arabien nicht akzeptieren wollte. Für das saudische Königreich waren die Sicherheitsbedürfnisse der kleineren Monarchien immer nur solange wichtig, wie sie mit den eigenen Sicherheitsinteressen vereinbar waren. Der Anspruch auf Souveränität und Selbstbestimmung in Doha, Manama und Abu Dhabi war für Riad schwer zu akzeptieren, das die jungen Stadtstaaten immer nur als Vasallenstaaten wahrgenommen hatte. Saudische Äußerungen, dass ein Angriff auf eine der Herrscherfamilien am Golf einem Angriff auf die eigene Herrscherfamilie gleichkäme,12 waren oft bloß Rechtfertigungen für saudische Einmischungen in »innere Angelegenheiten« in Bahrain 1994 und 2011 oder in Katar 1996.
Es waren auch die Saudis, die in den 1970er Jahren die Initiative ergriffen, um eine kollektive Sicherheitsstruktur am Golf aufzubauen, damals noch einschließlich des vorrevolutionären Iran und Saddams Irak. Die iranische Revolution 1979 sollte dem Prozess der Sicherheitsintegration am Golf neue Dynamik verleihen.