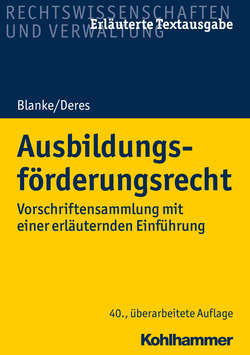Читать книгу Ausbildungsförderungsrecht - Roland Deres - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.9Novellierungen 1996, 1998 und 1999
ОглавлениеIn der 13. Legislaturperiode (1994–1998) war die Ausbildungsförderung ein ständiges politisches Thema. Nachdem am Ende der 12. Legislaturperiode die beabsichtigte Novellierung des BAföG nicht die Zustimmung des Bundesrates gefunden hatte, legte die Bundesregierung zunächst den Entwurf des 17. BAföGÄndG erneut vor. Die Verbesserungen dieses Gesetzes erreichten die Auszubildenden damit erst im Herbst 1995.
Die weitere Entwicklung war von den außerordentlichen finanziellen Schwierigkeiten bestimmt, in denen sich Bund und Länder in gleicher Weise sahen. Sie waren vor allem die Folge der notwendigen Transferleistungen in die neuen Länder, der zur Erfüllung der „Maastricht-Kriterien“ erforderlichen Beschränkung der Neuverschuldung sowie der Konjunktur- und Strukturschwäche auch der deutschen Wirtschaft. Die Bundesregierung versuchte, finanziellen Spielraum zu schaffen durch Ersetzung der zinslosen Staatsdarlehen in der Studentenförderung mittels verzinslicher privater Bankdarlehen; die so gewonnenen Mittel sollten für eine Anhebung der Förderungsleistungen um 6 v. H. sowie für Hochschulbau und -sonderprogramme eingesetzt werden. Sie stieß damit auf nachhaltigen Widerstand vor allem bei Ländern, auf deren Zustimmung im Bundesrat sie angewiesen war. Die Regierungschefs von Bund und Ländern verständigten sich am 13.6.1996 darauf, die verzinslichen Darlehen im Wesentlichen nur für die Fälle vorzusehen, in denen im Tertiärbereich Ausbildungsförderung über die Förderungshöchstdauer hinaus geleistet wird; den damit nur in geringem Umfang vermehrt zur Verfügung stehenden Mitteln entsprechend waren nur geringfügige Leistungsverbesserungen möglich. Sie wurden im 18. BAföGÄndG realisiert.
Die Regierungschefs verständigten sich zugleich darauf, „das Recht der individuellen Ausbildungsförderung und andere Bestimmungen über die Gewährung öffentlicher Leistungen, die der Studienfinanzierung dienen, einer umfassenden Prüfung zu unterziehen“. Die Untersuchungen und Verhandlungen hierüber zogen sich bis in den Herbst 1997 hin. Die Wissenschaftsseite der Länder strebte an, Kindergeld und ausbildungsbezogene steuerliche Freibeträge durch einen eltern- und einkommensunabhängigen, unmittelbar an den Auszubildenden zu zahlenden Sockelbetrag von rd. 400 DM/mtl. zu ersetzen und ihn durch eine subsidiäre Leistung zu ergänzen21, auf Länderfinanz- und -justizseite bestanden vielfache, z. T. grundsätzliche Einwendungen22. Vor allem der Bund hielt an dem – aus seiner Sicht – bewährten BAföG fest und konnte sich allenfalls zu einer Vereinheitlichung der wesentlichen Voraussetzungen für die Gewährung von Ausbildungsförderung einerseits und Kindergeld wie steuerliche Freibeträge anderseits verstehen. Der Kompromiss musste auch hier wieder von den Regierungschefs gefunden werden; er lag in einer Verbesserung der BAföG-Bedarfssätze (um 2 v. H.) und -Freibeträge (um 6 v. H.) zum Herbst 1998 durch ein 19. BAföGÄndG.
In der 14. Legislaturperiode (1998–2002) wurde die in den Jahren 1995 bis 1998 geführte Diskussion über eine neue Struktur der individuellen Ausbildungsförderung fortgesetzt. Dieser Beratungsprozess hat erfreulicherweise nicht gehindert, schon zu Beginn der neuen Legislaturperiode eine nennenswerte Verbesserung der Leistungen im traditionellen System vorzunehmen durch ein 20. BAföGÄndG; sie ist vom 1. Juli 1999 an wirksam geworden.