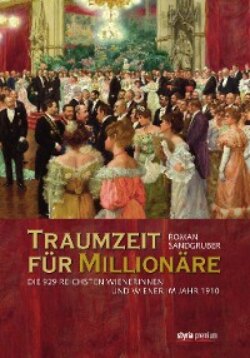Читать книгу Traumzeit für Millionäre - Roman Sandgruber - Страница 29
Der aufgehende Stern der Autoindustrie
ОглавлениеDie Königin der Maschinen des 19. Jahrhunderts war die Dampfmaschine. Doch ihr Stern war bereits im Sinken. Ein neuer Stern tauchte am Industriehimmel auf: die Fahrrad- und Automobilindustrie. Die ersten inländischen Fahrräder stammten von der Wiener Firma K. Greger, die 1884 die Erzeugung von Hochrädern und 1886 auch von Niederrädern aufgenommen hatte. Greger wurde Millionär. Um 1900 zählte man mehr als 20 Fahrraderzeuger im Land. Doch eine Weltmacht im Fahrradbau wurde Österreich nie. Die österreichische Jahresproduktion wurde 1900 mit etwa 175.000 Stück angegeben. Das waren nur etwa 3 Prozent der damaligen Welterzeugung.177 In Wien war der Kutschen- und Pferdewagenbau, der auf dem Land ein einfaches Gewerbe darstellte, zu einer auf einen überregionalen Markt orientierten Industrie geworden. Jacob Lohner & Comp. war die größte Fuhrwerksfabrik Wiens und das Aushängeschild des österreichischen Kutschenbaus. Es wundert nicht, dass Jakob Lohners Sohn Ludwig die Chancen des Automobilbaus ganz frühzeitig erkannten. Nach einem Technikstudium übernahm er 1887 die Unternehmensleitung und begann nach dem Tod des Vaters mit der Umgestaltung der damals größten Pferdewagenfabrik Österreich-Ungarns auf Automobile und später Flugzeuge. Er setzte auf Elektroautos, denen er wie viele damalige Experten eine wesentlich größere Zukunftschance einräumte als den Verbrennungsmotoren. Elektromobile vermieden zweifellos manche Anfangsschwächen der Benzinkutschen: das Starterproblem, die Lärm- und Geruchsbelästigung und die große Störungsanfälligkeit der Motoren. Sie waren Mobile für kurze Distanzen und gemütliche Fortbewegung. Daher wurden sie auch als „Frauenautos“ beworben.
Der junge Ferdinand Porsche, dem der Maffersdorfer Industrielle Wilhelm Ginzkey 1893 eine Stelle beim Wiener Elektropionier Béla Egger vermittelt hatte, begann für Lohner Elektrofahrzeuge mit Radnabenmotoren zu bauen. 1900 wurde der Lohner-Porsche mit Elektroantrieb auf der Weltausstellung in Paris vorgestellt. Als Lohner-Porsche „Mixte“ und ab 1906 als „Mercedes Electrique“ brachte Ferdinand Porsche sein Konzept des Hybridantriebs zur Serienreife. Der Geschäftserfolg der Elektromobile blieb aber aus. In den Jahren 1900 bis 1904 verkaufte Lohner nur 33 Elektromobile. Damit erreichten sie etwa 15 Prozent des Lohnerschen Jahresumsatzes. Der durchschnittliche Jahresumsatz bei Lohner in den Jahren 1900 bis 1904 betrug 547.000 Kronen. 1906 entschied sich Lohner für den Rückzug aus der Automobilproduktion und verkaufte seine Patente an Emil Jellinek und die Oesterreichische Daimler-Motoren-Gesellschaft in Wiener Neustadt. Ferdinand Porsche wurde deren Direktor und setzte nunmehr auf schnelle Rennautos und Militärfahrzeuge. Lohner selbst widmete sich nur mehr dem Karosseriebau und den elektrischen Oberleitungsbussen. 1909 stieg er mit einem Doppeldecker, der mit einem 40-PS-Anzani-Motor ausgestattet war, in den Flugzeugbau ein. Die k. u. k. Heeresleitung bestellte bei ihm 36 Flugzeuge des Typs Etrich Taube. Dann folgte der Lohner Pfeilflieger, der sowohl als Land- als auch als Wasserflugzeug eingesetzt werden konnte. Zu Beginn des Ersten Weltkrieges wurde das Werk in Floridsdorf wesentlich erweitert. Im Jahr 1916 wurde das 500. Lohner-Flugzeug gefertigt. Bis zum Ende Krieges kamen noch 185 weitere dazu.178 Bis 1910 konnte Lohner den Umsatz von etwa 500.000 auf 800.000 Kronen heben, ein Niveau, das die Firma schon Mitte der 1890er Jahre am Höhepunkt des Kutschenbaus erzielt hatte. Mit Einsetzen des Flugzeugbaus verdoppelte sich Lohners Umsatz bis 1913 auf etwa 2 Mio. Kronen.