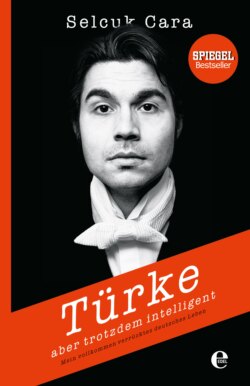Читать книгу Türke - Aber trotzdem intelligent - Selcuk Cara - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
MEINE MUTTER UND DIE BÄRTIGEN MOSLEMS
ОглавлениеIch wuchs als Einzelkind bei meiner Mutter auf.
Mein Vater, der nie eine Schule besucht hatte, verließ uns, als die Textilfabrik, die er gemeinsam mit meiner Mutter aufgebaut hatte, endlich Gewinne abzuwerfen begann. Für sie, die türkische Akademikerin, brach eine Welt zusammen.
Sie war der Spross einer sehr angesehenen türkischen Familie aus Gaziantep, einer hier in Deutschland nahezu unbekannten Großstadt nahe der syrischen Grenze, tief im Südosten der Türkei. Mitglieder ihrer Familie hatten dieser Millionenstadt eines der ersten Museen gestiftet; ein Vorfahr meiner Großmutter aus dem näheren Umfeld Atatürks war einer der Hauptverfasser des ersten offiziellen Schulbuches in lateinischer – statt in arabischer – Schrift. Büsten ihrer Urahnen stehen an verschiedenen Orten der Stadt.
Ihre Eltern hatten sie einst vor dieser Verbindung gewarnt, dann den Kontakt verboten, schließlich resigniert und ihr alles Glück der Welt in der Fremde gewünscht.
Ihre Mutter, meine Großmutter, sollte ihr das ein Leben lang nicht verzeihen, wurde ihre Tochter doch die Frau eines dieser wertlosen, stumpfen „Dörfler“, eines anatolischen „Bergmenschen“. Meine Großmutter würde ihren ganz eigenen Beitrag zur ersehnten Scheidung ihrer Tochter leisten. Sie würde nach Deutschland kommen, einige Jahre bei uns wohnen, um meinem Vater jeden Tag seine niedere Herkunft vorzuwerfen.
Meine Mutter folgte ihrer Liebe und sicher auch ihrer unbändigen Neugier. Sie freute sich auf den Einzug ins gelobte Land – mit einer Lebensfreude, die sie damals noch besaß.
Mein Vater, der als junger Soldat von der Familie eines hochdekorierten Generals aufgenommen worden war und nach sich ankündigenden politischen Unruhen mit selbiger die Türkei verließ, war auf diese Weise bereits Ende der 1950er-Jahre erst nach Brescia in Norditalien, dann nach Paris gekommen.
Ab 1962 arbeitete er im Dienst der Air Force auf der Air Base am Frankfurter Flughafen. Er war dort wahrscheinlich der einzige Türke, und bis heute weiß ich nicht, was seine Aufgabe war: Spion, Kofferträger, Dolmetscher, all dies hörte ich im Laufe der Jahre. Zumindest war er ein Patriot oder mehr und überwies dem türkischen Militär – soweit es ihm möglich war – immer wieder Geld. Mich wollte er nach der Grundschule auf ein Militärinternat in der Türkei schicken, damit ich der ehrlichste Mensch auf der Welt werde – ein türkischer Soldat.
So hatte die Scheidung meiner Eltern wenigstens etwas Gutes, denn die Zukunft eines Mehmetçik – eines ehrenhaften anatolischen Soldaten, der stets bereit ist, für sein Vaterland bis zum letzten Tropfen seines Blutes zu kämpfen –, diese trübe und lebensfeindliche Zukunft blieb mir dadurch glücklicherweise erspart.
Als mein Vater uns verließ – ich war elf Jahre alt –, glaubte meine Mutter, dass er bald wiederkommen würde; als er jedoch wegblieb, brach sie jeden Abend verzweifelt in Tränen vor mir zusammen.
Ich konnte nicht mit ihr weinen, damals begriff ich ihren Schmerz nicht. Das kam erst viel später, als ich in der Lage war, mich meinem eigenen Schmerz zu stellen. Dann aber verlor ich mich ganz in ihm, indem ich wieder und wieder die Aria aus den Goldberg-Variationen spielte. Mit jeder Wiederholung dieser zeitlosen Musik stieg ich tiefer und tiefer in die traumatischen Abgründe meiner vaterlosen Kindheit. Ich wiederholte die Aria so oft, bis ich nichts, keinen Schmerz, mehr fühlte und ich mich von außen zu betrachten begann. Jede meiner Bewegungen schien zeitversetzt, jeder Atemzug intensiv, fremd.
Als meine Frau schwanger war, spielte ich die Aria erneut so oft es ging; ich wollte diese Musik nicht mehr mit der Trauer über den Verlust meines Vaters assoziieren, sondern mit der unermesslichen Freude über die anstehende Geburt meiner geliebten Tochter. Die Aria von Bach sollte den werdenden Vater und seine Wunschtochter für alle Zeiten verbinden.
Erst mit dem Tag der Geburt meiner Tochter endete das Weinen meiner Mutter. Hin und wieder erlag sie auch dann noch alten Erinnerungen und eine tiefe Traurigkeit überkam sie – nur der Anblick ihrer Enkelin tröstete sie über ihr Leid, über ihre verschenkte Jugend und den unverzeihlichen Verrat, den der Mann, den sie noch immer liebte, an ihr begangen hatte.
Sie hatte ihrem Ehemann ihre besten Jahre geschenkt, er hatte sie undankbar angenommen, um doch am Ende seine Ehefrau schmählich zu verraten. Nie hätte meine Mutter einen solchen Verrat von ihrem Mann erwartet, von ihrem zudem patriotischen, türkischen Mann. Dieser Verrat an der türkischen Familie, der türkischen Tradition und Sitte, aber auch an der türkischen Fahne selbst sollte ihr zukünftiges Leben prägen.
Fünfzehn Jahre später heiratete sie aus einer trostlosen Einsamkeit heraus noch einmal einen türkischsprachigen Mann. Enttäuscht ließ sie sich nach wenigen Jahren aber auch von diesem wieder scheiden.
Meine Mutter, die mich, nachdem sie von meinem Vater verlassen worden war, bewusst türkisch-laizistisch, ganz im Sinne Atatürks, erzog, griff immer wieder auf den unerschöpflichen Fundus türkischer Sprichwörter zurück, den sogenannten Atasözleri, was wörtlich übersetzt „die Worte der Ahnen“ bedeutet. Ich wunderte mich, als sie eines Tages ein Atasöz zitierte, das gar nicht zu all den alten türkischen Sprüchen passen wollte:
„Wenn du einen Freund brauchst, dann finde einen Hund.“
Und tatsächlich bekam ich als Grundschüler von meiner Mutter einen Hund.
Ben war mein Ein und Alles, mein einziger Freund. Ich war den ganzen Tag mit ihm zusammen, weil meine Mutter nachmittags an verschiedenen Grundschulen der Umgebung muttersprachlichen Unterricht für die türkischen „Gastarbeiter“-Kinder gab.
In meiner Geburtsstadt war ich der erste Türke, der einen Hund besaß; später gab es auch andere Türken, die sich einen Hund zulegten, trotzdem blieb ich der einzige Türke, dessen Hund mit in der Wohnung leben durfte. Die Hunde der anderen fristeten, angekettet in Hinterhöfen und auf Fabrikgeländen, ein unwürdiges Leben.
Meine Mutter, die nicht mehr an die türkisch-patriarchalischen Familienstrukturen glaubte, ließ mir alle Freiheiten, die wider die Vorstellungen der türkischen Gesellschaft waren. Sie kümmerte sich nicht mehr um die Meinung der türkischen Gesellschaft, zu der sie nur noch über die Eltern ihrer Schüler den nötigsten Kontakt hielt.
Einmal wurde ich bei einem Hundespaziergang von einigen älteren türkischen Herren angesprochen, die gerade auf ihrem Balkon im Hochparterre Wasserpfeife rauchten und Kebab grillten. Freundlich baten Sie mich, näherzutreten, sie lobten meinen wohlerzogenen Respekt älteren Menschen gegenüber, mein Aussehen, meine Intelligenz, eigentlich alles, was eine türkische Mutter, aber nicht ihr Kind hören möchte.
Der älteste der Herren ergriff schließlich das Wort und versuchte mir klarzumachen, dass Hunde unrein wären und in der Wohnung eines echten Türken und somit gläubigen Muslims nichts zu suchen hätten; dass ich mir Gedanken darüber machen möge, wie und wo ich meinen unreinen Hund wieder loswerden könne. Er nannte mir ein Tierheim in der Umgebung und fügte schließlich mit höhnischem Gelächter hinzu, dass die Deutschen ihre Hunde lieber hätten als Menschen und mein Hund ganz bestimmt schnell ein passenderes Zuhause bei einem deutschen Besitzer finden würde.
Unterdessen war meine Mutter hinzugetreten und hatte den fundamentalistischen Ratschlägen der Männer unbemerkt gelauscht. Nun schritt sie ein und hielt den bärtigen Herren eine Standpauke über Männer im Allgemeinen und türkische Männer im Besonderen, über die türkische Familie in Deutschland und die falsche Auslegung, nämlich die männliche Auslegung des Korans.
Mich beeindruckte der Auftritt meiner zornigen Mutter sehr, ich war richtig stolz auf sie. Mein Hund sprang sie freudig wedelnd an. Auch ich fühlte mich ermutigt, etwas zu sagen, und schrie den Männern entgegen, dass die Zähne meines Hundes viel weißer seien als die ihrigen, da ich sie ihm täglich putze.
Die Männer murmelten auf Arabisch etwas von Bart zu Bart und wagten nichts mehr zu sagen. Sie waren schockiert von Mutter und Sohn.
Dieser heroische Auftritt meiner Mutter prägte sich mir für immer ein. Ich würde fortan meinen Mund aufmachen, wann immer es notwendig war, an die weiteren Konsequenzen dachte ich in der Regel nie.
Mein Hund Ben wurde sehr, sehr alt; er begleitete mich treu durch meine gesamte Kindheit und Jugend. Er spürte wohl, dass ich ihn brauchte. Er war tatsächlich mein einziger Freund.