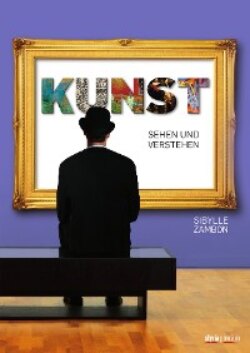Читать книгу Kunst sehen und verstehen - Sibylle Zambon - Страница 14
2|2 „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“ (Kurt Tucholsky)
ОглавлениеIn diesem Abschnitt soll Kurt Tucholsky beim Wort genommen werden. Sagt ein Bild tatsächlich mehr als tausend Worte? Sie haben bereits erfahren, dass Kunst so alt ist wie die Menschheit. Man malte oder zeichnete an die Wände von Höhlen, schnitzte in Holz oder Knochen oder errichtete Monumente für rituelle Zwecke, wie etwa die berühmte Anlage von Stonehenge in England. Auch wenn sich die Forschung über die genaue Bestimmung der Anlage nicht einig ist, so war sie doch unbestritten ein Monument von überragender Bedeutung. Das belegt die Tatsache, dass Stonehenge über mehrere Jahrtausende benutzt und erweitert wurde, von der Jungsteinzeit bis in die Bronzezeit.
Noch bevor sich die Menschheit einer Schrift bedienen konnte, kommunizierte sie also durch Bilder. Bei jedem einzelnen Menschen ist das nicht anders: Bevor ein Kind lesen und schreiben lernt, zeichnet es. Dabei sind in der frühkindlichen Zeichnung durchaus kulturübergreifende Aspekte ersichtlich, bevor sich kulturell bestimmte Entwicklungsschritte bemerkbar machen: angefangen beim Kritzeln, zum Zeichnen von Inhalten, bis hin zu planmäßig angelegten Bildern aus seiner Umwelt. In gewissem Sinne scheinen Bilder als einfachste Ausdrucksform des Menschen einer grundlegenden Verständigung zu dienen.
Abb. 8: Stonehenge bei Salisbury in Südengland: Ein Grabmal oder Denkmal oder doch eher eine Art Kalender, wie es bestimmte, zur Sonnenwende und Tagundnachtgleiche markierte Steine nahelegen?
Sie sind gefragt: Machen Sie die Probe aufs Exempel.
Was sehen Sie auf Abb. 9 rechts?
Abb. 9: Yan Li-pen, Cao Pi, Kaiser von Wei (eines von 13 Kaiserporträts des chinesischen Künstlers) 7. Jh. n. Chr., 51,3 x 53,1 cm Tinte und Farbe auf Seide Boston Museum of Fine Arts
Antwort: Auf den ersten Blick unterscheidet man drei Männer in Dreiviertelansicht. Der mittlere ist in einem größeren Maßstab dargestellt als die beiden anderen. Auch trägt er ein prächtiges Gewand mit reichem Faltenwurf und schönen Verzierungen. Der Größe und Kleidung nach muss er sehr bedeutend sein. In der rechten oberen Ecke erkennt man Schriftzeichen.
Hätten sie einen chinesischen Text vor sich, der einen wichtigen Mann und seine zwei Begleiter beschreibt, so würden die meisten Europäer im besten Fall die Schriftzeichen als chinesische identifizieren. In der bildnerischen Umsetzung dagegen erkennt man auf Anhieb Anzahl, Geschlecht und den gesellschaftlichen Rang der Dargestellten. Kunst vermag also etwas, das Geschriebenes nicht kann: über Sprachgrenzen hinweg Inhalte zu vermitteln.
Gerade im Mittelalter, einer Zeit also, in der die meisten Menschen weder lesen noch schreiben konnten, baute die Kirche auf die Wirksamkeit der bildlichen Darstellung. So entstanden viele Kunstwerke im Auftrag der Kirche, um den Gläubigen die biblischen Botschaften vor Augen zu führen beziehungsweise in Erinnerung zu rufen. Kreuzigungsszenen beispielsweise sollten ihnen die Leiden Christi vergegenwärtigen, während Darstellungen des Jüngsten Gerichts auf die Vergänglichkeit und die Wichtigkeit eines sündenfreien Lebens hinwiesen. Beide Motive waren beliebte Themen für die plastische Ausgestaltung von Kirchenportalen. Diese Eingangsbereiche waren – und sind bis heute – zentral gelegene, von Passanten gut frequentierte, weithin sichtbare Orte. Heute würde man sagen: prominente Werbeträger. Auf den Kirchplätzen fanden zudem an gewissen Feiertagen Kirchmessen, also Märkte, statt, zu denen die Menschen von Stadt und Land herbeiströmten. Dies war der ideale Standort, um eine zentrale Botschaft der Kirche, wie jene des Jüngsten Gerichts, zu verkünden. Das Publikum wurde dadurch ermahnt, erinnert oder gar belehrt und reagierte im Idealfall mit Andacht, Ehrfurcht oder Erkenntnis.
Das Zitat zum Thema: Die Malerei sei ein offenes Buch, in dem sowohl Gelehrte als auch Ungebildete die Ereignisse der Heils- und Menschheitsgeschichte zu lesen vermöchten. „Von daher gebührt ihr der einzigartige Ruhm, universelle Sprache zu sein, (…) denn ihre Sprache wird nicht nur von den Angehörigen einer Nation verstanden, sondern von denen aller Nationen, weil ihre Schreibart italienisch, französisch, spanisch, deutsch, türkisch, griechisch, chinesisch, chaldäisch ist und auch alle anderen Sprachen des Universums mit einschließt: ein unvergleichlicher Vorzug dieser Kunst, der nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Bei einer derartigen Vielfalt also von Menschen, Nationen und Sprachen drückt sie sich mit nur einer einzigen Sprache aus!“15
Für den modernen Betrachter eines mittelalterlichen Kunstwerks mag nicht mehr unbedingt das religiöse Moment im Vordergrund stehen. Er kann sich aber auch heute noch an seiner Schönheit oder Aussagekraft erfreuen und, wenn er sich etwas Zeit nimmt, Erstaunliches entdecken. Nehmen wir beispielsweise das Westportal des Berner Münsters, so erkennen wir ohne große Vorkenntnisse: Das Bild zeigt eine Ansammlung von Menschen. Auf der linken Bildhälfte erscheinen sie wohlgeordnet, in farbigen oder weißen Kleidern. Ihre Gesichter sind nach oben gerichtet, einige haben die Hände gefaltet. Sie scheinen zu singen und zu beten. Die ganze linke Bildhälfte ist zudem reich vergoldet. Auf der rechten Seite überwiegen dagegen dunkle Farbtöne. Hier herrscht das Chaos: Die Menschen sind nackt oder nur spärlich bekleidet. Einige sind in wilden Verrenkungen dargestellt, von anderen sind nur einzelne Körperteile erkennbar. Die Gesichter dieser Gruppe grinsen oder haben einen gleichgültigen Ausdruck. Während auf der linken Bildseite ein goldenes Tor zu erkennen ist, dominiert auf der rechten ein Feuerschlund, aus dem einige leblose Menschengesichter und Monsterfratzen starren. Auf beiden Bildhälften befinden sich gekrönte Häupter, Angehörige der Geistlichkeit und sogar Kinder. Kein Zweifel: hier wird das Böse vom Guten getrennt. Der dominant vor die Szene gestellte Engel mit Schwert und Waage in der
Bildmitte unternimmt gleichsam die Teilung in Himmel und Hölle, quer durch alle Volksschichten. Eine wahrhaft schaurige Szene, die freilich in einer Zeit, die nicht so von Bildern überflutet war wie die unsrige, noch viel gewaltiger wirken musste.
Abb. 10: Erhart Küng, Jüngstes Gericht letztes Drittel 15. Jh. Tympanon des Hauptportales des Berner Münsters, Bern, Schweiz
Allein durch das Betrachten lässt sich also schon einiges aus dem Bild herauslesen. Selbst wenn wir die Hauptfiguren nicht identifizieren können, sich uns der Symbolgehalt nicht völlig erschließt, wir die biblische Quelle nicht genau kennen, so verstehen wir die Hauptbotschaft: die Trennung von Gut und Böse.
Nachdem wir nun je ein Bild aus einer uns nicht mehr vertrauten Zeit und eines aus einer uns fremden Kultur betrachtet haben, stellen wir fest: Wir haben von der bildlichen Botschaft mehr verstanden, als wenn wir sie als mittelhochdeutschen bzw. chinesischen Text vorgesetzt bekommen hätten.