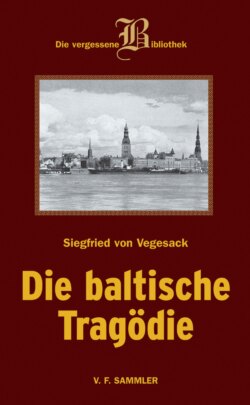Читать книгу Die baltische Tragödie - Siegfried von Vegesack - Страница 11
Das rote Bänkchen
ОглавлениеFömarie heißt eigentlich Fräulein Marie, aber das ist zu lang, Aurel kann das Wort „Fräulein“ nicht aussprechen. Fömarie hat eine turmhohe Frisur mit Knotenzopf und unzähligen Spangen, runde, wasserhelle, immer erschrockene Augen und furchtbar viel Röcke, die man alle sehen kann, wenn sie in der Allee spazierengeht. Denn dann rafft sie die Röcke mit einem „Pagen“, einem schwarzen Gummiband, hoch, weil draußen doch Pfützen sein könnten:
„Aurel, paß auf, da kommt eine Pfütze!“
Und Fömarie macht mit hochgerafften Röcken einen gewaltigen Sprung.
Ebenso fürchtete sie sich vor Fröschen, Kröten, Donner, Mäusen und Zugwind.
„Mein Gott, es hat geraschelt“, sagt sie mitten in der Nacht und macht Licht. Oder: „Es donnert!“ – und hält sich beide Ohren zu. Oder: „Es zieht!“ – und schließt alle Fenster. Wenn Fömarie ausgeht, steckt sie sich und Aurel immer Wattepfropfen ins Ohr. Und dann wandern sie in der Allee: immer bis zum Krug und wieder zurück. Manchmal auch die „kleine Runde“: auf der Landstraße ein Stück und dann auf den Wirtschaftsweg heimwärts. Alles richtet sich nach dem Wind, und wenn man trotz aller Berechnungen den Wind ins Gesicht bekommt, darf man nicht sprechen und muß die Hand vor den Mund halten.
Aber Aurel kann die Wattepfropfen nicht leiden: er zieht sie heimlich aus den Ohren heraus.
„Mein Gott, wo sind deine Wattepfropfen?“
„Herausgefallen.“
„Wo herausgefallen?“
„Das weiß ich nicht. Vielleicht auch hereingerutscht.“
„Mein Gott, hereingerutscht! Wie ist das denn möglich? Laß mal sehen!“
Aurel hält das Ohr hin und macht ein sehr nachdenkliches Gesicht:
„Vielleicht ganz tief hereingerutscht!“
„Mein Gott, ganz tief! Ich sage dir doch immer, du sollst dich gradehalten. Bei mir sind sie noch nie hereingerutscht oder herausgefallen. Schnell nach Hause. Bei dem Wind ohne Watte. Du kannst dir den Tod holen!“
Zu Hause muß Aurel auf alle Fälle immer gurgeln: wenn er hustet, wenn er niest, wenn er mit nassen Füßen nach Hause kommt.
Außerdem hat Fömarie noch eine Leidenschaft: die Köpfe der Kinder zu waschen. Auch die großen Brüder müssen dran glauben. Jeden Samstag schleppt die schwarze Tina unzählige Eimer heißes Wasser in die Backstube, Karlomchen bringt grüne Seife, die sich wie kalter quabbliger Froschlaich anfühlt, Fömarie bindet sich eine Küchenschürze vor und krempelt die Ärmel hoch. Nachher müssen die Kinder vor dem großen Backofen sitzen, und Tina, Karlin, die alte Minna und Fömarie bearbeiten abwechselnd die Haare mit Tüchern und Händen. Dann bringt Karlomchen zur Belohnung heiße Himbeerlimonade, aber die großen Brüder sind so beleidigt, daß sie nichts trinken. Sie hocken finster da, Bal, Rei und Tof (auch die Namen Balthasar, Reinhard und Christof sind für Aurel zu lang) und brüten Rachepläne aus. Einmal haben sie Fömarie einen Frosch ins Bett gelegt. Ein anderes Mal Brausepulver in den Nachttopf geschüttet. Beide Male erschrak Fömarie zu Tode:
„Mein Gott, ein Frosch! Mein Gott, wie das kocht! Habe ich Fieber?“
Aurel, der jetzt oben bei Fömarie schlief, mußte sich den Zipfel des Kissens in den Mund stecken und die Decke über das Gesicht ziehen, um nicht herauszuplatzen. Die großen Brüder imponierten ihm sehr. Auch wenn sie bei Acka einen ganzen Sonntagvormittag nachsitzen mußten.
Acka war Herr Ackermann, der stille, kränkliche, immer freundliche Hauslehrer, der fast den ganzen Tag in einem dicken Schlafrock in seinem Zimmer saß, das „Afrika“ hieß, weil der Kamin von der Küche dort durchging. Nur zu den Stunden wanderte er ins Schulzimmer hinüber, wo die Brüder an schrägen Pulten unterrichtet wurden.
In den Pausen tobten sie im „Großen Korridor“, der eigentlich ein gewaltiger Saal mit tiefen Fensternischen war. Hier hing an zwei Stricken eine Stange, auf der man so hoch schaukeln konnte, daß die Fußspitzen die Dekke berührten; aber nur Bal und Rei kamen so hoch, Tofs und Aurels Beine waren noch zu kurz. Dann standen da zwei Barren, eine große Mehlkiste mit abschüssigem Deckel, auf dem man herrlich hinunterrutschen konnte, die Pelztruhe, die immer nach Mottenpulver roch, ein altes Sofa mit schwarzrot gemustertem, zerschlissenem Polster. Schränke, Kommoden, drei kleine Kinderschlitten auf eisernen Kufen mit bunten, zerkratzten Bildern auf dem schrägen Schutzblech; auch im Sommer konnte man mit diesen Schlitten auf dem Bretterboden herumrutschen, wenn man mit den Hacken nachhalf.
Und dann gab es zwischen den tiefen Fensternischen schmale, schräg abgedachte Rumpelkammern, die von zerbrochenen Möbeln, Geschirr, Kisten und rätselhaftem Gerümpel angefüllt waren. Diese Dachkammern hießen „Tschulanchen“, und wenn man hineinkroch, erstickte man fast in der dikken, staubigen, glühend heißen Luft. Aber man konnte sich hier gut verstekken, wenn Fömarie rief und Aurel und Adda lieber mit Puppen spielen wollten als mit wattierten Ohren über die Pfützen springen.
Außer der staubigen Rumpelkammer gab es für Aurel noch einen Zufluchtsort; das war „Afrika“, das war „Acka“. Afrika und Herr Ackermann waren für ihn ein Begriff, und dieser Begriff war mit Wärme, Petroleumlampe und Schlafrock verbunden. Bei Acka durfte Aurel Bilderbücher besehen, bei Acka durfte er selbst Bilder kritzeln. Er saß Herrn Ackermann gegenüber, und die weiße Alabasterlampe stand zwischen ihnen. Fast so weiß wie die Lampe sah Ackas Gesicht aus, dieses immer freundlich lächelnde und doch traurige, nach innen gekehrte Gesicht mit der leisen Stimme.
Aurel zeichnete Häuser, Bäume, Kühe und darüber immer eine runde Sonne mit langen, geraden Strahlen. Und dann schenkte er Acka das Bild, der sich besonders über die Sonne freute.
„Die Sonne muß immer drauf sein“, erklärte der Junge, „sonst erfrieren die Bäume und Kühe!“
„Und auch die Menschen!“ meinte Herr Ackermann fröstelnd.
Aurel schüttelte den blonden Kopf:
„Die haben doch Öfen! Oder einen Schlafrock! Oder auch einen Pelz! Die Bäume und Tiere haben nichts!“
„Aber die Sonne ist wärmer!“ seufzte Herr Ackermann mit traurigem Lächeln.
„Dann schenke ich dir eine Sonne!“ erklärte Aurel großzügig und malte einen Riesenkreis mit gewaltigen Strahlen, den Herr Ackermann über seinem Bett aufhing.
„Jetzt werde ich nicht mehr frieren“, meinte er dankbar und strich behutsam über den Blondkopf.
Dann holte Fömarie den Jungen. Er sollte heute baden. Und nach dem Bad brachte sie ihm das Abendessen ans Bett: Rührei mit Spinat und geschälte Kartoffeln.
Aber die Kartoffeln sahen so merkwürdig aus: nicht glatt geschält, sondern wie abgekratzt, und als Fömarie die Gabel reichte, bemerkte Aurel, daß an ihren Fingernägeln kleine Schalenstücke hingen. Er rührte keine Kartoffel an.
„Dann darfst du auch nicht das Rührei essen!“
Er schob den Teller von sich:
„Abgekratzte Kartoffeln esse ich nicht!“
„Die sind nicht abgekratzt!“
„Zeig deine Finger!“
„Du bist albern!“
Fömarie hielt die Hände auf dem Rücken.
Aurel wiederholte beharrlich:
„Zeig deine Finger!“
Fömarie wurde dunkelrot:
„Du bekommst nichts, wenn du nicht die Kartoffeln ißt!“
Aurel drehte den Kopf zur Wand:
„Dann werde ich nichts essen!“
Am nächsten Tag lagen dieselben Kartoffeln wieder auf seinem Teller. Sie waren aufgewärmt, ein wenig gebräunt, aber er erkannte sie doch sofort und rührte sie nicht an. Aurel und Adda aßen im Speisezimmer in der Ecke an einem niedrigen Kindertisch, auf zwei niedrigen Holzbänkchen. Fömarie beaufsichtigte die Mahlzeiten und trieb immer zur Eile, weil die Kinder fertig sein mußten, wenn die Großen zu Tisch gingen. Und Aurel trödelte immer so. Er kaute ewig. Die Bissen gingen nicht herunter. Und die Kartoffeln schob er jetzt einfach auf den Tellerrand.
Fömarie riß ihm die Gabel aus der Hand, spießte ein Kartoffelstück auf und wollte es ihm in den Mund schieben. Aber der Junge preßte die Lippen zusammen, hielt beide Hände vor und zog den Kopf weit zurück.
Dann versuchte sie ihn zu locken:
„Wenn du dieses Stück ißt, nur dieses Stück, gebe ich dir einen Bonbon!“
Aurel schüttelte stumm den Kopf.
Jetzt packte Fömarie den Jungen, bog sein Gesicht zurück und wollte ihm gewaltsam das Kartoffelstück in den Mund stopfen. Aber Aurel biß die Zähne zusammen, und die Kartoffel fiel auf den Fußboden.
In diesem Augenblick kam die Mutter. Nachdem sie alles angehört hatte, nahm sie den Jungen an der Hand und führte ihn in ihr Schlafzimmer. Hier stand hinter einem Schirm am Ofen das Sünderbänkchen – ein roter Fußschemel, und hier mußte sich Aurel hinsetzen und „nachdenken“, bis der „Bock“ wieder fort war. Das kam nicht oft, aber doch auch nicht zu selten vor, so daß er sich weder an das rote Bänkchen gewöhnte, noch es vergaß. Die Mutter strafte nur ungern, nur wenn es sein mußte. Aber dann blieb sie fest: Aurel sollte Fömarie um Verzeihung bitten.
Stumm und eigensinnig schüttelte er den Kopf.
„Dann mußt du nachdenken, bis du es tust!“
Aurel setzte sich auf das Bänkchen. Die Mutter schob den Schirm vor, dann ging sie. Die Tür schloß sich hinter ihr.
Nun saß er hier ganz allein im Halbdunkel, starrte auf den Kachelofen, den Fußboden, auf das Schutzblech vor der Ofentür. Die weißen Kacheln waren glatt und kühl, und wenn man die Finger mit Spucke naß machte, konnte man schöne Striche ziehen. Auch die dunklen Ritzen zwischen den weißen Brettern des Fußbodens mußte man genau untersuchen: wie sonderbar mulmig sich der Staub anfühlte, wenn man ihn mit dem Nagel herauskratzte. Das war keine so einfache Arbeit, Aurel kutschierte auf seinem Bänkchen bis in die Ecke, um das Werk zu vollenden. Hier entdeckte er aber im hintersten Winkel zwischen Ofen und Wand ein graues Spinngewebe, in dem eine tote Fliege hing. Spinnen interessierten ihn immer ganz besonders, und als sich jetzt eine Fliege auf den Kachelofen setzte, versuchte er sie zu fangen. Er stand auf, aber nun sah er im Wasserkrug, der unter dem Waschtisch stand, eine Fliege hilflos mit den Beinen zappeln. Vorsichtig fischte er sie heraus und warf sie mit kaltem Entsetzen und zugleich grausamer Freude ins Spinngewebe.
In diesem Augenblick hörte er, wie sich die Tür öffnete. Schnell hockte er sich wieder auf das Bänkchen. Hastige schlurfende Schritte näherten sich, ein Schlüsselbund klapperte, Karlomchen beugte sich zu ihm, sah ihn über die schiefen Brillengläser bekümmert an und fragte, ob der „Bock“ jetzt fort sei?
Aber Aurel schüttelte den Kopf. Nie wollte er Fömarie um Verzeihung bitten, nie. Außerdem mußte er sehen, was aus der Fliege geworden war. Karlomchens Schlüsselbund klapperte, die Tür schloß sich. Aurel beugte sich vor und spähte neugierig in den Winkel. Sein Herz hämmerte bis in die Kehle hinauf, die Hände wurden kalt und feucht: da hing die zuckende Fliege, und ein Ungeheuer mit schwarzem Kugelleib und spitzen, langen Beinen hielt sie saugend umklammert. Aber er mußte hinsehen, entsetzt hinstarren, bis die Zuckungen immer schwächer wurden und zuletzt ganz aufhörten. Jetzt war die Fliege tot, eine leere Hülle. Die Spinne kroch gesättigt in ihr Versteck.
Als die Mutter kam, hockte Aurel schluchzend auf seinem Bänkchen. Aber auf die Frage, ob er jetzt Fömarie um Verzeihung bitten wolle, schüttelte er stumm den Kopf.
„Dann mußt du noch ein wenig nachdenken“, seufzte die Mutter und ging.
Und Aurel dachte nach: Warum hab’ ich die Fliege ins Spinngewebe geworfen, warum ist Mila fort und Wannag, der Pferdeknecht, auch? Ich möchte zu Mila, ich will auch fort, weit fort von Fömarie und den abgekratzten Kartoffeln. Am liebsten will ich tot sein wie die Fliege, ganz tot, und dann werden alle weinen …
Aurel schluchzt und schluchzt über sich selbst, über die Mutter, über alle Menschen, die dann so traurig sein werden, so schrecklich traurig. Aber ich bin dann tot, wiederholt er immer wieder, ganz tot, und dann wird man mich begraben, neben dem toten Schwesterchen, neben dem weißen Kreuz …
Der wilde Trotz geht in sanftes, süßes Selbstmitleid über. Die Tränen sind versiegt, und in den Waden kribbeln Ameisen. Vielleicht fängt es so an, wenn man verhungert, denkt er gespannt und streckt abwechselnd die Beine aus, und abwechselnd kribbeln die Ameisen in der rechten und in der linken Wade.
Als die Mutter wiederkommt, schüttelt er den Kopf.
„Dann mußt du zu Papa“, sagt die Mutter feierlich, nimmt ihn an der Hand und führt ihn durch den Saal in das Lesezimmer.
Hier ist es dämmrig und kühl; die gelben Fensterrouleaus sind heruntergelassen; durch die angelehnte Tür vom Schreibzimmer des Vaters fällt ein dünner Sonnenstreifen, in dem Staubkörner wirbeln. Die Mutter ist hineingegangen, er hört ihr Flüstern, einen Stuhl rücken, das knurrige Brummen des Vaters. Dann kommt sie wieder heraus – er soll hierbleiben. Die Saaltür schließt sich hinter ihr.
Ganz selten ist Aurel in dieses Heiligtum vorgedrungen, hinter dem das Allerheiligste, Vaters Schreibzimmer, liegt. Aber schon hier ist es feierlich und unheimlich genug: da steht ein Glasschrank mit lauter Büchern, da hängen an den Wänden auf schwarzen Brettern weiße Totenköpfe mit spitzen Geweihen – Rehköpfe, viele Rehköpfe – und mitten darunter ein weißer Elchschädel mit gewaltigen Schaufeln. An der andern Wand hängt eine Bilderreihe von Männern und Frauen in sonderbaren Kleidern: in Rüstungen, Uniformen, mit weißen, komischen Frisuren, ja sogar Zöpfen. Und der unheimlichste – der General (Mila hat es ihm einmal gesagt) hat ein breites Band mit einem mächtigen Stern auf dem dicken Bauch. Und nun sind alle tot: die vielen Rehe, der Elch und der General. Warum wohl Papa so viele Tote an die Wände hängt?
Nur schräg in der Ecke, da ist etwas Lebendiges, ein geheimnisvolles Bild, das Aurel immer wieder ansehen muß: eine blaue Höhle mit blauem Wasser, und ein Mann, der in einem Boot steht, fährt in diese Höhle hinein.
„Das ist die Blaue Grotte“, hat einmal die Mutter gesagt, „und in diesem Boot bin ich selbst hineingefahren! Aber das ist schon lange her und sehr weit“, seufzte sie leise, „hier ist der Himmel nie so blau!“
Seitdem sehnt sich der Junge nach dieser blauen Höhle. Auch jetzt will er lieber dort sein als auf den Vater warten, der ihn zwingen wird, die abgekratzten Kartoffeln zu essen. Denn das fühlt Aurel: dem Vater, der fast so groß und mächtig ist wie der liebe Gott, kann er sich nicht widersetzen. Schon hört er seine knarrenden Schritte, das kleine Herz pocht, die Hände werden wieder kalt und pressen sich aneinander. Dann öffnet sich die Tür, und der Vater steht mit der langen Pfeife im Sonnenviereck, das ihn wie ein Heiligenschein umflammt.
Aurel ist so geblendet, daß er gar nicht aufblicken kann; er starrt nur auf den glühenden Pfeifenkopf, der tief bis zu den Knien des Vaters herunterhängt. Jedesmal, wenn der Pfeifenkopf aufglüht, kommt von oben eine dicke Rauchwolke, der Vater verschwindet ganz im Sonnenstaub und Pfeifendampf: er ist wieder unsichtbar. Nur seine brummende Stimme dringt durch den Rauch zu dem Jungen; er fragt, und Aurel gibt in den Rauch hinein Antwort. Er starrt dabei auf den aufglühenden und wieder verglimmenden Pfeifenkopf, und da die Worte oben aus dem Dampf immer gerade dann kommen, wenn unten das Feuer aufblitzt, ist es so, als spräche er mit der Pfeife.
„Und warum willst du die Kartoffeln nicht essen?“ fragt die Pfeife und kneift lauernd das Auge zu.
„Weil sie abgekratzt sind“, sagt Aurel und knetet die kalten Finger.
Der Pfeifenkopf funkelt ihn böse an:
„Abgekratzt?“
„Ja, Fömarie hat sie mit den Nägeln abgekratzt!“
Der Pfeifenkopf zwinkert lange stumm. Dann kommt ein dröhnendes Lachen, eine polternde Stimme aus der Höhe:
„Das ist eine Schweinerei! Abgekratzte Kartoffeln brauchst du nicht zu essen!“
Als Aurel aufblickte, war der Vater verschwunden. Die Tür zum Schreibzimmer war wieder geschlossen. Nur dicker grauer Pfeifenrauch hing noch wie eine Wolke in der Luft.
Von den Kartoffeln wurde nie mehr gesprochen. Und Fömarie kratzte nie mehr die Schalen mit den Fingernägeln ab.
Dafür gab es jetzt Beeren. Zuerst kamen die Gartenerdbeeren, aber die durfte man erst essen, wenn die Mutter ihre Vorräte eingekocht hatte. Das Beereneinkochen war etwas so Feierliches, daß nur die Mutter es selbst machen konnte. Für diesen Zweck hatte sie sich einen kleinen Ziegelsteinherd nahe am Teich unter den schattigen Bäumen bauen lassen – hier war es nicht so heiß, hier saß sie mitten im Freien, der ganze weite blaue Sommerhimmel mit den Eichen, Linden und Birken war ihre Küche.
Die großen Brüder mußten immer untersuchen, ob die Erdbeeren schon so weit wären, aber immer hieß es: nein, ganz reif sind sie noch nicht! Bis die Mutter endlich das Rätsel löste: daß gerade die reifen der Untersuchung zum Opfer fielen!
Dann begann das Beerenpflücken: die schwarze Tina, Karlin, die alte Minna und unzählige Beerenweiberchen aus dem Knechtshaus hockten mit weißen Kopftüchern zwischen den langen Beeten. Die großen Brüder, die mithelfen sollten, waren natürlich verschwunden. Sie schossen Drosseln in der Koppel, oder sie trieben sich auf dem Morast herum, wo sie Kreuzottern erlegten. Einmal brachten sie eine tote Natter nach Hause und legten sie vor Fömaries Tür. Fast wäre sie drauf getreten. Die Brüder mußten wieder im Schulzimmer nachsitzen. Aber das taten sie lieber als Beerenpflücken.
Ganze Waschkörbe voll Erdbeeren wanderten auf die Veranda. Hier wurden sie von Karlomchen sortiert, gereinigt, vom Stengelblatt befreit und in gewaltigen Schüsseln aufgetürmt. Und dann kam der Tag, an dem sich die Mutter feierlich eine weiße Schürze umlegte, Janz den Herd einheizte, und die Mädchen mit Beerenschüsseln, Einmachgläsern, Zuckerdosen, Probiertellern, großen und kleinen Löffeln aufgeregt zwischen Haus und dem Herd am Teich hin und her rannten.
„Tina, noch ein Kissen!“
Aber Tina war schon fort, und Aurel schleppte das große rotweiße Kissen von der Veranda herbei.
Die Mutter saß in einem Lehnstuhl. Sie rührte mit dem großen silbernen Löffel in der dicken roten Masse, auf der hier und dort rosa Schaumbläschen aufstiegen. Aurel stand neben ihr und beobachtete diesen Schaum. Wenn er zu heftig aufbrodelte, wurde er mit dem Löffel abgeschäumt und auf einen Teller getan. Dieser süße Beerenschaum war seine Liebhaberei.
Nach den Erdbeeren kamen die Stachelbeeren, Johannisbeeren, Buchsbeeren, Himbeeren, Heidelbeeren, Preiselbeeren und Kranzbeeren an die Reihe. Immer wieder rauchte der niedrige Ziegelschornstein unter den Eichen, prasselten die Birkenscheite im Herd, galoppierten Mädchenröcke zwischen den Büschen hin und her, klapperte Karlomchens Schlüsselbund über den Rasen, saß die Mutter mit vorgebeugtem Rücken über der Glut des Feuers, unter der Glut der Sonne und rührte mit dem Löffel. Endlich hatte sie die Hitze, die sie im Winter so entbehren mußte.
Manchmal kam auch der Vater schräg über den Rasenplatz, im weißen Leinenrock, den flachen Strohhut auf dem Kopf, den Spazierstock mit dem gekrümmten Griff in der Hand, setzte sich auf einen alten Baumstumpf und stocherte mit dem Stock in einem Maulwurfshümpel.
„Diese Biester“, sagte er ärgerlich, „zerwühlen den ganzen Rasen! Und diese Kalkhühner! Sie haben wieder die Tür offengelassen, und nun wimmelt es im Lesezimmer von Fliegen!“
Die „Kalkhühner“ waren ein für allemal die Mädchen, ganz gleich, wie sie gerade sonst hießen.
Ein „Kalkhuhn“ kam und meldete, der Verwalter wolle den Großherrn sprechen. Und der Vater ging langsam – hier und da stieß er einen Maulwurfshümpel mit dem Stock um – über den Rasen ins Haus zurück.
Auch Herr Ackermann saß manchmal hier in seinen grau gestreiften Hosen und schnitzte aus einer Kiefernrinde ein Boot für Aurel. Und dann wurde es im Teich aufs Wasser gesetzt. Oder der Postbote kam aus der Allee, wo er am Ahorn seinen Klepper angebunden hatte. Die alte schwarze Posttasche roch nach Staub und Leder, hatte eine eiserne Stange mit Vorhängeschloß, das schon von weitem klapperte. Aurel holte den Schlüssel, der in der Backstube hing, und die Tasche wurde geöffnet.
„Tante Olla kommt!“ sagte die Mutter mit einem Seufzer und ließ den Löffel sinken. Oder auch:
„Onkel Oscha kommt!“ Und dann sprang sie auf, strahlte wie ein junges Mädchen, hob Aurel in die Luft und wirbelte ihn im Kreise. Aber gleich darauf sank sie wieder erschöpft in den Stuhl, Aurel durfte die große Nachricht verkünden: „Onkel Oscha kommt! Onkel Oscha kommt!“ Und die kleine Adda hüpfte aufgeregt hinter ihm her.
Aber es konnte auch geschehen, daß mitten in diesem Sommerglück, in dieser glühenden Sonne, ein dunkler Wolkenschatten über den Rasenplatz lief, sich auf das Haus mit dem silbergrauen Schindeldach legte. Dann verloren die weißen Säulen ihren Glanz, die Fensterscheiben erloschen, und das Dach duckte sich unter der schwarzen Krone der Linden.
Und es konnte geschehen, daß Aurel mitten im froherregten Lauf mit einem Ruck stehenblieb und irgendwohin starrte: war nicht dort hinter den Büschen ein weißes, etwas schiefes Kopftuch aufgetaucht, ein dunkelroter Rock, den er kannte? Nein, es war nur Rosalia, das Viehmädchen, die mit dem Milcheimer aus dem Kuhstall kam, aber ihr wiegender Gang, ihre volle Gestalt riefen in ihm dunkle Erinnerungen wach. Es gab einen Stich, mitten ins Herz, einen brennenden spitzen Stich. Dann war der Wolkenschatten weitergezogen, das Haus mit den weißen Säulen lag wieder im prallen Sonnenlicht, und grün und unergründlich ragten die Linden schützend über das Dach.
Nach solchen besonderen Tagen, wenn die Mutter ganz erschöpft war und Aurel ihr so eifrig beim Beerenkochen geholfen hatte, durfte er etwas länger aufbleiben. Die Mutter ließ sich nach dem Abendessen einen Stuhl hinter die „Gardine“, die jungen Linden und Ellern, tragen, auf dem Wirtschaftsweg am Kleefeld hinstellen, und Aurel durfte einen kleinen Fußschemel mitschleppen. Dort setzten sich dann beide hin, um den Sonnenuntergang zu betrachten. Die rote Feuerkugel stand schon ganz niedrig am gelbgrünen Horizont, über den schwarzen Wäldern.
„Siehst du, wie sie jedesmal ein Stück näher zum Kruge untergeht“, sagte die Mutter, „und wenn der Winter kommt, fällt sie hinter der Allee in den Wald!“
„Und warum läuft sie dann nur bis zum Krug?“ fragte der Junge.
„Weil sie zu müde ist“, sagte die Mutter, „auch die Sonne wird müde, wenn sie den ganzen Sommer gearbeitet hat! Sieh, jetzt stößt sie schon an die Baumspitzen!“
„Und warum kann es nicht immer Sommer sein?“ forschte Aurel.
„Weil die Erde sich erholen muß. Aber es gibt Länder, wo es keinen Winter gibt und wo die Menschen nie frieren und Sonne und Erde nie müde werden. Sieh, jetzt fällt sie in den Jaunsemschen Wald!“
„Und warum gehen wir nicht hin, wo es immer Sommer ist?“ Aurel war aufgestanden und hatte sich auf den Schemel gestellt.
Die Mutter schwieg. Sie richtete sich ein wenig auf, dann sank sie in den Stuhl zurück:
„Weil es zu weit ist“, seufzte sie, „viel zu weit. Sieh, wie der Himmel brennt!“
„Und warum brennt der Himmel?“
„Damit wir wissen sollen, daß die Sonne wiederkommt, immer wiederkommt. Und weil wir den kürzesten Sommer haben, brennt bei uns der Himmel am längsten! Aber jetzt mußt du ins Bett!“
Von den Heuschlägen hinter dem Kruge stiegen weiße Nebel auf. Irgendwo weit von der Landstraße her klapperten Pferdehufe, brummte eine Ziehharmonika in den milchweißen Sommerabend.