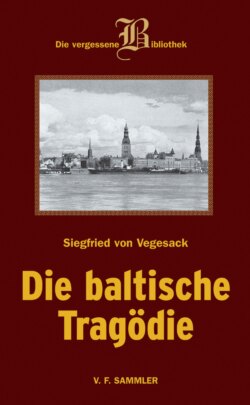Читать книгу Die baltische Tragödie - Siegfried von Vegesack - Страница 5
Einleitung
Оглавление„Was frommt es, dem Verlor’nen nachzuklagen?“ Siegfried von Vegesack – der Dichter des „Unverlierbaren“
Nirgends ist der Himmel so hoch und die Erde so groß,
nirgends sind die Wälder so ohne Ende.
Nirgends die Birken so weiß und so grün das Moos
und so rot am Abend die flammenden Sonnenbrände.
Nirgends ist die Erde so tief und das Wasser so stumm,
tief im bemoosten Brunnenschacht liegt es versunken.
Knarrend hebt sich die Stange, verwittert und krumm –
aber nirgends hab’ ich so gutes Wasser getrunken.
Nirgends ist der Sommer so hell – und so kurz.
Schon dunkeln die Weidenstümpfe, die Stoppelfelder, die müden.
Über dem Moor, immer tiefer zum Horizont, im flügelnden Sturz,
ziehen mit klagendem Schrei die Kraniche nach Süden.
Ein Land, geprägt von der Weite des Raumes, des Himmels, voller Wälder und Moore, Kornfelder und Kiefernstrände, unterbrochen nur von einzelnen, verstreut liegenden Gutshöfen, durchzogen von Lindenalleen, auf denen altmodische Kutschen und Kaleschen fahren: Eine Landschaft im Baltikum, mit Elchen und Störchen, die von der Rigaer Bucht in Lettland bis an den Peipussee an der estnisch-russischen Grenze reicht – Livland. Immer wieder hat der baltendeutsche Dichter Siegfried von Vegesack seine „Nordische Heimat“, wie dieses 1935 von ihm veröffentliche Gedicht heißt, lyrisch besungen. Den großen, inneren Auftrag, jene „versunkene Welt“ wieder ans Licht zu holen, der ihn von da an nie mehr losließ, verspürte er in der Mitte des Lebens, im 45. Lebensjahr. Er bedeutete die Hinwendung zu den Ursprüngen. Insbesondere mit seiner Prosa, allem voran der „Baltischen Tragödie“, hat er ein unverwechselbares Lebenswerk geschaffen und seiner verlorenen Heimat ein wohl einzigartiges Denkmal gesetzt.
Wer war der „Baron mit dem Monokel“ auf dem gesunden Auge, als den ihn seine Nachbarn kannten, und wie fand er zum Schreiben? Mit dem für ihn typischen, hintergründigen Humor schildert der am 20. März 1888 Geborene in seiner (wohl 1932) für die „Rigasche Rundschau“ verfaßten „Drei-Minuten-Biographie“ jenen Abschnitt bis zum dreißigsten Lebensjahr, der die wohl einschneidendsten Veränderungen mit sich brachte: „Auf dem väterlichen Gute Blumbergshof in Livland als neuntes Kind meiner Eltern geboren, wollte ich mit zehn Jahren Missionar werden. Ich las eifrig das Missionsblatt ‚Hosianna‘, lief in den Wald und predigte laut (da keine Schwarzen vorhanden waren) den Tieren und Bäumen. Später schoß ich ebenso eifrig Eichhörnchen, Hasen, Rehe, Füchse und zuletzt sogar einen Elch. Machte das Abitur, ich gestehe es tief beschämt, mit silberner Medaille, studierte (wenn man das so nennen darf) in Dorpat (ich weiß kaum noch was), verlor das linke Auge auf der Mensur, machte mit dem anderen Auge das russische Staatsexamen, setzte das Studium in Heidelberg, Berlin und München fort und war gerade fertig, als der Krieg ausbrach.
Da der russische Staat keine einäugigen Soldaten brauchte, konnte ich ungestört nach Schweden fahren, wo ich mit dreißig Rubeln in der Tasche ankam, mir zwei goldene Trauringe kaufte und mich am nächsten Tag in Stockholm trauen ließ. Ich arbeitete in der Redaktion einer schwedischen Zeitung, dann bei Paul Rohrbach in Berlin, nährte mich in der großen Zeit von Kohlrüben, Tee und Zwieback, den man nach langem Anstehen gegen ärztliches Zeugnis bekam und der aus Sägespänen hergestellt wurde. Als meine Beine blau wurden und die Adern platzten, floh ich mit meiner Frau und der sechs Monate alten Tochter in den Bayerischen Wald.
Hier fanden wir einen alten Raubritterturm mit Spuk und Gespenstern, der seit Jahren leer stand und deshalb für ein Butterbrot zu haben war. Mit vierundsiebzig Bierseideln (die einzige Hinterlassenschaft der alten Raubritter), sechs steinernen Kanonenkugeln und einem ungeheuren runden Tisch richteten wir uns gemütlich ein. Dann kauften wir uns eine Ziege, dann eine Kuh. Ich lernte das Mähen (zwei Sensen flogen dabei in Stücke), meine Frau das Melken, wir aßen Pilze, Beeren, Brennesseln und wurden gesund.“
Die Frau, die Vegesack in seiner Kurzbiographie erwähnt, ist seine erste Ehefrau, die schwedische Arzttochter und Schriftstellerin Clara Nordström (1886–1962). Sie ist es, die ihn zu seinem künftigen Schriftstellerberuf ermutigt, sie leitet ihn an. Kennengelernt haben sich die beiden im Frühjahr 1914 in München: Die Schriftstellerin in der Schwabinger „Pension Gisela“ ist die Tischnachbarin des Studenten bei den gemeinsamen Mahlzeiten. Bald verloben sie sich, und der Historiker kehrt mit ihr in die Heimat zurück, wo er mit einer Anstellung an der „Rigaschen Rundschau“ rechnet. Aber der Ausbruch des Ersten Weltkriegs durchkreuzt ihre Pläne: Clara Nordström muß das Baltikum verlassen. Vegesack folgt ihr nach Schweden; am 16. 2. 1915 heiraten sie.
Ein Jahr später ziehen sie zurück ins deutsche Kaiserreich. Da wegen Vegesacks russischem Paß Schwierigkeiten bei seiner Einwanderung nach Deutschland drohen, bürgt Ferdinand Graf Zeppelin, „der Luftschiffonkel“, der mit dessen Tante Isabella verheiratet ist, für ihn. Gemeinsam mit anderen Exilbalten arbeitet der Frischvermählte in der Pressestelle des Auswärtigen Amtes unter Paul Rohrbach in Berlin. Im „Ausschuß für deutsche Ostpolitik“ gibt er Korrespondenzen, Briefe und Bücher über die Baltische Frage und das Verhältnis zwischen Deutschland und Rußland heraus. Von Anfang an setzt sich der blonde junge Mann für eine Verständigung mit den Esten und Letten ein. Auf diese Tätigkeit bezieht sich jene Stelle in der „Baltischen Tragödie“, in der er die deutschen Gutsherren und Barone über sich sagen läßt: „Daß aber ein livländischer Edelmann sich dazu hergibt, für diese Kullen in Berlin Propaganda zu machen […] – das ist schon die Höhe! Was mag das für ein Vegesack sein? Sitzt in Berlin und will uns belehren.“
Mit den ersten politischen Artikeln erscheinen auch die ersten Gedichte. „Siegfried von Vegesacks zarte, leise und manchmal auch etwas spöttische Verse haben einen Unterton von versteckter Müdigkeit und überwacher Verträumtheit: Sie verbergen viel und verkleiden es mit seltsamen Masken“, urteilt Bruno Goetz in seinem Vorwort zu der Anthologie „Die jungen Balten“ (1916). Auch die ersten großen literarischen Arbeiten, die Vegesack schreiben wird – expressionistische Theaterstücke mit solch programmatischen Titeln wie „Die tote Stadt“, 1923 in Cottbus (ungedruckt), und „Der Mensch im Käfig“, 1926 in Prag mit Paul Hörbiger recht erfolgreich uraufgeführt – stehen noch ganz unter dem Einfluß seiner Berliner Zeit.
Im vorletzten Kriegsjahr verläßt die junge Familie Berlin und siedelt in den Bayerischen Wald über, wo der Dichter 1918 mit dem Geld seiner Schwiegermutter für 1800 Reichsmark jenes mittelalterliche Gemäuer erwirbt, das ihm zur neuen Heimat wird: seinen „Turm“, den ehemaligen Getreidespeicher der Burgruine Weißenstein oberhalb von Regen. Hier wird er fast fünfzig Jahre wohnen, hier schreibt er den Großteil seiner Werke. Im selben Jahr erlangt er die deutsche Staatsbürgerschaft. – „Nach dem grauenhaften Emigrantendasein in der Stadt, im Büro, auf fremden Gütern, ist hier dieses Leben gerade das richtige für mich! Die meisten wollen sich ja gar nicht hier in Deutschland einleben, sie hoffen auf das alte Rußland, sie sitzen zwischen zwei Stühlen in der Luft. Es gibt doch nur zwei Möglichkeiten. Entweder man bleibt in der alten Heimat, ordnet sich dort in die neuen Verhältnisse ein, oder man kommt nach Deutschland und wird hier nicht nur auf dem Papier Reichsdeutscher!“ läßt er den baltischen Baron Kai von Torklus, die stark autobiographisch gefärbte Hauptfigur seines ersten Romans, später sagen. Aber noch 1923 muß er sich gegen die Behauptung, er sei „kein Deutscher“, die über ihn in Regen im Umlauf ist, verteidigen: „Ich bin Deutsch-Balte von Geburt, d. h. ein Deutscher, der von Kindheit an für sein Deutschtum gegen die Russifizierung kämpfen und leiden mußte. Schon als Gymnasiast habe ich mich als Einziger meiner Klasse geweigert, die vom russischen Geschichtslehrer verlangte Erklärung ‚Ich bin ein Russe‘ niederzuschreiben, und bin deshalb den größten Schikanen und erbittertsten Verfolgungen von Seiten des russischen Lehrerpersonals ausgesetzt gewesen, ebenso auf der Universität. Während des Krieges habe ich mich am großen deutsch-baltischen Liebeswerk für die deutschen Kriegsgefangenen, das von der russischen Regierung streng verboten war, beteiligt und habe unter Lebensgefahr Briefe der aus Ostpreußen nach Sibirien verschleppten deutschen Zivilgefangenen über die Grenze in die Deutsche Gesandtschaft nach Stockholm gebracht […] und bin dann im Sommer 1917 nur in Folge monatelanger, durch die Berliner Unterernährung mir zugezogener schwerer Krankheit daran verhindert worden, als Freiwilliger die Ostoffensive mitzumachen“ (Schreiben vom 27. 4. 1923 an Dr. Hock).
Auch sonst ist sein Leben im Bayerischen Wald keineswegs idyllisch. Als Kleinstlandwirt und Selbstversorger muß er sich um Haus und Stall, Wiesen und Felder kümmern: „Und im Winter, wenn es nur Holz zu hacken gab“, erzählt er, „fing ich an zu schreiben.“ Der Dreißigjährige entscheidet sich für ein Leben als freier Schriftsteller. Niemals habe er „wegen des Geldes oder der Pension“ einen Beruf ergreifen wollen, bekennt er 1968 in einem Interview: „Wenn man mir so etwas anbieten würde – ich komme ja auch ab und zu in solche Käfige, in denen Menschen arbeiten, in Büros –, dann würde ich ablehnen.“ Seine Devise lautet: „Lieber ein hungriger Wolf sein als ein fetter Kettenhund.“
Anfangs leben die Ehepartner vor allem von ihren Übersetzungen: Aus dem Russischen überträgt der Sprachbegabte vor allem Gogol, Nabokow und Turgenjew, daneben u.a. Gedichte August Strindbergs aus dem Schwedischen, das er von seiner Frau gelernt hat. Immer wird er ein Leben der Bedürfnislosigkeit, längere Strecken hindurch gar der Armut führen. Als ihm nach seinem Theatererfolg ein Kölner Zeitungsverlag das hochdotierte und angesehene Amt des Chefredakteurs anbietet, lehnt er ab – er zieht die Freiheit seiner ‚Waldeinsamkeit‘ vor.
Als Aussteiger wird Vegesack bezeichnet, als Naturapostel, und bisweilen auch als weltfremder Eremit. Mit dieser Perspektive kokettiert der Dichter in seinem Lyrikband „Die kleine Welt vom Turm gesehen“ (1925). „Hab keinen Kalender und keine Uhr, / keine Zeitung dringt in mein Haus. / Sonne und Mond und Sterne nur / kommen und gehen tagein und tagaus“ – so beginnt das „Lied des Zeitlosen“, das er besonders liebte und immer wieder vortrug. Weitere Gedichtbände mit lyrisch-idyllischen und humoristischironischen Versen und Lebensweisheiten in der Nachfolge eines Morgenstern oder Ringelnatz werden folgen: so seine „Kleine Hausapotheke“ (1944), „Schnüllermann sieht das Leben heiter an“ und „In dem Lande der Pygmäen“ (beide 1953). Letzteres, ein Reich reiner Menschlichkeit und voller „Liebes-Lauben“, wo nicht die Keulen der „großen Schlag-Worte“, „sondern nur die Sag-Worte“ etwas zu sagen haben, läßt Vegesack in die Traumgefilde glückseliger Inseln entschweben und Thomas Mann ausrufen: „Das ist ja ein erstrebenswertes Land, Ihr Land der Pygmäen! O, wüßt ich nur den Weg dahin, drei Tage wollt ich wandern.“ – Auch mit Unterhaltungsromanen nach dem Vorbild seiner Frau wie „Liebe am laufenden Band“ (1929) und mit Kinderbüchern wie „Spitzpudeldachs“, seinen „Tiergeschichten aus dem Bayerischen Wald“, die er sich zusammen mit seinem 1923 geborenen Sohn Gotthard in den Sommerferien 1936 an der Ostsee ausdenkt, macht er sich einen Namen.
Vegesacks Wahlheimat ist in den zwanziger Jahren noch nicht an das Stromnetz angeschlossen. Der Familienvater indessen will seinen Strom selbst produzieren – was bei den Weißensteinern auf wenig Verständnis, noch weniger auf Unterstützung stößt. Um seinen Traum zu verwirklichen, stürzt sich der Dichter in exorbitante Schulden: 1924 kommt es zum Bau des legendären Windkraftwerkes. Seine Burg wird zum Modell einer autarken Aussteigerexistenz.
Doch die Renovierungsarbeiten nehmen kein Ende. Viele Künstlerfreunde sind bei dem so gar nicht antiquierten Adligen zu Gast, darunter Werner Bergengruen, Hans Carossa, Erich Mühsam, Ina Seidl, Reinhard Koeppel, Max Unold und immer wieder Alfred Kubin. Einer von ihnen, der Schriftsteller und SDR-Redakteur Werner Illing, beschreibt die in der damaligen Mühsal liegende Herausforderung, die Vegesack zum ernsthaften Romanautor macht: „Der Kampf mit dem Haus begann, er dauerte viele Jahre, bis endlich der Dichter den Turm dadurch in die Knie zwang, daß er ihn selbst zum Gegenstand eines literarischen Vorwurfs machte: das fressende Haus wurde zum Roman, zum ersten Roman, den Siegfried von Vegesack schrieb. Und weil der Roman erfolgreich war, half er die Löcher stopfen, die das Haus in den mageren Geldsäckel des Dichters gefressen hatte.“
Verherrlicht hat er das Aussteigerdasein nicht: In seinem Roman „Das fressende Haus“ (1932) erzählt er von einem baltischen Emigranten, der einen alten Turm im Bayerischen Wald erwirbt, jedoch in allen weiteren Unternehmungen scheitert. Als er alles Erworbene, sogar die geliebte Frau im Kindbett verliert, begreift Kai von Torklus, daß man nur das, „was man im Herzen bewahrt, wirklich besitzt“ – die für Vegesack vielleicht grundlegendste Erkenntnis. Sechs Verlage, darunter ein englischer (1936), werden das neben seiner baltischen Trilogie erfolgreichste Werk immer wieder auflegen, zuletzt 1978. – Isabel, Vegesacks Tochter, ist bereits 18 Jahre alt und gerade auf einer Italienreise unterwegs, als ihr der Vater im November 1935 folgenden Lagebericht aus Weißenstein gibt: „Hier gibt es ja schließlich auch einiges Schöne zu sehen, was es auf Capri bestimmt nicht gibt: dicker Dreck, Nebel, Regen. […] der Tee ist gefroren, man muß die Kruste mit dem Löffel durchschlagen, und das Wasser in der Waschschüssel ist gefroren, und die Zahnbürste hat Rauhreif, und die Handtücher sind wie aus Blech, und von der Decke rieselt der Kalk, manchmal fliegen einem auch angefaulte Asseln und klebrige Herbstfliegen auf den Kopf, auch Spinnen, und es zieht durch das ganze Haus, weil die Türen nicht zugehen oder kaputt sind, und auch die Fensterscheiben sind kaputt, und die Fensterstöcke angefault, und der Fußboden bricht überall ein, man bleibt mit dem Fuß zwischen den Brettern stecken, und das Treppengeländer wackelt, und wenn man im Dunkeln hinaufgeht, knallt man mit dem Knie gegen den Treppenabsatz, und wenn man anknipst, brennt das Licht nicht, weil es ausgeschaltet ist, und wenn es eingeschaltet ist, geht die Sicherung durch, und wenn die Sicherung durch ist, dann wird so lange herumprobiert, bis es Kurzschluß gibt und überhaupt keine Lampe brennt, und dann sitzt man im Dunkeln, d.h., wenn man sitzen kann und nicht vom Wind, der von unten weht, fortgeblasen wird.“
Erst 1966, fast ein halbes Jahrhundert, nachdem er den Turm bezogen hat, wird er einem Bekannten melden können: „Der Turm ist jetzt warm, in allen Stockwerken warmes Wasser!“ Der Name –„fressendes Haus“ – ist geblieben: Heute zählt es zu den kulturellen Sehenswürdigkeiten der Stadt Regen; neben dem Vegesack-Nachlaß beherbergt es im Erdgeschoß die Dichterstube als Erinnerung an das Schriftstellerpaar.
Es ist der mit ihm eng befreundete Zeichner Alfred Kubin, der ihn ermutigt, seine Erinnerungen an die baltische Heimat niederzuschreiben. Sein Hauptwerk, „Die Baltische Tragödie“, wird daraus entstehen, die mit der 33. Auflage im Jahr 1981 über 157.000 Exemplare erreicht. Siegfried von Vegesack wird zum Gestalter der baltendeutschen Lebenswende, zum „Historienmaler unter den Autoren der baltischen Welt“, so Wolfgang Schwarz in seinem Nachruf. Und der schöpferische Impuls entlädt sich wie ein Sturzbach. Als er am 12. März 1933 einige Tage in „Schutzhaft“ genommen wird, weil er die Hakenkreuzfahne, die „eine Horde von braunen Uniformen aus Regen“ auf dem Turm der Weißensteinschen Burgruine gehißt hatte, wieder herunterholen ließ, schreibt er in der Gefängniszelle „ungestört“ und „in aller Ruhe“, wie er lakonisch bemerkt, den ersten Teil der Trilogie zu Ende. In nur 43 Tagen hat er den Roman „Blumbergshof“ fertiggestellt.
„Das Buch lebt aus der Ursprungs- und Heimatwelt seines Dichters. Sorgfältig umhegt und doch schon Vergänglichkeitsschauern ausgesetzt, wächst ein verträumter Junge heran im ländlichen Herrenleben des Vorkriegsbaltikums, inmitten einer großen, von prachtvollen schrulligen Originalen durchsetzten Verwandtschaft“ – so umreißt Werner Bergengruen den Auftakt zur „Baltischen Tragödie“. Wie der Mittelteil ist er weitgehend autobiographisch geschrieben – Blumbergshof und Altschwanensee sind die Orte seiner Kindheit, und auch der Autor selbst träumte dort von einem Studium der Musik und war unglücklich in eine Kusine verliebt, bis er Clara Nordström kennenlernte. Die Welt seines Alter Egos Aurel ist die patriarchalische Welt der dünnen deutschen Oberschicht, und schon bald wird sich der kleine Protagonist bewußt, daß ihn eine „gläserne Wand“ von den lettischen Pächtern und Dienstleuten, von Janz, Karlin, dem alten Marz, der schwarzen Tina und Mikkel mit dem Daumenstumpf, trennt: „Es gab eben zwei Welten: die eine war still, mit bunten Dielenläufern, feiner Butter, Flüstern, gedämpften Schritten. Und die andere war laut, mit Quark und Gelächter und weißem Sand auf dem Fußboden.“ Die Gleichheit aller vor dem Gesetz gilt in Livland nicht – auch wenn die Leibeigenschaft 1816–19 aufgehoben wurde. Und Aurel wehrt sich innerlich gegen die Standesunterschiede – er will kein „Jungherr“ sein. Doch er muß erkennen, daß Traditionen und Vorurteile eine Überwindung dieser Distanz unmöglich machen: entgegen der starken Verbundenheit, die er seinen lettischen Untergebenen gegenüber verspürt. Auch Vegesack selbst vertritt diese Position: In den zwanziger Jahren wird er sogar aus dem Adelsbund ausgeschlossen, weil er sich in seinen – heute verschollenen – „Fürstengedichten“ gegen die Vorrechte des Adels gewandt hat.
In den Folgebänden wird der politische Hintergrund zunehmend bedeutsamer; Vegesack weitet seinen Entwicklungsroman eines jungen baltischen Adligen aus zur Schicksalsgeschichte einer ganzen Volksgruppe. Er schildert den Umsturz der alten Ordnung im Baltikum, die Ära der Russifizierung und Unterdrückung der deutschen Kultur während der Zarenherrschaft, die Grausamkeiten während der lettischen, estnischen und russischen Revolution von 1905 und schließlich den Verlauf des Ersten Weltkriegs im Baltikum: die Unabhängigkeitsbestrebungen der Letten und Esten, die Kämpfe zwischen Rot und Weiß, den todesmutigen Einsatz der „Baltischen Landeswehr“ zur Befreiung der Heimat von der Bolschewikenherrschaft, die in Riga vom 3. Januar bis 22. Mai 1919 wütet, und die blutigen Kämpfe des aus deutschen Freikorps aufgestellten „Baltenregiments“ im Frühjahr 1919 gegen das kommunistische Rußland. Am Ende kommt es zur Landreform und damit zur Enteignung der Deutschen, die bis dahin die führende Schicht in Livland, Kurland und Estland gebildet hatten. 700 Jahre lang, seit der Christianisierung des Baltikums durch den Deutschen Ritterorden, hatten sie das kulturelle Antlitz dieses Landes geprägt.
In „Herren ohne Heer“ beginnt sich Aurel der außerordentlichen Gefährdung der Deutschen in ihrem Leben als Minderheit bewußt zu werden, „denn Herren ohne Heer zu sein, ist“, wie Vegesacks Landsmann, der Dichter Otto von Taube, in einer Rezension schreibt, „das natürliche Los aller Kolonisten.“ Aurel erlebt die reale Bedrohung der Idylle als Einbruch in das Magische seiner harmonisch-behüteten Kinderwelt, dem schließlich im „Totentanz in Livland“ der heroische Untergang folgt. Nicht zuletzt kommt in den sehr unterschiedlichen Haltungen und Interessen der weit verzweigten Familie von Onkeln und Tanten des Aurel von Heidenkamp, die vom „angerussten“ Onkel Jegor bis zum dünkelhaften Vertreter deutschen Junkertums, Graf Bork, reicht, die innere Zerrissenheit der deutschen Minderheit zum Ausdruck. Auffällig ist auch die ironische Distanz, mit der die Stimme des Erzählers auf ihre Hauptperson, die in der großen Weltgeschichte doch nur zur „kleinen baltischen Nebenfigur“ wird, hinabschaut.
Tragödie – das bedeutet nach Ansicht des Erzählers eine Tragödie, die schon im 15. Jahrhundert begann, weil die von ihr betroffene Volksgruppe „allzuweit vom Mutterland abgesprengt“ war; das bedeutet aber auch die innerlich erlebte Tragödie im Konflikt all jener, die die große, heroische baltische Vergangenheit reflektieren und in Selbstzweifel geraten. Gefangen in ihrer Zerrissenheit müssen sie die baltische Tragödie in sich ausfechten – sie kommen auf der Suche nach Identität gegen die traditionellen Bahnen und die Last der Vergangenheit, das schwere Erbe, nicht an, so Carola Gottzmann in ihrem Aufsatz „Die baltische Tragödie in Aurel von Heidenkamp“: „Die Bürde der Geschichte, die auf dem Menschen ruht, fließt nicht nur mit dem Verhängnis des gewaltsamen Untergangs zusammen, sondern spielt sich auch in den Menschen ab. Die baltische Tragödie findet in Mischka, in Nix und in Aurel statt, während andere Personen des Romans, wie Balthasar, Onkel Nicolas, Jegor, Oscha, Rembert, Tante Olla und andere Verwandte und Bekannte von ihr als von außen kommende Macht überrollt werden.“ Aurel vergleicht sich selbst und seine Brüder mit dem Ehrfurcht einflößenden Werdegang seiner Ahnen: In seinem Bruder Balthasar sieht er einen Nachfahren derjenigen, die mächtige Herren in den Hansestädten gewesen waren – sein Bruder Christoph setzt die Tradition derer fort, die Soldaten waren. Reinhard repräsentiert für ihn den Bauern, der mit Zähigkeit und Geduld an seiner Scholle hängt: von einem westfälischen Bauerngeschlecht, das im 15. Jahrhundert nach Livland eingewandert war, stammen sie ursprünglich ab. – Und er? Die Selbsterkenntnis und Bilanz seines eigenen Lebens am Schluß des Werkes lautet: „So haben die großen Brüder das Erbe der Vorfahren unter sich aufgeteilt und dir, dem Jüngsten und Letzten, blieb nichts Richtiges übrig.“
Zentrales Thema der „Baltischen Tragödie“ ist der Verlust. Immer wieder muß Aurel gerade das verlieren, wozu er seine Zuneigung entfalten möchte, eine Bindung aufbauen kann – seien es nun Haustiere oder geliebte Menschen. Bereits der erste Band ist geprägt durch diese einschneidende, schmerzhafte Erfahrung: Ihm entschwinden besonders jene, die er am meisten liebt: seine Amme, der Hauslehrer oder der beste Freund. So wird dem sensiblen, verschlossenen Knaben ein Sich-Öffnen nur schwer möglich. Schließlich ist es der Tod des Vaters, der zum Begreifen des Endgültigen, des „Nie wieder“ führt.
Zeitlebens ist der Autor dieser Trilogie mit der Verarbeitung des Heimatverlusts beschäftigt. Noch auf der anderen Halbkugel der Welt, ein halbes Jahrhundert nach seinem Aufbruch, wird er wiederholt vom alten Blumbergshof träumen, wie ein aufgewühlter Brief vom April 1960 an seine Nichte bezeugt. Immer wieder ist Siegfried von Vegesack an den Ort, dem er sich so sehr verbunden gefühlt hat – nach Blumbergshof – zurückgekehrt: 1933, 1935, 1938, 1939 und zuletzt, in ein längst zweckentfremdetes und fremdes Haus, als Wehrmachtsdolmetscher im Zweiten Weltkrieg. Danach ist es nicht mehr möglich. „Was frommt es, dem Verlor’nen nachzuklagen?“ fragt er in „Das Unverlierbare“, das zusammen mit einer Reihe anderer Gedichte über seine unverlierbar-verlorene Heimat in wenigen Sommertagen des Jahres 1946 entstanden ist:
Um das Verlor’ne klagen nur die Toren…
Viel tiefer noch, als du es je besessen,
bewahrt’s das Herz und wird es nie vergessen:
Nur das ist unverlierbar, was du ganz verloren!
„Die Baltische Tragödie“ ist wohl der Roman zur Geschichte der Deutschen im Baltikum. Zu Beginn der NS-Zeit geschrieben, ist er trotz seines Erscheinungsdatums ein Appell an Toleranz und Verständigung zwischen den Mitgliedern verschiedener Volksgruppen. Ohne Pathos und Anklage, bis in Einzelheiten dokumentarisch getreu, zeichnet Vegesack die geschichtlichen Entwicklungen nach. Dennoch wird seine Trilogie – insbesondere wegen ihres politischen dritten Teils – nach dem Zweiten Weltkrieg mit Rücksicht auf die sowjetische und französische Zensur zunächst nicht wiederaufgelegt werden: Erst 1949 kommt es unter dem Titel „Versunkene Welt“ zur Neuausgabe des ersten Bandes; der „Totentanz in Livland“ (1935) und die einbändige Ausgabe der „Baltischen Tragödie“ von 1936 befinden sich in der Sowjetischen Besatzungszone 1946 gar auf der „Liste der auszusondernden Literatur“.
Die baltische Schicksalsfrage läßt Vegesack nicht mehr los, erstmals sucht er auch ihre unmittelbare Gegenwart dichterisch aufzuarbeiten, plant Anfang 1939 einen vierten Band. In ihm läßt er die im Baltikum verbliebenen Familienangehörigen des Aurel von Heidenkamp das Fazit ziehen: „Wir haben etwas geleistet, was am allerschwersten ist: wir haben wieder von vorne angefangen. Wir haben nicht die Hände in den Schoß gelegt und unserer großartigen Vergangenheit wehmütig nachgetrauert – wir haben zugepackt, wir haben uns ein neues, wenn auch sehr bescheidenes, aber doch eigenes Dasein geschaffen.“
„Ich machte mich an die Arbeit und habe in Weißenstein 1940 den ‚Letzten Akt‘ der ‚Baltischen Tragödie‘ geschrieben“, notiert der Dichter in seinem ungedruckt gebliebenen Rechenschaftsbericht „Wie ich die zwölf Jahre erlebte“. Wie die ehemaligen „Großherren“ nach der Güterenteignung von 1917 sich vergeblich um die Erhaltung ihrer „Restgüter“ bemühen, bis sie – wie sein älterer Bruder Manfred, das Vorbild für die Figur des Reinhard in dem Gesamtzyklus – durch die Zwangsumsiedlung ins Dritte Reich in den ersten Kriegsjahren die Heimat endgültig aufgeben müssen, ist das Thema dieses selbständigen Fortsetzungsbandes. Gewidmet ist „Der letzte Akt“ „allen Müttern, Vätern und Kindern aller Völker, die ihre Heimat verloren“. Der Autor verteidigt ihn in einem Brief an seinen Lektor vom Januar 1941: „Sicher gibt dieses Buch kein vollständiges, vielleicht auch einseitiges Bild vom Aufbruch der Balten – jedenfalls aber ein Bild, das der Wahrheit näher kommen dürfte, als das, was unsere Zeitungen, auf Befehl des Propagandaministeriums, dem deutschen Leser, wie Sie ganz richtig sagen, ‚in die Ohren gebrüllt haben‘ – von einem ‚geschlossenen Heim-Wollen ins Reich‘ kann bei uns Balten ebenso wenig die Rede sein wie bei den Südtirolern!
Mir kam es vor allem darauf an, den rein menschlichen Konflikt darzustellen, den die Balten jetzt durchmachen underleiden mußten, den Konflikt zwischen Heimatliebe und Treue zum eigenen Volk.“ In seinem Rechenschaftsbericht erzählt er weiter: „Die Kölnische Zeitung hat 1941 den Roman unter dem Titel ‚Und wenn sie nicht gestorben sind‘ als Vorabdruck veröffentlicht. Der Schünemann-Verlag wollte das Buch aber nur unter der Bedingung bringen, wenn das Manuskript völlig umgearbeitet und den damaligen Ansichten angepaßt würde – was ich natürlich ablehnte. Ich hatte über diese sogenannte ‚Umsiedlung‘ meine eigenen Gedanken, die ich in keinem Fall der damals propagierten ‚Heimkehr ins Reich‘ anpassen konnte. So ist ‚Der letzte Akt‘ erst lange nach dem Krieg – 1958 im Salzer Verlag – erschienen.“
Wiederholt hat sich Siegfried von Vegesack der Propaganda der Nationalsozialisten widersetzt – etwa, wenn er sich weigert, einen Glückwunsch der „Reichsschrifttumskammer“ zu Goebbels Geburtstag zu unterschreiben. Auch ihr Verlangen nach einer schriftlichen Erklärung, „stets für die Deutsche Dichtung im Sinne der Nationalen Regierung“ einzutreten, lehnt er mehrfach ab – mit Erfolg. Doch erst in jüngster Zeit hat die Literaturwissenschaft den Baltendeutschen vereinzelt den Vertretern der Inneren Emigration zugerechnet. „Als Mitglied der Paneuropäischen Union und der internationalen Künstlervereinigung Porza war ich schon längst der Partei ein Dorn im Auge“, kommentiert er seine frühe Verhaftung im März 1933. Dieser Künstlervereinigung haben die Eheleute von 1929 bis 1932 ihren Turm verpachtet; sie ziehen ins Tessin. Nur als Gäste kehren sie zeitweilig auf ihr Grundstück zurück. Vegesacks Wunsch, einer Vereinnahmung durch die Nationalsozialisten zu entgehen, sowie sein ausgeprägtes „Fernweh“ treiben ihn hinaus in die Weite: außer ins Tessin und ins Baltikum nach Schweden, Südtirol, Dalmatien und – Südamerika.
In Argentinien lebt nämlich „Nena“, Siegfried von Vegesacks – bis zu seinem Lebensende zumeist ferne – Geliebte. Dreimal – 1936–38, 1959–60 und 1965–66, noch mit 78 Jahren, wird er sie dort besuchen. Nicht von ungefähr heißt auch in der „Baltischen Tragödie“ eine von Aurels italienischen Spielgefährtinnen ‚Nena‘. Kennengelernt haben sie einander im Herbst 1929 in Lugano. Von Clara Nordström hat er sich bereits getrennt, auch wenn die Ehe erst 1935 geschieden wird: „Zuerst die Anthroposophie, und nun die Rassenseuche haben uns immer mehr entfremdet“, schreibt er Alfred Kubin im Mai 1935 über die Schwedin, die nach dem Krieg zum Katholizismus konvertieren wird. Nena – ihr richtiger Name lautet Lea de Loeb – ist Halbjüdin, geschieden und neun Jahre jünger als Vegesack; sie zieht im Februar 1932 mit ihren Kindern zu den Eltern nach Argentinien, wohin diese ausgewandert sind.
Weinend läuft der dreizehnjährige Gotthard dem Vater auf dem Bahnsteig bei dessen Abreise nach Südamerika im September 1936 neben dem abfahrenden Zug nach. Er hatte ihm zuvor einen Zettel in die Jackentasche gesteckt, den dieser aber erst in Argentinien entdeckt: „Komm bald zurück, ich brauche Dich sehr!“ Nach fünf Jahren sehen die Liebenden einander wieder; Vegesack trifft Nena in Montevideo. Ihm ist, „als wären wir nie getrennt gewesen.“
„Von diesen Wochen habe ich gezehrt, und davon lebe ich noch heute“,schreibt er 1967 in der „Überfahrt“, der Bilanz seines Lebens. Warum ist der Dichter nicht bei Nena geblieben? Er erzählt es in seinem Roman: „Und dann – die Nacht in der Pampilla. Weißt Du noch? Ich erinnere mich an alles. Wir waren hinaufgeritten – zu ‚meinem‘ Häuschen, einem alten Gemäuer, das verlassen über der Quebrada stand. Ich träumte davon, es mir als mein Zuhause einzurichten, und wollte es Dir zeigen. […] Wir ließen die Pferde im Freien grasen, saßen auf der steinernen Schwelle und schauten, wie der Feuerball in die Sierra versank. Als es dunkelte, gingen wir hinein. Ich hatte uns ein Lager bereitet.
Beim Abstreifen meiner alten Windjacke griff ich in die Tasche. Da kam der Zettel meines Jungen zum Vorschein. Ich gab ihn Dir. Du lasest ihn und sagtest kein Wort. […] Mitten in der Nacht wachte ich auf. Die Cresciente? Nein. Du schluchztest. Noch nie hatte ich Dich weinen gesehen. Ratlos saß ich da und begriff nichts. Der Mond, der über dem Gemäuer aufgegangen war, schien auf Dein Gesicht, über das unaufhörlich Tränen liefen. Und dann sagtest Du: ‚Nein – du mußt zurück. Du kannst den Jungen nicht im Stich lassen. Unser Glück wäre zu teuer erkauft. Wir müssen verzichten…‘
In jener Nacht fielen alle meine Träume zusammen. Du hattest recht. Du kanntest mich besser als ich mich. Du dachtest an mich – und nicht an Dich. Ich konnte nicht bei Dir bleiben – ich mußte zurück…“ – Ein seltsam verdichtetes Zusammenspiel, denn auch von Gotthard, seinem ersten Sohn, soll er bald Abschied nehmen: 1944, erst zwanzigjährig, ist Gotthard von Vegesack in Polen als Flieger gefallen. Als Nachruf erscheint 1947 Vegesacks Gedichtsammlung „Mein Junge“, in der er seiner Trauer Ausdruck gibt.
Im Mai 1938 reist der Dichter zurück nach Deutschland, nutzt die knapp zweijährige Tätigkeit als Auslandskorrespondent für seinen ersten Reisebericht „Unter fremden Sternen“ (1938). „Es war ein großes Glück für mich, daß ich noch kurz vor Tores-Schluß so viel von der Welt sehen und mich mit unvergeßlichen Eindrücken vollpumpen konnte“, schreibt Vegesack im März 1940 an Kubin. „Sie tragen Ihre Welt in sich und brauchen deshalb nur aus Ihrem Innern zu schöpfen; bei mir ist das anders: ich muß mir alles hereinholen, muß die Dinge leibhaftig sehen, damit sie im Innern lebendig werden! Aber nun bin ich für Jahre versorgt!“ Erzählungen aus Argentinien (1940), Paraguay (1941), Chile (1942) und Brasilien (1947) entstehen. Stets bildet die Grundstimmung immer wiederkehrender Schwermut und Melancholie den fruchtbaren Boden für Vegesacks Humor. Die Liebesgedichte, die der Bewunderer Schopenhauers über Nena schreibt, sind „durchzogen vom Wissen um die Zerbrechlichkeit des Glücks, aber immer wieder auch erfüllt von jener Weisheit des Heimatlosen, den sein entwurzeltes Leben lehrte, daß man nur das besitzt, was man ganz verlor: das vollkommen Verinnerlichte. So wird auch verinnerlichte Liebe selbst durch Ozeane nicht getrennt“, schreibt Franz Baumer – es sind melancholische Liebesgedichte. Für Vegesacks zweite Frau Gabriele, „Jella“ genannt, ist das Ertragen seiner Zerrissenheit sicher nicht leicht: Von Anfang an hat sie von seiner fernen Liebe gewußt, nie aber geglaubt, daß diese so unauslöschlich sein würde. „So ganz allein im Turm – das ging doch nicht auf die Dauer. Meine zukünftige Frau […] ist ein lieber, warmer, völlig unkomplizierter Mensch – gerade das, was ich brauche!“ schwärmt der Ledige: „So wird nun im Turm ein neues Leben beginnen – ich wollte fort, aber er läßt mich nicht los, und nun werden sogar neue Wurzeln geschlagen. Ich habe das Gefühl, daß ich Ihrem Beispiel folgen, mich immer tiefer hier vergraben und von der Welt da draußen abschließen werde. Aber dazu braucht man einen Menschen, der die Einsamkeit teilt, – sonst erfriert man. Und ich glaube, daß ich diesen Menschen gefunden habe!“ schreibt er am 1. März 1940 an Kubin. Im April heiratet er Jella, die Tochter eines Obersten aus Würzburg, zum Jahresende wird ihr gemeinsamer Sohn Christoph geboren.
Doch bald schon ist Vegesack von der Familie getrennt: „Als der Krieg im Osten ausbrach, meldete ich mich […] freiwillig als Dolmetscher“, erzählt er in seinem Rechenschaftsbericht. Im Mai 1942 setzt ihn ein Flugzeug in Poltawa ab; von dort aus trampt der 54jährige „ohne Auto und keinem Vorgesetzten unterstellt, kreuz und quer, meist in Lastwägen oder Güterzügen, im Süden bis in die Krim und den Kaukasus, und im Norden nach Reval und Narwa hinauf“. Als „Sonderführer“ kommt er in die Ukraine, nach Georgien, schließlich auch in die alte Heimat: „Als Dolmetscher im Osten hatte ich mich anfangs noch einigen Illusionen hingegeben. Doch mit der Zeit wurden meine Eindrücke immer skeptischer. Im Frühjahr 1944 erhielt ich vom damaligen Chef des Wirtschafts-Stabes-Ost – General Stapf – den Auftrag, auf Grund meiner Berichte und eines umfangreichen Materials von Dokumenten, die mir zur Verfügung gestellt wurden, eine Denkschrift über die ‚Behandlung der Bevölkerung‘ in den von uns besetzten Gebieten zu schreiben, und zwar so, wie ich die Dinge sehe, ohne jede Rücksicht auf höhere Dienststellen. Einzelheiten dieser Denkschrift hatte ich mit Graf Peter Yorck von Warthenberg besprochen, der bei uns im Stab tätig war.
Am 17. Juli 1944 lieferte ich meine Denkschrift in Berlin ab. Schon am nächsten Tag empfing mich General Stapf mit den Worten: ‚Wissen Sie, was Sie da geschrieben haben? Eine furchtbare Anklage!‘
Ich erklärte dem General, daß ich meine Denkschrift so geschrieben hätte, wie es mir befohlen war: ohne jede Rücksicht, so wie ich die Dinge sehe. Den 20. Juli erlebte ich in Berlin. Gleich darauf wurde ich von General Stapf nach Weißenstein beurlaubt.
Erst später habe ich erfahren, daß General Stapf mit Graf Yorck von Warthenberg zu den Verschwörern gehörte und daß meine Denkschrift gleich nach geglücktem Attentat veröffentlicht werden sollte. Im letzten Augenblick, als General Stapf am 20. Juli sich in die Bendlerstrasse zu Graf Yorck begeben wollte, wurde er gewarnt, so daß er zu Hause blieb und meine Denkschrift nicht in die Hände der Gestapo gefallen ist. Später bin ich zwar von der Gestapo in Regensburg verhört worden, aber man konnte mir nichts nachweisen. Graf Peter Yorck wurde hingerichtet. Im Oktober 1944 nahm ich meinen Abschied.“
Sein erstaunlich unabhängiger und deutlich kritischer Bericht „Als Dolmetscher im Osten. Ein Erlebnisbericht aus den Jahren 1942–43“ kann erst 1965 erscheinen. „Bei der Aussicht, die eine Gewaltherrschaft (der Bolschewiken) nur durch eine andere (die deutsche) zu vertauschen, zu einer deutschen Kolonie herabzusinken und als ‚weiße Neger‘ und ‚Untermenschen‘ für den deutschen Herrn zu schuften, war es kein Wunder, daß auch die deutschfreundlichen Elemente, die uns mit Begeisterung als Befreier begrüßt hatten, in kurzer Zeit alle Sympathie für uns verloren und wieder dem Bolschewismus zugetrieben wurden. […] Man kann kein Volk gewinnen, wenn man ihm ständig seine Minderwertigkeit vor die Nase hält, ganz abgesehen davon, daß diese Völker alles andere als minderwertig sind“, heißt es in seinem von Paul Rohrbach, dem politischen Schriftsteller, als „Geheimschrift“ gewürdigten Text.
Auch als Dichter setzt Vegesack sich mit der Herrschaft der Nationalsozialisten auseinander; als Versuch, ihren Aufstieg und die ungeheure Zustimmung in Deutschland für Adolf Hitler zu erklären, entsteht im Februar 1946 „Das Weltgericht von Pisa“ – eine von Thomas Mann lobend hervorgehobene Erzählung, die sich mit der Schuldfrage befaßt.
Gerhard Storz, der Präsident der Darmstädter Akademie für Sprache und Dichtung, in die der Balte 1956 berufen worden war, würdigt in einer Festschrift zu Vegesacks 80. Geburtstag die moralische Autorität und Integrität dieses Mannes: „Er hat sie sich erworben, weil er an das Gute im Menschen glaubt“. Nicht nur die Stadt Regen hat den Dichter nach dem Zweiten Weltkrieg ausgezeichnet, indem sie ihn zu ihrem Ehrenbürger macht: 1961 erhält er den Literaturpreis und 1973 die Ehrengabe der Stiftung zur Förderung des Schrifttums, 1963 den Ostdeutschen Kulturpreis der Künstlergilde Esslingen. Anläßlich der Verleihung des letzteren verliest er sein Glaubens-„Bekenntnis“: „Mag es auf unserem kleinen Planeten auch wie in einem Tollhaus zugehen, so glaube ich doch, allem Niedrigen und Niederträchtigen zum Trotz, an das Gute im Menschen, an seine Bestimmung, an den Sinn und den Wert dessen, was das Leben lebenswert macht: an Tapferkeit, Ritterlichkeit, Duldsamkeit, Treue und Lauterkeit der Gesinnung, an die große, den ganzen Erdball umspannende Kameradschaft und Brüderlichkeit aller, die guten Willens sind.“
Noch weiter, über die früheste Kindheit hinaus, verfolgt er nun die eigene Lebensspur zurück. 1960 ergänzt Vegesack seine ‚Trilogie mit Nachspiel‘ um eine Vorgeschichte: „Vorfahren und Nachkommen“. Seine „Aufzeichnungen aus einer altlivländischen Brieflade 1669–1887“ sind die über den Zweiten Weltkrieg von einem Bruder nach Deutschland geretteten Briefe der Freiherren von Campenhausen, seiner Vorfahren mütterlicherseits, die auch in den Ahnenporträts in der „Baltischen Tragödie“ bereits auftauchen. Ein reiches politisches und kulturgeschichtliches Panorama entfaltet Vegesack darin, das – wie er im Februar 1960 Werner Illing aus Argentinien schreibt – „aus der Perspektive eines livländischen Gutshofes […] Pietismus, Aufklärung, Französische Revolution, Napoleon, Befreiungskriege, Biedermann-Zeit usw.“ widerspiegelt.
Bis zuletzt erweitert der Dichter den Erzählkreis seiner baltischen Welt: Nach seinen „Altlivländischen Idyllen“ („Der Pastoratshase“, 1957) erscheinen 1965 seine „Baltischen Erzählungen“ sowie ein Jahr zuvor das Hörspiel „Die Liebeserklärung“ – in welchem sich die beiden wichtigsten Hauptfiguren seiner Romane, Aurel von Heidenkamp und der Baron Kai von Torklus, in einem Altersheim voller Baltendeutscher begegnen – und zuletzt, 1970, seine liebevoll-amüsanten Porträtskizzen „Die Welt war voller Tanten“.
In „Jaschka und Janne“ (1965) erzählt Vegesack erstmals von einer Überwindung der „gläsernen Wand“, von einer Liebe in der Universitätsstadt Dorpat über die Volksgrenzen hinweg. Unterschwellig kontrastiert er zudem die Lebensschwäche deutschbaltischer Herren und die Tüchtigkeit und Vitalität der einheimischen Esten: Jaschka, dem deutschen Bummelstudenten und künftigen Majoratsherrn, gelingt es, die kleine estnische Näherin Janne, gegen alle Vorurteile zu ehelichen, und gemeinsam durchleben sie die bewegten Stationen der baltischen Geschichte: Enteignung, Umsiedlung und Verschleppung durch die Bolschewiken. „Natürlich sind es baltische Erinnerungen“, schreibt Vegesack am 6. Oktober 1965 über seine jüngst erschienenen Erzählungen an Nena, „da ich ja dort aufgewachsen bin, aber beide Erzählungen erweitern und vertiefen das ‚Baltische‘ meiner Balt. Tragödie ins Allgemein-Menschliche, sind also keineswegs ‚Wiederholungen‘! Die ‚Baltische Tragödie‘ mußte ich doch so schreiben, wie ich sie erlebt habe: die Letten und Esten blieben im Hintergrund, und die Russen waren unsere ‚Feinde‘, da ich ja mitten in der Russifizierung aufgewachsen bin. In ‚Jaschka und Janne‘ versuche ich unser gemeinsames Schicksal mit den Letten und Esten darzustellen – die es ja viel schlimmer haben als wir Deutsch-Balten, da sie mit der Heimat auch ihren Sprachraum verlieren. […] Und in der ‚Hochzeit‘ wird das gute deutsch-russische Verhältnis dargestellt, das ja vor der Russifizierung bestand: die ‚russische‘ Zeit war ja vor der Russifizierung die glücklichste und friedlichste, die wir Balten gehabt haben!“
Nur für kurze Vortragsreisen unterbricht der baltische Poet sein zurückgezogenes, arbeitsreiches Dasein. Über siebzig selbständige Werke hat er im Laufe seines Lebens geschaffen. „Ich habe nie irgendeiner Gruppe, einer Richtung oder irgendeinem –ismus angehört“, sagt er über sich und seine Literatur, „aber man muß natürlich bestimmte Leitbilder haben“: Die seinigen sind Jean Paul und Adalbert Stifter; unter seinen Zeitgenossen verehrt er daneben „Knut Hamsun, den Norweger, und bei den Deutschen Thomas Mann“.
In den fünfziger und sechziger Jahren arbeitet er bevorzugt für den Hörfunk, wo er seine Texte zum größten Teil selbst lesen kann. Werner Grüb, der damalige Abteilungsleiter des Süddeutschen Rundfunks, erinnert sich an das Erscheinungsbild des Gealterten: „Als er mein Zimmer betrat, stand der Dichter der ‚Baltischen Tragödie‘ leibhaftig vor mir: Ein Mann um die Fünfundsiebzig in einem Anzug, der möglicherweise einmal bessere Tage gesehen hatte, ein Mann mit einem Gesicht, das leidvolle Erlebnisse spiegelte und sich zugleich über sie zu mokieren schien, ein Gesicht, das nicht von Falten des Alters, sondern von Runen eines Schicksals geprägt war, das seine Spuren tief eingekerbt hatte; und der Mann, der diese Spuren mit unverkennbarem Stolz zur Schau trug.“
„Was und wie die Welt auch sei, / unentwirrt und unentwirrbar, / bleibe dir nur selber treu: / unbeirrt und unbeirrbar!“ lautet Vegesacks Motto über alle Zeiten hinweg. Längst sind er und die Einheimischen, die ihn anfangs als den ‚g’spinnaten Baron‘ bezeichnet haben, gute Nachbarn. Als scharfer Beobachter seiner Umwelt hat er sie und ihren kargen Alltag porträtiert, erstmals 1942 in seiner Erzählung „Das Dorf am Pfahl“ – auf diesem Quarzgang, der den Bayerischen Wald durchzieht, führt der Weg vom Turm des Dichters über die ehemalige Zugbrücke hinaus. Vom Leben im „Fressenden Haus“ nach dem Zweiten Weltkrieg gibt der Schriftsteller Georg Britting, der ihn Ende August 1953 besucht, ein anschauliches Bild: „Ich ging zu ihm hinauf nach Weißenstein (3/4 Stunden steiler Anstieg), und er schleppte mich weitere zwei Stunden entlang des ‚Pfahl‘, und wir landeten in seinem Turm, wo die vier Brüder Vegesack hausen, drei davon tragen ein Monokel, Siegfried ist 65, die anderen 70, 73, 79, reizende baltische Barone und drei Frauen und 6–7 Kinder und Enkel, aber gar nicht bohèmisch, mit Ziegen, Kühen, Hasen, Obstgarten, 4 Hunden. Jeder der Brüder eine 3-Zimmerwohnung, so geräumig ist der Turm!“ Noch immer haust er in seinem „alten Gemäuer – mehr Ruine als Haus“, in dem nur zwei Räume, das Wohnzimmer und sein Arbeitszimmer „mit Mühe und Not“ beheizbar sind, und wo selbst das Wasser keine Selbstverständlichkeit ist: „Bei starkem Frost oder großer Dürre mußte ich es früher oft Wochen lang in Eimern von der Quelle herschleppen, was besonders im Winter, wenn man das Eis aufhacken mußte, kein Vergnügen war“, schreibt er im Februar 1963 seinem Regisseur im Bayerischen Rundfunk.
Vegesacks Hilfsbereitschaft kennt fast keine Grenzen, nach dem Zweiten Weltkrieg beherbergt er zahlreiche Flüchtlinge und Verwandte aus Ostdeutschland in seinem Turm – seine Ehefrau hat es nicht immer leicht: „Zu Weihnachten erhält sie oft nur selbstgezeichnete Gutscheine des Gatten, auf denen alle die schönen Dinge abgebildet sind, die er ihr, sobald wieder genügend Geld im Hause ist, schenken wird“, weiß Franz Baumer, der die bislang einzige Vegesack-Biographie geschrieben hat.
Zeitlebens bleibt Vegesack bestrebt, ein Leben im Einklang mit der Natur zu führen. Aus ihr speist sich die Inspiration für sein Werk: „Ich kann nicht im Zimmer sitzen und meine Sachen ausbrüten. Ich muß hinaus in die freie Natur, in den Wald, ich muß Nadelboden unter den Füßen haben, Bäume neben mir, Wolken über mir, und wenn ich dann auch später zurück zum Schreibtisch gehe: das Beste fällt mir doch erst beim Wandern ein.“ Noch als 80jähriger fährt er im Winter auf Skiern hinunter nach Regen. Nie hat er ein Auto besessen – und es nie vermißt. Der „rollende Blechkasten“ ist ihm nur das fehlgeleitete Wunschbild „dieser neuen Zeit und ihrer Menschen, die ihr Dasein nicht im Da-sein, sondern nur noch in einer möglichst schnellen Fortbewegung genießen können, in einer Fluchtbewegung, fort von sich selbst.“ Lieber bleibt er zu Hause und genießt in Erinnerung an Südamerika seinen Mate aus seiner silbernen Bombilla, wie es bereits seit den dreißiger Jahren sein morgendlicher Brauch ist. Siegfried von Vegesack – der Umweltschützer: 1958 protestiert er, zusammen mit vielen anderen deutschen Autoren von Ilse Aichinger bis Martin Walser, in einem Aufruf „Gegen die atomare Bewaffnung“ der Bundeswehr; als Gegner des Quarzabbaus im Bayerischen Wald setzt er sich für den Erhalt des Pfahls ein, wehrt sich gegen die Errichtung einer Müllhalde und gegen die Bausünden der sechziger Jahre.
„Was hat mich eigentlich hier festgehalten?“ sinniert der 75jährige in dem über ihn gedrehten Fernsehfilm. „Diese Landschaft, das Land, die sind doch hier ganz anders als in meiner alten Heimat in Livland. Und doch: etwas Gemeinsames haben beide: diese Weiträumigkeit, den weiten Horizont und den Wald.“ So ist ihm auch der Bayerische Wald zur vertrauten Atmosphäre geworden. „Hier spürst du“, schreibt er ein anderes Mal, „umwittert vom Spuk, noch einen Hauch der Urzeit, den Atem natürlichen Bodens. Wenn deine Seele krank ist, dann verbirg dich, wie ein verwundetes Tier, in den Wäldern: sie werden dich heilen.“ Vielleicht auch deshalb verspürt er ein Unbehagen davor, einmal auf einem „alljemeinen Friedhof“ liegen zu müssen, wie er seinen Freunden regelmäßig mit dem melodisch-schwingenden Tonfall seiner baltendeutschen Mundart anvertraut.
Wie die Natur liebt Vegesack die Einsamkeit, die Stille, das Schweigen. In seinem Essay „Vom Schweigen“ heißt es: „Im Anfang war das Wort, aber vor dem Wort war das Schweigen. Nur aus der stummen Einsamkeit Gottes wurde das Wort und damit die Welt geboren. Gott brach als erster das Schweigen, und seitdem haben wir Menschen es in immer wieder kleinere Stücke zerbrochen. Vom großen Schweigen ist uns nicht viel übriggeblieben. Im Gebirge, auf dem Meere, in tiefen Wäldern, mittags, in der Stunde Pans, oder nachts unter brennendem Sternenhimmel verspüren wir noch zuweilen einen Hauch von jenem Schweigen, aus dem einst die Schöpfung hervorrollte… Und wenn du auch den ganzen Erdball mit Antennen umspannst und neben jedem Kilometerstein einen Lautsprecher aufstellst – einmal, kleiner Mensch, wirst du doch in jenes Schweigen zurückkehren, aus dem einst die Schöpfung rollte und Gott uns hinausstieß.“
In dieses Schweigen zieht er sich im Alter immer mehr zurück: bis er, der Wortkarge, schließlich gar kein Wort mehr spricht – nachdem im Mai 1972 Jella, seine 15 Jahre jüngere Frau, unerwartet gestorben war. Keine zwei Jahre später, am 26. Januar 1974, folgt Vegesack ihr nach. In einem Nachruf erinnert sich Hermann Stahl des Dichters als eines Mannes „von untadeliger Aufrichtigkeit und vielschichtiger Interessen, herzlich, formbewußt, von so klarer wie liebenswürdiger Intelligenz und Geradheit, nobel und fern jedweder Möglichkeit der Medisance, rechtschaffen und künstlerisch, ein Mann ohne äußere Prätention, Bewohner eines steilen Turms, in dem es Stolz gab und langsames Sich-Gewöhnen jahrzehntehin, Mühsal, Disziplin und manchmal beschwiegenes Heimweh wohl auch, auch Not zum Ende hin, bis sie und alles, fast alles, ferngerückt war zuletzt, in einem Turm bei Regen im Bayerischen Wald, einem Turm aus Stein, nicht aus Elfenbein.“
Nur ein paar Steinwürfe von diesem Turm entfernt, auf einem einsamen Bergrücken, fand der Dichter seine letzte Ruhestätte – in einem Freigrab neben seiner Frau Jella am Waldesrand, das er den Behörden in einem jahrelangen Kampf abgetrotzt hatte. Über diesem hängt – am Stamm einer Kiefer – sein Totenbrett, auf dem, durchdrungen von Vegesacks feinem Humor des Sich-nicht-so-Ernst-Nehmens, zu lesen ist:
Hier, wo ich einst gehütet meine Ziegen,
Will ich vereint mit meinen Hunden liegen!
Hier auf dem Pfahle saß ich oft und gern:
O, Wandrer, schau dich um und lobe Gott, den Herrn!
Meike Bohn