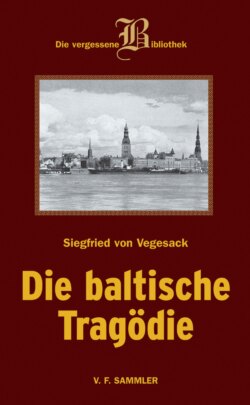Читать книгу Die baltische Tragödie - Siegfried von Vegesack - Страница 13
Der Schattenbaum
ОглавлениеDie Linden werden kahl, der Wind fegt durch die Allee, manchmal wirbelt schon etwas Weißes in der Luft. Die Oleander stehen wieder im Saal vor den zur Seite gerafften Fenstergardinen; in den Kachelöfen knallen die Birkenscheite, und zwischen den Doppelfenstern liegen bunte Strohblumen auf weißem Moospolster. Und Fömarie trägt dicke, grauwollene Unterwäsche.
Aurel weiß das ganz genau. Wenn Fömarie am Morgen aufsteht, kommt sie jedesmal an sein Bett. Dann hat er die Augen geschlossen. Wenn sie sich aber wäscht und anzieht, schielt er heimlich zwischen den Gitterstäben zu ihr hinüber. Und da sieht er merkwürdige Dinge: Haare unter den Armen und komische Hängesäcke an der Brust. Dann stopft sie alles in graue Wolle, schnallt sich einen Panzer mit Eisenstangen herum (Aurel hat ihn einmal, als er auf dem Stuhl lag, genau untersucht) und stülpt sich die vielen Röcke über den Kopf. Welch ein Glück, daß man ein Junge ist.
Und dann, an einem grauen Regentag, kommt Schlunski. Sein gelber Klepper mit dem vollgepackten, von einem Schutzleder überzogenen Wägelchen hält vor der Küchentür, und in der Backstube auf der Mehltruhe breitet er seine Schätze aus: geblümte Kattunballen, rote Sacktücher, Haarspangen, glitzernde Broschen, funkelnde Diamantringe, Mundharmonikas und viel bunte Glasperlen.
Die schwarze Tina, Karlin, Liese, die alte Minna, Janz, der aufgeregte Mickel, Marz, Rosalia vom Viehstall, alle Mädchen vom Hof, ja sogar Trulla, die dicke Verwaltersfrau, drängen sich in der Backstube, kichern, schwatzen und feilschen. Und Schlunski, mit seinen ausgefransten Peissacken, dem dicken schwarzen Kaftan und dem komischen Mützchen auf dem Kopf, steht wie ein König da und verteilt seine Reichtümer. Ja, er schenkt wirklich Aurel eine kleine Mundharmonika, und Adda bekommt bunte Glasperlen, und beide sind so glücklich, daß sie wortlos dastehen und den fremden Mann wie den lieben Gott anstaunen.
Auch später, als der liebe Gott in der Gesindestube zu Mittag ißt, sehen sie ihm heimlich zu. Es gibt Klöße mit Heidelbeersoße. Und als Schlunski gegessen hat, wischt er sich schmatzend den Mund und sagt laut:
„Klümpchen mit Schwarzbeeren schmecken gut!“
Aurel läuft ins Speisezimmer, wo die Großen noch am Tisch sitzen, und verkündet laut:
„Klümpchen mit Schwarzbeeren schmecken gut!“
Adda rennt aufgeregt hinter ihm her und wiederholt immer wieder:
„Klümpchen mit Schwarzbeeren schmecken gut!“
Bis Fömarie es verbietet. Jetzt können sie es nur heimlich ganz leise sagen, aber gerade dadurch bekommen diese Worte einen besonderen Reiz, und jedesmal, wenn es seitdem Klöße mit Heidelbeeren gibt, stoßen sich die Kinder unter dem Tisch an und flüstern:
„Klümpchen mit Schwarzbeeren schmecken gut!“
Aber noch besser schmecken die heißen, frischgebackenen Pfefferkuchen, die Marzipanplätzchen, Eierbiskuits und Schmantbonbons, die an den Zähnen so kleben. Immer gibt Karlomchen etwas zum Probieren, den ganzen Tag wird in der Backstube geknetet, der Teig auf einem Brett flachgerollt, werden lange schwarze Pfannen in den glühenden Ofen hinein- und herausgeschoben. Aurel und Adda dürfen das Brett mit Mehl bestreuen und den Pfefferkuchenteig mit Blechformen ausstechen: aus der toten braunen Masse entstehen Hasen, Hähne, galoppierende Pferdchen, Sterne und Herzen. Und auf jedes Herz wird in der Mitte eine weiße Mandel gedrückt.
„Warum?“ fragt Aurel.
„Weil es so hübscher aussieht“, sagt Karlomchen und rollt einen neuen Teigklumpen aus.
„Und warum bekommen die Hasen keine Mandel?“ fragt Aurel vorwurfsvoll.
„Papperlapapp“, sagt Karlomchen und wendet den Teig, „lirumlarum Löffelstiel, kleine Kinder fragen viel, fragen dies und fragen das: warum ist der Regen naß? Warum …“
Und schon stürzt sie zur Ofenklappe und zieht mit einem eisernen Haken die Pfanne heraus. Das ganze Haus duftet nach Pfefferkuchen, nach Honig, nach Sirup, Marzipan und Safran.
Und wenn es dunkel wird, sitzt alles im Saal am großen runden Tisch um die weiße Petroleumlampe: dann werden Walnüsse und Tannenzapfen vergoldet, bunte Kugeln, glitzernde Pappengel, Sterne, winzige Silbertrompeten ausgepackt und Ketten aus Goldpapier geschnitten und geklebt. Auch die großen Brüder arbeiten mit, wenn sie auch merken lassen, daß sie eigentlich viel zu groß dafür sind – aber die Pfeffernüsse, die Karlomchen auf den Tisch gestellt hat, verschmähen sie doch nicht.
Dann und wann kommt auch der Vater aus dem Lesezimmer, schaut zu, pafft dicke Rauchwolken über den Tisch und sagt plötzlich:
„Eine Motte!“
Die Mutter, Karlomchen, Fömarie, die Kinder – alles springt auf, alles klatscht mit den Händen wild in der Luft herum:
„Mein Gott – die Lampe – wo? Wer hat sie?“
Aber die Motte und der Vater sind ebenso plötzlich wieder verschwunden.
Und dann kommt der Tag, an dem der Vater mit den großen Brüdern in den Wald geht, um den Weihnachtsbaum zu holen. Den ganzen Nachmittag hocken Aurel und Adda auf dem Fensterbrett im Spielzimmer und drücken die Nasen an der Glasscheibe platt. Draußen ist alles weiß, und immer neue weiße Flocken fallen groß und dicht vom Himmel herunter. Den kahlen schwarzen Ahorn kann man kaum noch erkennen.
Endlich tauchen vermummte Schneemänner in der milchigen Dämmerung auf, der Vater, die Brüder – und hinter ihnen wandert, lang ausgestreckt auf vier Beinen, dunkel, mit schaukelnden Ästen, ein mächtiger Baum. Beide Flügel der Haustür werden aufgerissen, Mickel und Janz zerren, ziehen und stoßen, ein eisiger Wind weht in den Flur – „Kinder, es zieht!“ jammert Fömarie –, und das schwankende Ungetüm rauscht in den Saal. Es riecht nach Tannennadeln, Harz und Rinde. Dann steht der Baum da. Von den Ästen tropft es, Eisklumpen fallen klirrend auf den Fußboden. Es ist, als wäre der ganze dunkle Wald in das Haus eingebrochen.
Am nächsten Tag wird geschmückt: die goldenen Walnüsse und Tannenzapfen, die bunten Kugeln, die Ketten, Sterne, Kerzen und das silberne Christkindleinshaar werden aufgehängt – die großen Brüder müssen auf der Trittleiter hinaufsteigen –, und zuletzt hängt die Mutter den rosigen Wachsengel auf, der ein weißes Seidenfähnchen in der Hand hält, auf dem in Goldbuchstaben geschrieben steht: „Friede auf Erden!“
Dann werden die Türen geschlossen, und keiner darf in den Saal. Drinnen werden Tische gerückt, wird geflüstert, raschelt Packpapier, Karlomchen rennt hin und her, große, in weiße Tücher gehüllte Geheimnisse schweben durch die Dämmerung. Die Kinder müssen sich warm anziehen und werden in die Schlitten verpackt. Aurel und Adda dürfen vorne mit dem Vater fahren, die Mutter – Karlin bringt noch schnell eine Wärmflasche für die Füße – und Fömarie folgen mit Marz; die großen Brüder kutschieren sich selbst. Karlomchen und Herr Ackermann bleiben zu Hause.
In der Kirche ist es eiskalt. Der Atem steigt wie Dampf aus den Mündern. Man muß mit den Füßen hin und her treten, damit die Zehen nicht erfrieren. Der Pastor steht in einem langen schwarzen Nachthemd zwischen zwei brennenden Weihnachtsbäumen – warum zieht er sich nicht wärmer an? Und dann poltert, quiekt und dudelt es hoch oben in der Luft – aber man kann den großen Leierkasten gar nicht sehen. Und alles fängt an zu singen. Wieder laufen die Eiskugeln über den Rücken, wieder steigt es heiß in die Augen auf, die Lichterbäume fangen an zu schwimmen, aber Aurel starrt immer auf das schwarze Nachthemd, es ist so breit und groß: vielleicht hat er darunter einen Pelz an? Dann schielt er zum Vater hinüber. Der sitzt so ernst und feierlich da, die rote Fuchsfellmütze in der Hand – nein, lachen wird er nicht.
Ein Mann mit einem langen Stock, an dem ein Schmetterlingsnetz hängt, geht von Reihe zu Reihe, und jeder wirft etwas hinein. Die Mutter drückt Aurel ein silbernes Zehnkopekenstück in die Hand, und er wirft es in den Beutel. Endlich kann man nach Hause fahren. Es ist schon dunkel, an jedem Schlitten brennt eine Laterne. Dickverschneite Tannenzweige tauchen im Lichtschein auf und verschwinden wieder in der Finsternis. Die Schellen klimpern.
Zu Hause gibt es heiße Schokolade mit Schmantschaum und gelbes, noch ganz feuchtwarmes Safranbrot mit Rosinen und Mandeln.
Dann werden die Kinder im Lesezimmer eingesperrt. Hier ist es ganz dunkel. Nur die Ritze unter der Tür wird immer heller, und als es zum dritten Mal klingelt, geht sie auf. Aber es blendet so, daß man zuerst gar nichts sehen kann. Endlich hat jeder seinen Tisch gefunden, benommen steht man davor, betastet die vielen Sachen, stopft sich etwas Süßes in den Mund und besieht sich mit scheinbarem Interesse auch die Geschenke der anderen, damit diese den eigenen Tisch bewundern.
Dann geht alles in den Großen Korridor hinauf, wo der Leutebaum brennt, die Mägde und Knechtskinder mit buntem Kattun, Wollsocken, Fausthandschuhen, Pfeffernüssen und Knallbonbons beschert werden. Indrik, der Gärtner, taktiert, ein schriller, klagender Gesang heult durch das Haus. Dann drängt sich alles zum Händeküssen, aber Aurel läuft schnell vorher hinunter.
Noch flackern die Wachskerzen, aber hier und dort ist eine schon heruntergebrannt, man muß den Stummel auspusten. Der Vater bläst mit dem Pfeifenrohr die Lichter oben an der Spitze aus. Manchmal knistert ein kleiner Ast, und es riecht dann so gut nach den angebrannten Nadeln. Immer dunkler werden die Schatten der Tannenzweige an den Wänden und oben an der Decke. Zuletzt brennt nur noch eine Kerze tief verborgen am Stamm – „das ist Schwesterchens Licht“, sagt die Mutter leise, „jetzt ist sie bei uns, und jetzt wollen wir an sie denken.“
Alle müssen schweigen, es ist so still, daß man das Flackern der unsichtbaren kleinen Flamme hört. Aurel blickt zur Decke hinauf, die schon fast ganz von schwarzen Astschatten verdunkelt ist, nur hier und dort schimmert ein schwacher Lichtschein durch. Es ist, als wüchse oben der Schattenbaum immer dichter und dunkler zusammen, als kämpfe das kleine Licht gegen die große Finsternis. Und dann erlischt es.
Karlomchen zündet die Lampe an.
Der Vater ist aufgestanden, klopft an das Barometer und sagt:
„Es klärt sich auf, morgen fahren wir auf die Hasenjagd!“
„Aber ich bitte dich“, sagt die Mutter, „morgen kommen doch die Koiküllschen Cousinen zu Mittag!“
„Um so besser“, meint der Vater schmunzelnd, „ich habe sie nicht eingeladen!“
„Aber ich mußte es doch tun“, seufzt die Mutter, „und dann hat man ein Jahr wieder Ruhe!“
Diese Koiküllschen Cousinen sind immer zu Weihnachten fällig, und wenn sie fort fahren, hat die Mutter Kopfschmerzen und muß sich ins Bett legen.
„Nein“, stöhnt sie dann und preßt ein Taschentuch mit Eau de Cologne an die Schläfe, „wenn man sich mit Ameli unterhält, dann denkt man: Adele ist doch klüger; und wenn man mit Adele spricht: Nein, Ameli ist doch klüger!“
„Sind beide so klug?“ fragt Aurel verwundert.
„Nein, klug sind sie nicht“, seufzt die Mutter.
Und wirklich: der Vater mit den großen Brüdern fährt auf die Jagd, und die Koiküllschen Cousinen kommen. Natürlich schon eine Stunde vor dem Mittagessen, aber es dauert lange, bis sie sich im Vorzimmer aus den Pelzpelerinen, den vielen Unterjacken, Schals, Seelenwärmern und Mantillen herauswickeln, die dicken Filzschuhe ausziehen, die hohen Frisuren zurechtmachen und die feuchten, erfrorenen roten Nasenspitzen abwischen. Aber die grauen Pulswärmer behalten sie an, trotzdem haben sie immer kalte und rauhe Hände. Aurel küßt sie ungern, und die großen Brüder küssen dann immer den eigenen Daumen.
„Bist du aber gewachsen“, sagt Ameli. Und Adele bückt sich und hält die Hand ganz tief über den Fußboden: „So klein warst du – da habe ich dich schon gesehen!“
Dann stehen beide vor dem Weihnachtsbaum, falten die Hände und machen einen schiefen Kopf.
„Nein, habt ihr einen wonnigen Baum“, sagt Ameli, „und was für einen wonnigen Engel!“
„Einen solchen Baum können wir uns nicht leisten“, seufzt Adele, „aber wir haben ja auch keine Kinder!“
Als man sich zu Tisch setzt, sagt die Mutter entschuldigend: „Onkel ist mit den Jungen auf der Jagd – da kann er sich leicht verspäten!“
„So, auch am Feiertag auf der Jagd?“ sagt Ameli spitz.
Adele schüttelt die Frisur:
„Und bei der Kälte mit den Kindern – ist das nicht der reine Leichtsinn?“
Nach dem Essen sitzt man im Saal. Karlomchen, Fömarie, Herr Ackermann – alle versuchen abwechselnd der Mutter beizustehen, aber die Unterhaltung kommt nicht in Gang.
„Ich fürchte, es wird schon dunkel“, sagt endlich die Mutter, „ihr habt einen weiten Weg!“
„Wir haben eine Laterne!“ sagt Ameli unerschüttert, „wir wollen doch Onkel begrüßen!“
Aber der Vater erscheint nicht. Er ist schon längst nach Hause gekommen – Aurel hat die Schlitten gehört –, und auch die großen Brüder haben sich verkrochen und kommen nicht herunter.
Endlich meldet die schwarze Tina: der Kutscher sei vorgefahren.
„Unser Kutscher?“ fragt Adele überrascht.
„Wahrscheinlich hat er die Pferde schon angespannt“, meint die Mutter, „und jetzt frieren sie!“
„Die armen Kinder, hoffentlich ist ihnen nichts zugestoßen“, seufzt Ameli besorgt. „Kann man denn auch im Dunkeln Hasen schießen?“
Als die Koiküllschen Cousinen fort sind, öffnet sich die Lesezimmertür. Der Vater steht schmunzelnd auf der Schwelle, die lange Pfeife in der Hand.
„Bist du denn schon zu Hause?“ fragt die Mutter verwundert. „Schade, jetzt sind sie fort!“
„Weil ich die Pferde anspannen ließ!“ lacht der Vater und schließt wieder die Tür.
Auch der Pastor kommt mit der Pastorin; er hat jetzt kein schwarzes Nachthemd an, und sie trägt ein blaues Samtkleid mit weißem Spitzenkragen. Aber dafür hat er eine schwarze Halsbinde, und manchmal gucken die Enden hinten am Nacken heraus. Seine Augen sind hinter der Brille tief in den Kopf gesunken, und niemals lacht er.
Ganz anders ist Doktor Martinell, mit der goldenen Kette über dem weißen Bauch. Immer tänzelt er, die langen Bratenrockschöße flattern um ihn herum, immer ist er begeistert, immer greift er beide Hände der Mutter und küßt alle beide. Und dann sagt er:
„Wie schön Sie wieder sind, zum Verlieben!“
„Doktorchen, warum heiraten Sie nicht?“ lacht die Mutter.
„Weil Sie schon verheiratet sind!“ sagt der Doktor und spreizt die Hand auf seinem weißen Bauch.
„Gibt es denn sonst niemand?“ fragt die Mutter.
„Niemand!“ seufzt der Doktor.
Und dann kommt immer zu Weihnachten der alte Mojahnsche mit Tante Melanie. Der alte Mojahnsche hat einen Stock mit weißem Elfenbeingriff und einem Gummiende, auf den er sich stützt, weil er ein steifes Bein hat. Außerdem hat er dicke Haarbüschel in den Ohren und Nasenlöchern, und wenn er von draußen kommt, hängt ein Tropfen dran. Immer poltert er, immer ist er unzufrieden.
„Diese Petersburger Affen“, sagte er, „jetzt wollen sie sogar ihre russische Zeit bei uns einführen!“
Aurel versteht das nicht: russische Zeit? Haben die Russen nicht nur eine eigene Sprache – auch eine eigene Zeit? Uhren, die ganz anders gehen? Und eine Sonne, die anders läuft?
Aber die große englische Standuhr im Saal läuft nicht, und wenn Aurel der blanken Perpendikelscheibe einen Schubs gibt, schwingt sie ein wenig, bleibt aber gleich wieder stehen. Die Zeit steht still. Das Jahr dreht sich langsam in der Runde, aber der Zeiger rückt nicht vorwärts. Die vielen Weihnachten fließen zu einem Weihnachten, die vielen Sommer zu einem Sommer zusammen. Das Leben ist ein großes kreisendes Jahr, ohne Anfang und ohne Ende.
Und in jedem Jahr wächst Aurel ein Stückchen, aber das ist so wenig, daß er es gar nicht merken würde, wenn er sich nicht an jedem ersten Januar mit den Brüdern am Türpfosten im Spielzimmer aufstellen müßte. Ganz gerade muß er stehen, auf Socken, der Vater hält ein Lineal oben auf den Kopf und schneidet mit dem Messer eine Ritze ins Holz. Zuletzt wird auch Adda gemessen. Sie stellt sich auf die Fußspitzen und reckt die Nase. Aber sie bleibt doch die Kleinste.
Aurel sitzt wieder oft an den langen Winterabenden oben in „Afrika“, bei Herrn Ackermann. Er zeichnet viele Weihnachtsbäume, mit Kerzen und Kugeln, und Herr Ackermann spielt ihm auf der Mundharmonika vor, die Schlunski ihm geschenkt hat. Aber dann muß er wieder husten, es ist ein hartes, bellendes Husten, der ganze Körper wirft sich hin und her. Karlomchen bringt heißen Himbeertee, er soll sich ins Bett legen.
„Unsinn“, sagt Herr Ackermann, „wenn jetzt die Sonne wieder scheint, bin ich gesund!“
Das neue Jahr hat angefangen, die Sonne wächst, und auch Aurel ist wieder ein kleines Stück gewachsen. Aber noch ist es Winter, und dann kommt eine Nacht, die kein Ende hat, eine dunkle Ewigkeit, in der er wach liegt, aber es ist kein richtiges Wachsein, es ist wie ein Schlafen mit offenen Augen.
Da wandert wieder ein blaues Licht, ein Schattenbuckel unruhig an den Wänden; Karlomchens Gesicht, vom Schein der Öllampe beleuchtet, taucht auf und verschwindet; die Mutter beugt sich über ihn, er sieht sie nicht, aber er fühlt ihre Nähe, ihre kühle Hand, die auf der brennenden Stirn liegt und die so wohltut. Aber alles ist wie hinter einem Schleier, alles ist entrückt, und auch die Stimmen und Geräusche sind gedämpft, wie hinter moosgepolsterten Doppelfenstern. Immer flüstert, immer schlurft etwas, immer knackt eine Klinke, knarrt irgendwo eine Tür.
Dann hebt sich plötzlich das Gitterbett und fängt langsam an zu fliegen: es schwankt und gleitet, schwebt durch die Tür, den Großen Korridor, die Treppe hinunter, schaukelt durch den Saal und landet in Mutters Schlafzimmer. Jetzt kann ich auch fliegen wie Karlomchen, denkt Aurel: Bin ich schon ein Engel? Aber warum ist alles so heiß und trotzdem so kalt? Es brennt im Rücken, im Hals, im Kopf, aber in dem Feuer sind kleine spitze Eisstücke, die stechen und prickeln; und für das Feuer sind die Decken viel zu dick und zu warm und für das Eis viel zu dünn und zu kalt. Jetzt fliegt Karlomchen mit der weißen Lampe zum Fenster hinaus und stellt die Lampe mit der runden Kuppel auf den Lebensbaum. Will sie auch im Garten Motten fangen? Aber die Lampe rutscht, rutscht langsam auf einen Ast, hängt in der Luft und klettert auf den nächsten Baum. Und Karlomchen ist wieder da. Gut, daß sie nicht fortgeflogen ist. Und auch die Mutter ist da, alles ist da, nur ich bin weit fort wie das Schwesterchen, als ihre Weihnachtskerze auslöschte …
Und die Nacht hat kein Ende. Es dämmert wohl, aber es wird nicht hell. Nur wenn die Tür aufgeht, fällt etwas Licht auf den Fußboden. Aber dann schließt sich die Tür gleich wieder.
Einmal öffnet sie sich, und Doktor Martinell hüpft über die Schwelle. Der Fenstervorhang schnurrt, es wird hell. Der Doktor beugt sich über das Bett, seine Goldkette klappert an den Gitterstäben. Aurels Hemd wird heruntergestreift, der Doktor klopft mit seinem kalten, harten Finger auf dem Rükken herum, dann preßt er eine schwarze Trompete an die Brust, und Aurel muß tief atmen. Was für einen speckigen roten Hals der Doktor hat, und was für komische gekräuselte Haarstoppeln! Und wie sonderbar er riecht. Dann muß Aurel den Mund auftun, Karlomchen hält ein Licht, und der Doktor drückt mit einem kleinen silbernen Löffel die Zunge herunter.
Als die Tür sich hinter dem Doktor schließt, wird alles wieder dunkel. Eine brennende Kälte, eine eisige Hitze schüttelt den Körper, und dann fängt das Feuer an zu jucken; rote kleine Punkte brechen auf der Haut hervor, winzige Maulwurfshümpel, der ganze Körper fühlt sich wie dicke Erbsensuppe an, wenn man mit dem Löffelrücken über die Kugeln rollt.
Es ist Scharlach. Bald liegt auch Adda in ihrem braunen Gitterbett neben Aurel. Der Saal wird abgesperrt, die großen Brüder dürfen nicht herunter. Fömarie gurgelt den ganzen Tag und wäscht sich mit Sublimat ab. Die Mutter schläft und wacht bei den Kindern, Karlomchen und die schwarze Tina helfen ihr bei der Pflege.
Einmal – Aurel wacht aus tiefer Bewußtlosigkeit auf – sieht er die Mutter zwischen den beiden Betten auf dem Fußboden knien, das Gesicht in die Hände vergraben. Er hört die Mutter flüstern, als spräche sie mit jemand, aber niemand ist im Zimmer, und er kann ihre Worte nicht verstehen. Dann sinkt er wieder in Schlaf.
Endlich lichtet sich das Dunkel. Gedämpfte Sonne fällt hinter einem Schirm ins Zimmer. Die roten Hümpel auf der Haut trocknen aus, blättern sich ab, es juckt noch ein wenig, aber das Feuer ist ausgebrannt, und die Eisstücke sind geschmolzen.
Aurel und Adda sitzen aufrecht im Bett, spielen mit den Puppen, mit Bauklötzchen, bauen Kaleschen. Karlomchen muß immer wieder die Geschichte vom „Großen und kleinen Klaus“, von „Plisch und Plum“ oder „Hans Hukkebein“ vorlesen, und die Mutter muß erzählen – von ihrer Mutter, und wie sie selbst noch klein war.
Nein, an ihre Mutter erinnert sie sich nicht: bald nach ihrer Geburt starb sie, mit neunundzwanzig Jahren; „und acht Kinder hatte sie: Tante Olla, Onkel Oscha, Onkel Nicolas, Tante Melanie, Tante Leocadie …“ Aber Aurel kann nie die vielen Tanten und Onkel behalten. Nur das weiß er: daß die Mutter die Jüngste war und daß sie selbst nie eine Mutter gehabt hat.
„Nie eine Mutter“, wiederholt er nachdenklich.
„Und wer hat dir dann die Haare gekämmt“, fragt Adda aus ihrem Bett, „und dich aufs rote Bänkchen gesetzt?“
„Hanninka“, sagt die Mutter, „Hanninka war unser Karlomchen!“
„Und alle Tanten und Onkel gehören dir“, fragt Aurel ganz betroffen, „und Papa ist ganz ohne?“
„Papa hat nur einen Bruder“, sagt die Mutter, „das ist Onkel Henry, und der ist in Amerika.“
„Ist Amerika weit?“
„Sehr weit, hinter einem großen Meer.“
„Und kommt er nie mehr zurück?“
„Das weiß ich nicht“, sagt die Mutter.
Dieser Onkel ist geheimnisvoll. Er ist noch rätselhafter als der Vater. Er ist so unsichtbar wie der liebe Gott. Ob er auch lange Pfeifen raucht und Hasen schießt? Und warum ist er in Amerika? Und wie ist er hingefahren? Auf einem großen Schiff? Der unsichtbare Onkel Henry, von dem man nur weiß, daß er in Amerika ist, schlägt für einige Zeit alle anderen Onkel und Tanten aus dem Felde.
Einmal steht der Vater in der Tür, auf der Schwelle, aber ins Zimmer kommt er nicht.
„Faulpelze!“ sagt er und droht mit dem Finger. „Immer noch im Bett!“ Dann schließt sich die Tür.
Bald können Aurel und Adda aufstehen. Die Beine taumeln ein wenig, in den Knien ist so ein komisches Gefühl, und der Fußboden schaukelt. Das Zimmer ist plötzlich so klein geworden, die Betten und Stühle, ja sogar die Mutter und Karlomchen sind zusammengeschrumpft; alles ist ein Stück in die Erde hineingesunken. Oder ist man selbst mit einem Ruck höher hinaufgewachsen? Die Arme und Beine sind jedenfalls viel länger geworden. Sie sind so lang, daß man gar nicht weiß, wo man sie hinlegen soll.
Und der Kopf ist für den Hals viel zu schwer geworden: er neigt sich nach rechts, nach links – wenn er nur nicht von den Schultern herunterrollt. Am besten, man kriecht wieder ins Bett. Karlomchen bringt kühles Apfelmus, und mit einem feinen säuerlichen Geschmack im Munde schläft man wieder ein.
Fast jeden Tag kommt Doktor Martinell. Einmal fragt er:
„Und wie ist der Stuhlgang?“
Aurel sieht ihn verwundert an: Stuhlgang? Kann denn ein Stuhl gehen?
Karlomchen übersetzt den medizinischen Ausdruck in die Kindersprache. Als der Doktor gegangen ist, wiederholen Aurel und Adda immer wieder dieses komische Wort. Nach dem Abendgebet muß Adda plötzlich kichern. Aurel weiß ganz genau, was sie denkt. Dann flüstern beide so leise, daß Karlomchen es nicht hören kann: „Stuhlgang!“ und sind sehr glücklich über dieses neue und seltsame Wort.
Und dann, an einem hellen Märzmorgen – der ganze Saal ist voll Sonnengeflimmer, gesprenkelter Oleanderschatten und Hyazinthenduft –, wandern beide Kinder ins Badezimmer, das neben der Backstube liegt. Hier werden sie in einem gewaltigen Holzbottich mit grüner Seife abgewaschen, und damit ist der Scharlach beendet. Die Kerze unter dem dunklen Weihnachtsbaum hat diesmal gesiegt: die schwarzen Schatten sind fortgezogen.
Aber ein flackerndes Licht nahmen sie mit.
Es war noch ganz früh, als Aurel, in seine Decke dick eingepackt, von Janz die Treppe hinuntergetragen wurde. Im Flur stand Herr Ackermann, in Vaters schwarzem Bärenpelz sah er so jämmerlich aus, als hätte ihn der Bär verschluckt. Unter der schwarzen Karakulmütze war sein Gesicht weiß wie ein Handtuch. Er hustete, und in der Hand hielt er ein Näpfchen, über das er sich dann beugte.
„Ich fahre dorthin, wo die Sonne noch wärmer ist“, sagte er keuchend und strich über Aurels Scheitel, „aber deine Sonne nehme ich mit!“
Vom Spielzimmerfenster sah dann Aurel, wie die Kibitke um den Platz fuhr. Der alte Marz kutschierte, und Doktor Martinell, der Herrn Ackermann bis zur Stadt begleitete, beugte sich winkend heraus.
Die Schellen läuteten, die Kufen knirschten auf dem gefrorenen Schnee, der nackte Ahorn schimmerte rosig in der Morgensonne.
Dann bog der schwarze Schlittenkasten in die kahle Allee und verschwand schwankend zwischen den dunklen Bäumen.