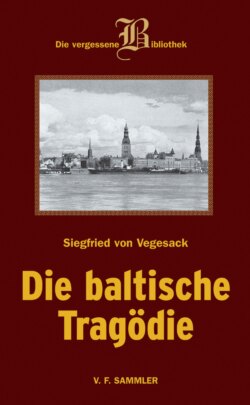Читать книгу Die baltische Tragödie - Siegfried von Vegesack - Страница 16
Altschwanensee
ОглавлениеWie von selbst war alles gekommen. War Aurel froh? War er traurig? Er wußte es nicht. Vielleicht war er beides zugleich: froh, daß er hier bei Tante Madeleine, bei Boris, bei den vielen Cousinen bleiben durfte, und traurig, sehr traurig, daß er nicht mitfahren konnte, als die große Kalesche mit der Mutter, dem Vater, mit Adda, den Brüdern und mit Marz wieder fortfuhr. Aber hierbleiben und mitfahren – beides zugleich kann man nicht. Man muß sich entscheiden. Und er selbst hatte sich entschieden.
An einem Morgen war die Mutter mit ihm in den Park gegangen, hatte sich bei der großen Eiche auf die Bank gesetzt und ihn gefragt:
„Willst du hierbleiben, bei Boris?“
Natürlich wollte er hierbleiben, bei Boris, seinem ersten richtigen Freunde, mit dem er ganz anders spielen konnte als mit Adda, die ja nur ein Mädchen und für ihn viel zu klein war. Vom ersten Augenblick an, als sich die beiden Jungen sahen, war diese Freundschaft dagewesen – von Aurels Seite wohl noch leidenschaftlicher, schwärmerischer, aber auch Boris war glücklich, endlich einen Bruder zu haben. „Weißt du, Mädchen sind nichts“, hatte er ihm gleich am ersten Tag anvertraut. „Und große Brüder sind auch nichts“, hatte Aurel ihm seine Erfahrungen mitgeteilt.
Jetzt waren Bal und Rei außerdem noch konfirmiert und trugen lange Hosen – sie waren also eigentlich schon erwachsen. Nein, der Abschied von den großen Brüdern fiel ihm nicht schwer. Aber die Mutter, der Vater, Adda? Und Karlomchen?
„Soll ich gar nicht mehr nach Blumbergshof kommen?“ hatte Aurel gefragt.
„Natürlich bist du in den Ferien immer bei uns“, versicherte die Mutter und zog seinen Kopf an ihre Schulter, „aber jetzt mußt du doch richtig lernen, und Herr Tiedebök und Fömarie haben zu wenig Zeit für dich. Ich glaube, hier mit Boris zusammen wirst du es besser haben!“
Ja, das sah Aurel ein. Und wenn er in den Ferien nach Hause konnte, war die Trennung ja nicht so lang und der Abschied nicht so schlimm. Trotzdem mußte er sich fest in die Finger kneifen und die Zähne zusammenpressen, als die große Kalesche davonfuhr, und die winkenden weißen Taschentücher sah er nur wie hinter einem flimmernden Schleier. Nun war er ganz allein hier. Zum ersten Male war er von der Mutter, dem Vater, von den Geschwistern, von Blumbergshof getrennt – denn die große Kalesche mit Marz war ja auch ein Stück Blumbergshof. Nun war das alles fort. Nur eine kleine Staubwolke stand noch in der Allee. Und dann war auch die verschwunden.
Aber Tante Madeleine beugte sich zu ihm und küßte ihn auf die Stirn: „Jetzt bin ich deine Mama“, sagte sie, „und du bist mein zweiter Sohn!“ Dann lief er mit Boris in den Park zum kleinen Bach, wo sie eine Brücke bauten.
Wie anders war hier alles als in Blumbergshof: keine bunten Dielenläufer, kein weißer Bretterboden – überall blankes, glattes Parkett, weiche, dikke Teppiche. Und die vielen Zimmer hatten gar kein Ende: der Blaue Salon, das Musikzimmer, der „Petitsalon“, der „Grandsalon“, das Rauchzimmer, das Lesezimmer, die Bibliothek, Onkel Nicolas’ Schreibzimmer – alle diese Räume lagen in einer langen Reihe hintereinander, alle Flügeltüren waren immer offen, so daß man zwischen den vielen zur Seite gerafften Portieren von einem Ende bis ans andere durchsehen konnte. Und rechts vom Musikzimmer kam man in den richtigen Saal und von dort in das endlose Speisezimmer. Vom Flur mit den unzähligen Garderobenständern, den Truhen, Spiegeln und Elchgeweihen schwang sich eine breit ausladende Treppe zum ersten Stock hinauf, wo die Korridore und Schlafzimmer überhaupt kein Ende nahmen. Und vor dem Flur, in einem besonderen Anbau, war der Wintergarten mit Palmen, mächtigen Blattpflanzen und rätselhaften Gewächsen. Hier war es immer feucht und warm, und ein kleiner Springbrunnen plätscherte.
Aurel schlief zusammen mit Boris in einem großen Zimmer im ersten Stock, und nebenan sollte der Hauslehrer wohnen, aber der war noch nicht da. Dafür gab es eine Gouvernante, Fräulein Kleeberg, mit einer braunen Warze auf dem Kinn, eine Mademoiselle und Miß Mabel, bei denen man Französisch und Englisch lerne sollte. Und dann war da Lim, die wie Karlomchen beständig umherlief, mit glattem, spärlichem Haar über dem länglichen, immer sorgenvollen Pferdegesicht. Und endlich die drei Cousinen: Isa, Maurissa und Warinka. Alle drei waren älter als Aurel – Warinka allerdings nur um ein Jahr –, und alle drei waren am Anfang etwas unheimlich: sie lachten, wenn man gar nicht wußte warum, sprachen plötzlich französisch oder englisch, rümpften die Nasen und sagten so von oben herab: „Das versteht ihr doch nicht!“
Ja, Boris hatte recht: Mädchen sind nichts, und doch mußte Aurel immer wieder zu ihnen hinüberschauen, wenn sie bei Tisch saßen. Isa trug schon aufgestecktes Haar, Maurissa und Warinka dicke lange Zöpfe mit Ponyschnitt in der Stirn. Welches Glück, daß man kein Mädchen war, mit Zöpfen und Röcken! Und daß man jetzt einen Freund hatte, einen Kameraden, mit dem man alles teilen, alles besprechen konnte.
Gleich am ersten Abend, nach der Abfahrt der Eltern – Tante Madeleine hatte mit den Jungen gebetet, das Licht gelöscht, nun lagen beide allein im Dunkeln – flüsterte Boris: „Wenn wir wirklich Freunde sind, dürfen wir keine Geheimnisse voreinander haben!“
„Ja, keine Geheimnisse!“ bestätigte Aurel eifrig.
„Aber ich habe ein Geheimnis“, fuhr Boris fort, „und das muß ich dir jetzt sagen. Aber du darfst es niemanden verraten!“
„Niemandem!“ beteuerte Aurel feierlich.
Boris war ans Fußende heruntergerutscht – die beiden Betten standen hintereinander an der Wand –, jetzt beugte er sich über Aurels Kopfkissen: „Dann mußt du es schwören!“
Aurel hockte sich hin und hob die Hand: „Ich schwöre!“
Boris rückte noch näher an sein Ohr und flüsterte:
„Ich weiß eine Höhle, die niemand weiß, auf der Insel, und dort habe ich etwas versteckt. Morgen zeige ich es Dir.“
„Eine Höhle?“ Aurels Herz klopfte.
„Ja, eine richtige Höhle!“ versicherte Boris. „Und du – hast du kein Geheimnis?“
Aurel grübelte lange angestrengt: nein, er kannte keine Höhle, und das Tschulanchen und der Heuboden waren eigentlich keine Geheimnisse. Ein richtiges Geheimnis ist nur das, was niemand weiß. Wie schrecklich, daß er keins hatte. Er schämte sich sehr. Aber da fiel ihm ein, daß er einmal in Blumbergshof unter der Gartenveranda heimlich einen toten Maulwurf begraben hatte. Dies Geheimnis konnte sich zwar nicht mit der Höhle messen, aber ein besseres wußte er nicht. Und so vertraute er Boris den toten Maulwurf an. Und auch Boris schwor, ihn niemandem zu verraten.
Am nächsten Morgen liefen die Jungen zum See, der gleich hinter dem Park lag, ketteten das kleine grüne Boot vom Steg los und ruderten zur Waldinsel hinüber, die sich mitten auf dem spiegelblanken Wasser dunkel und geheimnisvoll erhob.
Boris ruderte. Aurel saß hinten am Steuer. Noch nie war er so auf dem Wasser gefahren, es war ihm etwas unheimlich zumute, aber er ließ sich nichts anmerken. Wie tief wohl der See war? Jedenfalls viel tiefer als der kleine Teich in Blumbergshof. Und wenn man umkippte, dann mußte man wohl ertrinken. Das Boot schaukelte, das Wasser schlug gluckernd an die bauchige Holzwand; dann und wann spritzte es vom auftauchenden Ruder. Endlich stieß der Kiel zwischen rauschendem Schilf an das moorige Ufer. Boris schlich sich, immer nach allen Seiten spähend, durch Laubgestrüpp zur Anhöhe hinauf, auf der ein paar Fichten und Birken standen. Etwas abseits erhob sich ein verwitterter Eichenrumpf, der wohl einmal vom Blitz getroffen war. Als Boris festgestellt hatte, daß niemand ihn sehen konnte, schwang er sich an einem Aststumpf hinauf und hockte sich oben hin, wo sich der Eichenstamm gabelte. Dann mußte Aurel nachklettern. Ja, von hier oben konnte man tief in den hohlen Baum hineinblicken – es war eine richtige Höhle. Boris glitt hinein, und auch für Aurel war noch genügend Platz darin.
„Hier kann uns niemand entdecken“, flüsterte Boris, als lauschten und lauerten überall unsichtbare Feinde.
„Aber wie soll denn jemand herkommen, ohne Boot?“ fragte Aurel verwundert.
„Die Indianer können doch schwimmen“, versicherte Boris und spähte unruhig durch eine Spalte über den See. Aber nirgends war etwas Verdächtiges zu entdecken. „Und dies ist mein Speer“, fuhr er fort und griff nach einer langen, geraden, vorn zugespitzten Erbsenstange, „und du mußt heute auch einen bekommen!“
„Und was machen wir mit dem Speer?“ fragte Aurel benommen.
„Wir kämpfen“, erklärte Boris.
„Gegen wen?“
„Gegen den Feind!“
„Und wer ist der Feind?“
„Das wirst du schon sehen!“
Boris nahm den Speer, und beide kletterten wieder aus der Höhle heraus. Und als Aurel vom Gärtner auch eine solche Waffe erhalten hatte, begaben sich die Jungen auf den Kriegspfad. Lange schlichen sie hinter dem Stall, beim Teich, an der Gartenmauer herum, aber nirgends war ein Feind zu entdecken. Da plötzlich stürzte Boris mit wildem Geschrei, den Speer schwingend, in einen Cyrenenbusch, und gleich darauf schoß ein rostbrauner Hahn mit gesträubten, zerzausten Federn schrill krächzend über den Rasen. Das war eine aufregende, grausame Jagd. Manchmal setzte sich sogar der gereizte Gockel mit aufgeplusterten Flügeln zur Wehr. Nur dieser abgehetzte, cholerische, wütende Hahn war der Feind – die anderen Hähne und Hühner wurden niemals gejagt.
Und dann gab es noch ein paar Bauernjungen, mit denen Krieg geführt wurde. Sie waren in großer Überzahl, auch sicher stärker, trotzdem ergriffen sie nach kurzem Kampf immer die Flucht: sie wagten es nicht, die beiden „Jungherren“ richtig anzupacken. Selbst wenn Boris ihnen wütend befahl: „Ihr müßt ordentlich schlagen!“, knufften sie bloß widerwillig, nur aus Höflichkeit, und grinsten verlegen.
Auch hier war die Glaswand, die unübersteigbare Mauer, die beide Welten trennte. Ja, hier – das fühlte Aurel – war diese Mauer noch höher, noch dicker als zu Hause in Blumbergshof. Hier lag die eine Welt nicht neben, sondern tief unter der anderen. Gesindestube, Küche, alle Leuteräume befanden sich im Souterrain, nur durch eine Treppe mit der oberen Welt verbunden. Und die Speisen schnurrten sogar ganz allein in einem Aufzug aus der Küche direkt in den Speisesaal; der dicke, behäbige Karel oder der magere Jekab, die beiden Diener, brauchten nur von oben hinunterzurufen, an einer Schnur zu ziehen, und schon kam die dampfende Bratenschüssel heraufgerasselt.
Unten aber, in der unsichtbaren Tiefe, herrschte Koch Linde, lärmte, kreischte, schwatzte und rannte aufgeregt durcheinander ein ganzes Heer von Küchenmädchen, Hausmägden, Waschweibern, Plättfrauen und Näherinnen, und zum Essen kamen noch viele Leute vom Hof: Garten- und Kutscherjungen, der Viehpfleger, der Vorarbeiter, die Knechte – an zwei langen Tischen wurde gegessen. Nein, hier konnte man sich nicht dazusetzen wie in der Gesindestube in Blumbergshof, hier bekam man kein Stück Schwarzbrot mit Quark darauf – hier ging man fremd, wie ein Wesen anderer Art, an den vielen fremden Gesichtern vorbei, und der schlanke, dunkle Boris sah wie ein kleiner Prinz aus, wenn er die vielen untertänigen Grüße mit einem leichten Kopfnicken erwiderte oder mit einer kurzen Handbewegung irgendeinen Befehl aus der Oberwelt ausrichtete.
Und Aurel gehörte zu seinem Freund, zu Boris, zur hellen, unbeschwerten, immer heiteren Welt da oben, die durch einen dünnen, aber undurchsichtigen Parkettboden von der Unterwelt getrennt war.
Hier oben war es immer, als schiene die Sonne, selbst wenn es draußen regnete: so weiß waren die Fenstergardinen, so hell blitzten die Kristalle der Kronleuchter, die silbernen Scheiben der Wandspiegel, so blank schimmerte das immer frisch gebohnerte Parkett. Und auch am Abend war die endlose Flucht der Räume in helles, warmes Licht gebadet: überall leuchteten die weißen Kuppeln der Petroleumlampen, flackerten Kerzen, warfen die Spiegel einander die vielen Lichter zu, so daß alle Dunkelheit der frühen Herbstnächte machtlos draußen blieb hinter den Fenstervorhängen.
Aber das wunderbarste war, daß diese helle, warme Welt hier oben von einer immerwährenden Musik erfüllt war: Tante Madeleine brauchte gar nicht auf dem Flügel zu spielen und zu singen, auch wenn sie schwieg, fühlte Aurel diese stumme Musik: in Tante Madeleines Gang, in der raschen Bewegung ihrer lebendigen Hände, im Vorbeifliegen und Lachen der Cousinen, in der etwas zur Seite geneigten Haltung von Boris, ja sogar in der belegten Stimme, im festen, elastischen Schritt von Onkel Nicolas.
Wie plump, wie ungeschickt kam Aurel sich selbst vor; immer fiel es ihm schwer, nach dem Gutenachtsagen allein quer durch den großen Saal und die vielen Zimmer zu gehen: er fühlte, wie die Blicke sich ihm auf den Rücken hefteten, wie die Cousinen sich über sein eckiges, ruckweises Gehen lustig machten – und dadurch wurde sein Gang noch befangener, noch ungelenker. Wenn er doch so werden könnte wie Boris – aber dazu war er wohl zu schwerfällig, zu unbeholfen.
Und wie war es erst, wenn Tante Madeleine sich an den Flügel setzte, die Ringe abstreifte und ihre lebendigen Hände auf den schwarzen und weißen Tasten hin- und herglitten. Manchmal sang sie sogar in einer fremden, überirdischen Sprache – ob das wohl die Himmelssprache war, von der die Mutter einmal erzählt hatte? Aber das tat sie selten, und jedesmal, wenn sie gesungen hatte, stand Onkel Nicolas von seinem Sessel auf, ging auf sie zu und küßte ihre Hand. Er hob dabei ihren Arm hoch hinauf und neigte nur ein wenig den Kopf.
Tante Madeleine war einmal – das erfuhr Aurel – eine berühmte Sängerin gewesen, sie hatte in Mailand, Paris und London gesungen, auf Onkel Nicolas’ Schreibtisch stand eine große Photographie von ihr, in einem seltsamen Kostüm mit weißer, hoher Frisur und komisch breitem Rock – aber dann hatte sie allen Ruhm, sogar ihre Muttersprache aufgegeben und Onkel Nicolas geheiratet. Denn sie war Italienerin, und singen konnte sie nur italienisch. Auch beim Sprechen kamen ihr manchmal merkwürdige Worte, die man aber doch gleich verstand, weil nicht nur ihr Mund, sondern auch ihre lebendigen Augen, ihr schmales, bewegtes Gesicht, die immer rasch durch die Luft hüpfenden Hände mitsprachen. So sagte Tante Madeleine, wenn zum Beispiel die Jungen an einem Regentag durchaus zur Insel rudern wollten:
„Maché, da werdet ihr ja ganz naß!“
Und wenn Boris dann erklärte, auf der Insel wäre es wirklich sehr trokken:
„Altroché – glaubst du, daß es auf der Insel nicht regnet?“
Oder wenn Jekab eine Tasse auf dem Parkett zerschmetterte, lachte Tante Madeleine:
„Das ist kein Granché.“
„Was ist ein Granché?“ fragte Aurel.
„Das ist eine große Sache“, erklärte Tante Madeleine.
„Und was ist eine große Sache?“ forschte Aurel.
„Eine große Sache?“ Tante Madeleine überlegte, dann sagte sie: „Zum Beispiel, wenn das Haus abbrennt oder jemand stirbt. Das ist ein Granché!“
Alles andere, sogar das Singen, war für Tante Madeleine kein Granché – jedenfalls machte sie keine große Sache daraus, auch wenn dem weißhaarigen Pastor Nötkens, der sie auf dem Flügel begleitete, zum Schluß die Tränen über die Backen kullerten.
Pastor Nötkens, ein mächtiger Mann mit schneeweißem Haar, dunklen Augenbrauen und glattrasiertem, rosigem Gesicht, kam jede Woche, spielte mit Onkel Nicolas Schach und musizierte am Abend mit Tante Madeleine. Wenn es spät wurde, mußten die Jungen ins Bett. Aber dann schlichen sie im Nachthemd heimlich die Treppe hinunter, versteckten sich im Flur hinter den Garderobeständern, den vielen Mänteln und Pelzen – ja einmal wagten sie sich sogar in den Blauen Salon und verkrochen sich unter dem Sofa.
Es war ein wenig hart und kalt, mit den nackten Füßen und dem dünnen Nachthemd auf dem blanken Parkett – aber der Gesang war so schön wie noch nie, und als er zu Ende war, wurde es ganz still, alles schwieg; nur Pastor Nötkens schneuzte sich, und dann knackte das Parkett: Onkel Nicolas ging zum Flügel. Gerade wie die Jungen wieder hinaufschleichen wollten, kamen Mademoiselle und Miß Mabel und setzten sich auf das Sofa. Sie sprachen französisch und englisch, man konnte sie nicht verstehen, und deshalb war das Hocken dort unter ihnen auf die Dauer langweilig. Außerdem wurde es immer kälter. Da fing Boris an, ganz leise zu knurren. Einen Augenblick verstummten die Stimmen auf dem Sofa. Dann knurrte er lauter und kitzelte mit dem Finger einen Knöchel.
„Mon Dieu – un chien!“ schrie Mademoiselle und sprang entsetzt auf.
Miß Mabel bückte sich, spähte unter das Sofa und brach in lautes Gelächter aus. Und dann waren mit einem Male lauter Beine, lauter lachende Gesichter da – die Cousinen, Tante Madeleine, Fräulein Kleeberg, Lim, sogar Onkel Nicolas und Pastor Nötkens – wie zwei aufgescheuchte Hasen sprangen die Jungen aus ihrem Versteck und rasten mit fliegenden Nachthemden die Treppe hinauf. Zum Glück war auch dies für Tante Madeleine kein „Granché“. Nur mußten die Jungen von jetzt an versprechen, wirklich schlafen zu gehen, und das taten sie auch. Aber dafür ließen sie die Türen offen, so daß sie den Gesang bis in ihre Betten hören konnten.
Und dann, an einem Abend, kam Herr Bjelinski, der Hauslehrer, ein Mann mit kohlschwarzen Augen und kohlschwarzen, krausen Barthaaren, die wie Fransen um sein bleiches, mageres Gesicht hingen. Er sagte zu Onkel Nicolas „Du“ – sie hatten zusammen in Dorpat studiert. Aber Tante Madeleine küßte er niemals die Hand. Und nie aß er Fleisch.
„Wie kann man Leichen essen“, sagte er und nahm einen Teller Buchweizengrütze.
„Auch Hühner sind eine Gabe Gottes“, meinte Pastor Nötkens, der die Serviette vor die Brust gesteckt hatte und mit Behagen an einem knusprigen Hühnerbein knabberte.
„Du sollst nicht töten!“ erwiderte Bjelinski finster.
„Ich töte kein Tier“, erklärte der Pastor und sog das Mark aus den Knochen.
„Aber Sie essen es“, entgegnete Herr Bjelinski mit Abscheu.
„Warum soll ich es nicht tun, wenn sonst ein anderer es täte?“ lachte der Pastor und wischte sich die fettigen Finger an der Serviette ab.
„Mit diesem bequemen Grundsatz ist alles erlaubt“, stieß Herr Bjelinski heftig hervor. „Warum soll ich nicht in den Krieg gehen und Menschen töten, wenn sonst ein anderer es täte?“
„Hühner und Menschen sind nicht dasselbe“, meinte der Pastor und griff nach dem Weinglas.
„Öfter als man glaubt“, versetzte Herr Bjelinski boshaft. „Es gibt nur eine Moral: du sollst dem Übel nicht widerstehen, du sollst …“
„Aber ich widerstehe ja gar nicht dem Übel!“ fiel ihm der Pastor lachend ins Wort. „Übrigens, dieser verrückte Tolstoi wäscht sich die Hände mit Eau de Cologne …“
„Bitte, nur nicht wieder Tolstoi!“ schnitt Tante Madeleine lächelnd die Diskussion ab und hob die Tafel auf.
Aber während des Unterrichts erzählte Herr Bjelinski viel von diesem merkwürdigen russischen Grafen, den er oft besucht hatte und der für ihn der einzige wahrhafte Christ war. Und was er sagte, machte tiefen Eindruck auf Aurel. Da war ein reicher, mächtiger Graf, viel reicher als der Vater, der all sein Land den Bauern geschenkt hatte und selbst wie ein Bauer lebte. Und wenn Herr Bjelinski von ihm erzählte, leuchteten seine kohlschwarzen Augen, und sein bleiches, vom dunklen Bart umkränztes Gesicht bekam einen elfenbeinernen Glanz.
Aber furchtbar waren seine Augen, als er einmal Boris und Aurel zu sich ins Zimmer rief.
„Was habt ihr getan?“ fragte er, und seine Stimme bebte.
„Den alten Gockel gejagt“, antwortete Boris.
„Und warum habt ihr das getan?“
Weil wir Krieg spielten“, sagte Boris unbekümmert.
„Ist das ein ritterlicher Kampf: ein armes, wehrloses Tier zu jagen?“ Die schwarzen Augen loderten so, daß die Jungen den Blick zu Boden schlagen mußten. Dann hörten sie eine tonlose, eindringliche Stimme:
„Ich strafe nie. Euer Gewissen wird euch selbst strafen. Denkt mit aller Kraft an die grausamen Qualen, die ihr dem unglücklichen Tier zugefügt habt, und betet zu Gott, daß er euch verzeiht!“
Der Gockel wurde nie mehr gejagt und die Speere nur noch selten aus der Eichenhöhle hervorgeholt. Dann legte sich eine dünne Eisdecke auf den See, und das Boot wanderte ins Bootshaus. Mit dem Indianerkrieg war es aus. Statt dessen zimmerten die Jungen unter Herrn Bjelinskis Anleitung mächtige bunte Drachen und ließen sie im Oktobersturm hoch in den Himmel steigen.
Die gelbroten Ahornblätter liegen dürr wie Papier in der kahlen Allee, an manchen Stellen hat der Wind sie zu hohen Haufen zusammengefegt. Auch die Bäume im Park stehen leer und nackt wie Skelette, so daß man vom Schulzimmerfenster bis zum Kapellenberg am See und unten am Bach bis zum Alten Haus durchblicken kann.
Aurel hebt manchmal den Kopf von der lateinischen Grammatik, die er nicht leiden kann, und auch Boris stöhnt leise vor sich hin, wenn sie ihre Aufgaben machen sollen, statt draußen zu spielen. Beide Jungen sitzen da, bohren die Ellbogen in den Tisch, den Kopf in die Fäuste, die Daumen in die Ohren, aber die Augen lassen sich nicht von der Deklination festhalten, sie wandern zuerst vorsichtig auf die Tischplatte, betrachten aufmerksam eine Rille, einen Tintenfleck, der beinahe wie ein Hundekopf aussieht, man müßte nur noch das eine Ohr verlängern – und schon tastet die Hand zum Federstiel, und als der Hundekopf fertig ist, fängt die Feder ganz von selbst an, auf dem Löschpapier einen gewöhnlichen Klecks in eine sonderbare Fratze zu verwandeln. Und dann ist da ein Radiergummi, den man unbedingt befühlen und beriechen muß, ein abgebrochenes winziges Kreidestück, das so angenehm kühl ist, wenn man sich damit die Finger einreibt, und der Korken vom Tintenfaß, von dem man sicher noch einen Brocken mit dem Nagel abknibbern kann. Alles Dinge, die viel interessanter sind als die Ausnahmen der zweiten oder dritten Konjugation.
Wenn aber die Augen erst bis zum Fenster gewandert sind, dann kehren sie nicht so bald zurück, und auch wenn Herr Bjelinski die Vorhänge schließt und die Petroleumlampe anzündet, treiben sich die Augen noch lange draußen hinter den Fensterscheiben herum: am See, auf der Insel, auf dem Kapellenberg, im Alten Haus bei Großtante Ernestine.
Jeden Sonntag nachmittag machen Aurel und Boris einen Besuch im Alten Haus. Dann wäscht Lim ihre Hände mit heißem Wasser ab, Fräulein Kleeberg feuchtet die Haare an, zieht einen Scheitel und striegelt sie so lange, bis man die beiden Jungen kaum wiedererkennen kann.
Bei Großtante Ernestine und Tante Leocadie gibt es immer Schokolade mit Schmantschaum und frische Apfelkuchen. Aber auch sonst gefällt es Aurel dort sehr gut: die weiß gescheuerten Fußböden, die bunten Dielenläufer, die Strohblumen auf den Moospolstern zwischen den Doppelfenstern – alles erinnert ein wenig an Blumbergshof. Großtante Ernestine sitzt immer im Rollstuhl am Fenster, ein dickes kariertes Plaid auf den Knien, eine schwarze Spitzenhaube über dem rosigen Gesicht mit den lebhaften, strahlenden Augen. Sie ist schon über neunzig, bald hundert Jahre alt, und wenn Aurel ihre durchsichtige weiße Hand küßt, wagt er sie kaum anzufassen, aus Furcht, sie könnte vielleicht zerbrechen.
„Also du bist Jennys Jüngster“, sagte sie ihm das erste Mal, „und deine Mama war Isabels Jüngste und war noch viel kleiner als du, wie sie mit Tante Leocadie zu mir kam, weil Großmama starb! Also eigentlich bin ich deine Großmama! Komm mal etwas näher und sieh mich an!“
Es war nicht leicht, dem forschenden Blick dieser brennenden Augen standzuhalten, die einem bis auf den Grund des Herzens sahen, aber Aurel öffnete sich ganz und ließ diesen prüfenden Blick tief in sich eindringen.
„Isabels Augen, wieder Isabels Augen“, sagte die Großtante Ernestine leise und sank in ihr Kissen zurück. Und als spräche sie zu sich selbst, fuhr sie nach einer Weile fort:
„Wie ist das wunderbar – dieselben Augen, die sich so jung für immer schlossen, kehren wieder auf die Erde zurück, als hätten sie nie genug vom Leben! Und da soll man nicht an Gott, an die Unsterblichkeit der Seele glauben – wenn schon die Augen unsterblich sind!“
Und dann erzählte Großtante Ernestine von der Großmutter, die so jung, bald nach der Geburt der Mutter, gestorben war und die so viele Kinder hinterlassen hatte: „Vier Jungen und drei Mädchen gingen mit Großpapa hinter dem Sarge her, zum Kapellenberg hinauf – deine Mama war ja noch zu klein, aber ich hielt sie am Fenster, als sie den Sarg hinaustrugen.“
Und auch vom Großvater erzählte sie, wie verzweifelt er gewesen war, wie er diesen Schmerz nie überwinden konnte. Er lebte nur noch in Erinnerungen, in Gedanken an seine tote Frau. Damals legte er den großen Park um den Kapellenberg an, ließ den ganzen See ausgraben – früher war das alles nur ein Moor gewesen –, und mit der ausgegrabenen Erde die drei Inseln aufschütten, jede in der Form eines Buchstabens: I S A, so daß der Name der Toten für alle Zeiten in den See geschrieben steht. Aber auch das genügte ihm nicht. An seinem fünfundzwanzigsten Hochzeitstag verließ er das Schloß und siedelte auf den Kapellenberg über, wo er neben der Kapelle in einer einfachen Kammer als Einsiedler hauste und bald darauf auch starb.
Aurel hörte aufmerksam zu. Dieser unglückliche Großvater beschäftigte ihn viel. Wenn er den ganzen See und die drei Inseln nur aus Kummer über den Tod von Großmama ausgraben ließ, dann mußte er wirklich sehr traurig gewesen sein. Und auch er hatte dann schließlich wie dieser merkwürdige russische Graf alles verlassen und war als Einsiedler auf dem Kapellenberg gestorben.
Wenn dann Großtante Ernestine vom Erzählen müde wurde, brachte Tante Leocadie, die immer lautlos durch die Zimmer ging oder noch lautloser dasaß und an einer Gabelschnur arbeitete, eine große Schachtel mit uralten hölzernen Spielsoldaten, die Aurel und Boris auf dem Fußboden aufstellten. Diese Soldaten hatte Großonkel Barclay de Tolly, als er Napoleon mit den Verbündeten gefangen hatte, aus Paris nach Hause gebracht. Es waren also ganz echte gefangene und eroberte französische Soldaten von Napoleon, bald hundert Jahre alt, mit denen man natürlich ganz anders spielen konnte als mit den gewöhnlichen aus Zinn, die bei Vierecke in Riga gekauft wurden.
Aber noch schöner war es, wenn Tante Leocadie ein längliches Holzkästchen auf den Tisch stellte, an einer Schraube drehte, und wenn dann eine dünne, seltsame Musik wie von lauter winzigen Silberglöckchen durch die Dämmerung summte. Es war immer dieselbe Melodie, eine zärtliche, schmerzliche und doch heitere Melodie, die einen gleichzeitig sehr traurig und auch sehr glücklich machte.
„Diese Spieldose“, erzählte Großtante Ernestine – jetzt in der Dämmerung konnte man nur ihre Stimme hören –, „hat deine Großmutter als Kind bekommen, und sie liebte sie so, daß sie sich nie von ihr trennte. Wenn ich sterbe, soll deine Mutter sie haben!“
Dann zündete Tante Leocadie die Petroleumlampe an, und die Jungen packten die Soldaten wieder in die Schachtel.
„Was wollt ihr eigentlich werden?“ fragte Großtante Ernestine beim Abschied, und wieder brannte ihr forschender Blick bis auf den Grund der Seele.
„Soldat!“ rief Boris.
„Und warum Soldat?“ fragten die Augen belustigt.
„Weil Krieg das schönste ist!“ erklärte Boris.
Die Augen wurden ernst und bekümmert, aber sie lächelten noch immer: „Ist das so schön – Menschen zu töten?“
Aber Boris ließ sich nicht abschrecken:
„Kämpfen ist schön“, meinte er, „und das kann man nur, wenn man Soldat ist!“
Da sagte die Großtante – ihre Stimme war leise, aber sie drang bis in das Innerste und blieb dort haften:
„Man kann auch ohne Waffen kämpfen – für Gott!“
Dann fragte sie Aurel, was er werden wolle.
„Ich will Musik machen“, sagte Aurel; und erst jetzt, als diese Augen ihn fragten, war er sich dessen bewußt geworden. Noch nie hatte er darüber nachgedacht.
„Musik“, wiederholte Großtante Ernestine, „das ist schön. Damit kannst du viele Menschen glücklich machen!“
Aber wie sollte er Musik machen? Nicht einmal auf der Weidenflöte und der Mundharmonika konnte er spielen! Und singen schon gar nicht. Während der Morgenandacht im Saal, wenn alle aus dem Gesangbuch den Choral sangen, brummte er nur leise mit. Und auch das tat er nur, wenn niemand es hörte. Als er einmal mit Warinka in ein Gesangbuch sehen mußte, bewegte er nur die Lippen.
„Aber du singst ja gar nicht mit!“ hatte sie ihn nachher geneckt. „Warum bewegst du dann den Mund?“
Seitdem hielt er auch die Lippen geschlossen.
Wenn man so singen und so spielen könnte wie Tante Madeleine! Oder wenigstens wie die Spieldose! Manchmal, wenn Aurel allein war, hörte er eine Musik. Aber er hörte sie nur ganz tief in sich drinnen, wie ein feines Summen, und wie sollte er dieses Summen aus sich herausholen, so daß auch andere es hören konnten?
Als die Jungen ins Große Haus heimkehrten, brannten Lichter in allen Fenstern. Und als sie die Steinstufen hinaufstiegen und aus der Kälte und Dunkelheit in den Flur traten, schlugen ihnen wohlige Wärme und blendende Helligkeit entgegen.
Und durch die offenen Flügeltüren tönten Musik und Gesang.