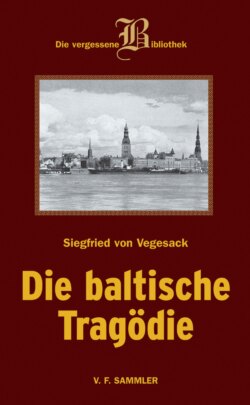Читать книгу Die baltische Tragödie - Siegfried von Vegesack - Страница 14
Der Wasserkringel
ОглавлениеIn den Gräben gluckert es, die Weidenkätzchen sind schon ganz silbern, im Kleinen Walde blühen bläuliche Anemonen und weiße Sternblumen; und Fömarie legt ihre Pelzpelerine in die Mottenkiste.
Dann klappert es auf dem Storchnest, Schwalben zucken durch die Luft – und mit einem Mal ist es Sommer. Immer wieder muß Janz die Trittleiter holen und mit einem Besen die Schwalbennester in der Veranda herunterkratzen. Das ist ein furchtbarer Anblick, aber die weißen Spritzer auf dem Ecksofa kann man nicht dulden. Die Mutter seufzt. Der Vater lacht: „Die Biester können doch auch woanders ihren Dreck machen!“
Einmal am Abend sitzt Janz auf dem runden Mühlstein, der als Tisch vor Mutters Lieblingsbank steht, bei der roten Klete. Seine nackten Füße baumeln in der Luft, er schnitzt mit seinem krummen Gartenmesser runde Löcher in einen Weidenast, und Aurel sieht ihm gespannt zu.
Es ist ein fingerdickes, ganz gerades Aststück mit graugrüner Rinde.
Janz legte es auf den Mühlstein zwischen seine Beine und beklopfte es mit dem schweren Messergriff.
„Warum tust du das?“ fragt Aurel.
„Damit sich die Rinde löst“, sagt Janz und lacht, „wie soll ich sonst eine Flöte machen?“
Und wirklich: langsam löst sich das weiße glatte Holz, kriecht ein Stückchen aus der Rinde hervor – Janz klopft und klopft –, und dann zieht er das ganze nackte Aststück aus der grünen Röhre.
„Man muß nur lange klopfen“, sagt er, „sonst geht die Rinde kaputt!“ Dann schnitzt er ein Mundstück, setzt am anderen Ende einen Holzpfropfen hinein – und die Flöte ist fertig. Sie klingt ein wenig schrill, und sie hat eigentlich nur zwei Töne, aber man kann auf ihr blasen, und Aurel ist sehr glücklich.
Und glücklich ist er überall, am Teich, wenn er mit dem grünen Wasserschöpfer Feuersalamander fängt und wieder losläßt, wenn er im Treppenhaus auf dem glatten Geländer herunterrutscht, im „Tschulanchen“ herumstöbert oder auf dem Spielplatz im Garten aus Lehm und Steinen ein richtiges Haus baut. Den Lehm gräbt er sich selbst aus der Erde, und die Steine schleppt er mit Adda in einer „Tatschke“, einem Schubkarren, vom Grandhaufen hin. Der Lehm wird in einer Holzkiste richtig mit Wasser verrührt, bis er ganz klebrig ist, und dann wird er mit den Händen zwischen die Steine geknetet.
Auf dem Spielplatz steht auch eine alte Schaukelbank, und wenn Fömarie darauf sitzt und liest und man ordentlich wippt, kann man sie schön prellen. Und dann ist da ein uralter Apfelbaum, der nicht nach oben, sondern auf die Seite gewachsen ist, über den Weg hinüber in ein dichtes Cyrenengestrüpp. Auf diesem Apfelbaum kann man weit herumklettern, bis zum vermoosten Bretterzaun und auf dem Zaun bis zur schwarzen Klete. Hier, ganz versteckt in der Ecke, wuchern wilde Himbeeren und mächtige Kletten, so daß man die Beeren gleich auf den breiten Klettenblättern sammeln kann. Aber Fömarie bekommt nur die mit den Würmern. Wenn sie dann einen entdeckt, läßt sie alle stehen, und man ißt sie selbst. Aurel hat einmal sogar einen Wurm heruntergeschluckt, nur um Fömarie zu ärgern.
„Mein Gott“, schreit Fömarie, „jetzt hast du Würmer im Magen!“
„Janit ißt sogar Regenwürmer“, erzählt Aurel unbekümmert. „Er hält den Regenwurm in den Händen und zieht ihn so lange, bis er in der Mitte zerreißt. Dann schluckt er beide Stücke herunter!“
Fömarie schreit, wendet den Kopf und hält sich die Ohren zu. Und dann kann man ihr von hinten vorsichtig ein paar Kletten in die Frisur stopfen.
Hinter der Schaukelbank, von dichten Haselnußstauden halb versteckt, steht das alte Magazin, ein gelber Lehmbau mit schwarzen Fensterlöchern. Manchmal halten dort Bauernfuhren, Kornsäcke werden aufgeladen, man hört Pferde stampfen und prusten, den Verwalter schimpfen. Aber das alles hört und sieht man nur durch den Bretterzaun, wie hinter einem Gitter, und wenn ein zerlumptes Knechtskind dort vorbeigeht, neugierig stehenbleibt und zwischen den Latten hereinschaut, dann starren sich die Kinderaugen fremd und verwundert an. Hier ist keine Pforte, und kein Weg führt aus der einen Welt in die andere.
Und neben der schwarzen Klete ist auch ein Zaun, und dahinter stehen zwei Schafe: ein schwarzes und ein weißes. Das schwarze gehört Aurel und hat ein blaues Halsband, und das weiße mit dem roten Band gehört Adda. Wenn die Kinder in den Kleinen Wald spazierengehen, trappeln die Schafe blökend hinter ihnen her. Aber in den Garten dürfen sie nicht. Dafür raufen Aurel und Adda fettes blaues Gras und roten Klee am Grabenrande und streuen es in die Krippe.
Das weiße Schaf senkt manchmal den Kopf und macht einen Luftsprung. Es bekommt schon kleine Knollen zwischen den Ohren. Einmal stieß es sogar Adda um. Jetzt führt Aurel das weiße an der Leine und versucht, auf ihm zu reiten: der breite wollige Rücken schaukelt hin und her, aber dann macht das Schaf einen Hops, und Aurel rutscht herunter.
Die Sonne brütet auf dem sandigen Spielplatz. Das Lehmhaus ist bald fertig. Aurel klopft mit einem Holzbrett die Mauer glatt, schmiert noch etwas klintschigen Lehm an die Ecke. Adda hat schon die Puppe Franz in das Haus gesetzt, aber vorläufig sind noch keine Möbel drin, und so muß Franz auf dem Erdboden sitzen. Denn Bretter gibt es auch noch nicht, keine Fensterscheiben, keine Vorhänge, kein Dach.
„Ich glaube, es zieht“, sagt Adda besorgt und nimmt Franz wieder heraus.
Auf dem vergrasten, von Sonnenflecken und Blätterschatten gesprenkelten Weg kommt die Mutter. Sie geht langsam, ihre Schultern sind ein wenig vorgeneigt, und ihr schmales Gesicht, das jetzt in den grellen Lichtkreis des Spielplatzes tritt, ist nachdenklich und so merkwürdig ernst. Die Mutter kommt selten hierher, sie hat das Lehmhaus noch gar nicht gesehen. Aurel erklärt ihr eifrig, wo die Veranda hinkommt und wie er das Dach bauen möchte, aber die Mutter ist gar nicht so überwältigt, wie er erwartet hatte, sie nickt nur mit dem Kopf, und Aurel ist ein wenig enttäuscht.
Dann nimmt sie die Kinder mit sanftem, aber festem Griff an den Handgelenken – mein Gott, wie diese Finger wieder mit Lehm verschmiert sind –, und alle drei setzen sich auf die Schaukelbank. Aurel hat ein schlechtes Gewissen; worüber wird sich Fömarie wieder beklagt haben: über den Himbeerwurm oder über die Kletten in der Frisur? Aber dann sagt die Mutter:
„Ich muß euch etwas sehr, sehr Trauriges erzählen: Herr Ackermann kommt nie wieder, er ist beim Schwesterchen im Himmel!“
„Tot?“ fragt Adda.
„Ja, für uns ist er tot“, sagt die Mutter, „aber im Himmel lebt er, und wenn wir selbst einmal hinkommen, werden wir ihn wiedersehen!“
„Und warum ist er nicht bei uns geblieben?“ fragt Aurel nach einer Pause.
„Weil der liebe Gott ihn gerufen hat“, sagt die Mutter, „und weil es ihm hier auf der Erde wohl zu kalt war.“
Sie sitzt noch eine Weile mit den Kindern auf der Schaukelbank, die ganz stillsteht. Man könnte sie leicht ein wenig wippen, nur ein wenig, wenn man das Bein ausstrecken und mit dem Fuß einen kleinen Schubs geben würde – aber Aurel tut das nicht. Wenn Acka tot ist, dann soll die Bank auch nicht schaukeln. Dann will er auch nicht mehr bauen. Auch keine Beeren essen. Und nicht mehr klettern. Der ganze Spielplatz ist plötzlich so leer und so langweilig geworden. Als die Mutter gegangen ist, geht auch Aurel. Und Adda folgt ihm und schleift die Puppe Franz hinter sich her.
Zum Mittag gibt es Stachelbeer-Kissél – Aurels Lieblingsspeise. Aber er ißt nur einen Teller davon und auch den nur nach langem innerem Kampf.
„Warum willst du nicht mehr?“ fragt Fömarie verwundert.
„Weil ich nicht will“, sagt Aurel und schiebt den Teller weit von sich.
Aber Adda löffelt unbekümmert drauflos. Und auch sonst ist alles, als wäre nichts geschehen. Die großen Brüder und Herr Tiedebök, der neue Hauslehrer, der seit Ostern da ist, gehen nach dem Essen baden. Der Vater verschwindet mit seiner Pfeife im Lesezimmer. Die Mutter hat sich hingelegt. Auch Adda muß nach dem Mittag in ihrem Gitterbett liegen. Dies ist die Stunde, in der Aurel unter Fömaries Aufsicht etwas rechnen soll. Aber das kann er heute nicht. Und während sie Adda schlafen legt, rennt Aurel, die Mundharmonika in der Tasche, durch die Küchentür in den Garten, schleicht sich hinter dem Cyrenengestrüpp am Zaun entlang, an der Holzscheune, am Ziehbrunnen, an den Mistbeeten vorbei und klettert über den warmen Düngerhaufen durch die Luke in den Pferdestall.
Hier ist es kühl und dunkel. Das gleichmäßig mahlende Geräusch der käuenden Pferdemäuler wird nur von Kettengeklirr und Hufgestampf unterbrochen. Aber auch hier fühlt Aurel sich nicht ganz sicher: der alte Marz könnte kommen, die schwarze Tina könnte ihn hier suchen. Vorsichtig tastet er sich zur Sprossenleiter und klettert zum Heuboden hinauf. Er muß nur sehr acht geben, denn er weiß, daß hier Löcher sind, durch die das Heu zu den Pferden hinuntergestoßen wird. Vorn, über der Tür zum Wagenhaus, ist eine große Luke: hier wird das Heu abgeladen. Jetzt ist sie geschlossen, aber durch einen Spalt kann Aurel den Hof bis zur Küchenseite des Wohnhauses übersehen. Eben schleppt Janz an einer Querstange auf den Schultern zwei Wassereimer vom Brunnen zur Küche. Liese steht auf den Stufen, ruft die Hühner und wirft ihnen etwas zu. Waldi liegt japsend, die steifen Beine von sich gestreckt, vor der Kellertür in der Sonne.
Und wirklich: jetzt hört Aurel ganz deutlich von der Gartenveranda her Fömaries schrille Stimme. Aber er rührt sich nicht. Er legt sich im Heu hin, so daß er durch die Lukenspalte den Hof im Auge behält und bei drohender Gefahr sich tief im Heu vergraben kann. Dann zieht er die Mundharmonika aus der Tasche – dieselbe Mundharmonika, auf der ihm Acka zu Weihnachten vorgespielt hatte –, preßt das schon etwas gelb angelaufene Blech an die Lippen, bringt aber nur ein klägliches, hoffnungsloses Gewinsel hervor, das sich ihm spitz in das Herz bohrt und ihn dennoch tief beglückt. Vielleicht hört mich jetzt Acka, denkt er, vielleicht freut er sich, daß ich hier so allein sitze und so traurig bin, weil er gestorben ist. Nie mehr werde ich wirklich froh sein. Nie mehr auf dem Spielplatz spielen, nie mehr Stachelbeer-Kissél essen.
Und ein tiefes Mitleid mit sich selbst kommt über ihn, weil er hier so allein ist, weil er ganz allein an Acka denkt, während die andern sich so gar nicht um ihn kümmern. Er möchte gern weinen, aber die Tränen wollen nicht kommen, er preßt den Kopf in das Heu – nein, es geht nicht. Er zwinkert mit den Lidern, bohrt die Finger in die Augenwinkel, untersucht sie genau: nicht eine Träne. Vielleicht ist er so traurig, daß er nicht weinen kann, und das macht ihn noch trauriger. Jetzt hat er niemand: Mila ist fort, Acka ist fort. Nie wieder wird er in „Afrika“ sitzen und Sonnen und Weihnachtsbäume malen.
Nein, zu Herrn Tiedebök geht er nicht. Obgleich der ihm oft etwas Süßes schenkt: Schokoladenplätzchen oder ein Bonbon. Aber Herr Tiedebök lacht immer so laut, und wenn er geht, wippt er so mit den Beinen und schlenkert so mit den Armen, als wollte er extra zeigen, wie schön er gehen kann: immer Brust heraus und Bauch herein. Aber Aurel findet das gar nicht schön. Und er versteht nicht, warum er mit den Brüdern auch so marschieren muß, im Großen Korridor, und Herr Tiedebök klatscht dann immer laut mit den Händen und zählt: „Eins – zwei, eins – zwei, eins – zwei!“ Weiter kann er nicht. Er wollte es ihnen vormachen, wie man richtig springen muß. Als er glücklich oben auf dem schräg über den Weg geneigten Apfelbaum stand, wippte er lange mit den Knien, schlenkerte mit den Armen, aber dann kam es ihm doch ein wenig zu hoch vor, und kleinlaut kroch er wieder herunter. Damals lachte er nicht. Aber die großen Brüder lachten. Und Aurel schämte sich sehr. Wenn er ihn jetzt so stolz wippen und schlenkern sieht, muß er immer denken: aber vom Kletterbaum herunterspringen, das kannst du doch nicht!
Aurel hört das Knirschen von Rädern. Durch die Lukenspalte sieht er, wie der alte Marz mit der kleinen Kalesche langsam im Schritt von der Veranda auf das Wagenhaus zufährt. Da fällt ihm ein: heute sollte die russische Gouvernante kommen, um den Brüder russische Nachhilfestunden zu geben. Gut, daß er nicht zu Hause ist. Er gruselt sich vor der unheimlichen Russin, möchte aber doch wissen, ob sie wie Grischa auch im Sommer einen Schafspelz und hohe Stiefel trägt? Der alte Marz spannt jetzt unten die Pferde ab und führt sie in den Stall. Die kleine Kalesche steht da, verstaubt, die leere Deichsel stößt in die Luft.
Aber jetzt muß Aurel doch hinunterklettern, es zieht ihn zum Bock. Er weiß, dort unter dem Kutschersitz, im Bockkasten, neben dem Hafersack, liegt etwas für ihn, etwas, was Marz ihm jedesmal mitbringt, wenn er von der Station kommt. Und das lockt ihn so, daß er es nicht länger auf dem Heuboden aushält. Schließlich ist er ja auch lange genug hier oben gewesen, so ganz allein, und wenn Acka ihn sieht, wird er ihm nicht böse sein, wenn er jetzt hinunterklettert.
Unten im Stall führt Marz gerade die Pferde in die Boxen. Dann streut er Häcksel und Hafer in die Krippen. Aurel steht dabei und sieht aufmerksam zu. Und als Marz zur Kalesche geht, folgt er ihm in stummer Erwartung. Er möchte nicht zeigen, daß er etwas erwartet, und deshalb bückt er sich und betrachtet ganz genau die staubigen Speichen des Rades, obgleich da eigentlich nichts zu sehen ist.
Endlich hat Marz das Geschirr, die schwarzen Lederleinen und die lange Peitsche ins Wagenhaus getragen, und jetzt – ja, jetzt steigt er auf den Bock, klappt den Sitz auf und holt eine braune Tüte hervor. Und aus der Tüte nimmt er zwei Wasserkringel und gibt sie Aurel. Hinter dem buschigen Vollbart lacht sein braunes Gesicht unter der staubbedeckten Kutschermütze.
Diese Wasserkringel sind uralt und steinhart, man kann nur mit großer Mühe ein kleines Stück abbeißen, und sie riechen nach Kutscherbock, nach Leder und Wagenschmiere und schmecken ein wenig nach Staub und Sand. Aber Aurel liebt sie, kaut langsam, andächtig und mit Behagen. Diese Kringel kommen weit her von der Station, dort, wo die Eisenbahn fährt, also beinahe aus der Stadt. Und wenn man sie kaut und den Reisestaub schmeckt, ist es fast, als wäre man selbst ganz weit, in einem fremden Lande, in großen, fremden Städten. Denn hier, zu Hause, gibt es nie Wasserkringel, nur Karrasch, Schwarzbrot und Kümmelkuchen. Und die schmecken nie nach Staub.
Den zweiten Kringel steckt Aurel in die Tasche: der ist für Adda.
Es ist Sommer, immerfort Sommer, und es ist Tag, immerfort Tag. Die Sonne bückt sich nur ein wenig hinter dem Wald und fliegt dann gleich wieder auf wie ein Gummiball, der nur die Erde berührt, um wieder in die Luft zu hüpfen. Zwischen Abend und Morgen ist keine Nacht, nur eine hellgrüne Dämmerung, mit einem roten schmalen Rand über den schwarzen Wäldern. Das Knarren der Schnarrwachteln und das Dengeln der Sensen hört nicht auf, und von den feuchten Heuschlägen weht durch die offenen Fenster ein betäubender Duft von frischgemähtem Gras, Klee und Nachtviolen.
Und dann, an einem frühen Morgen, spannt der alte Marz den Viererzug und die beiden Schimmel vor die große Familiendroschke: an der Spitze Scheck und Schalk, dann Brauni, Iipsi, Mascha und Mazurka. Und alles, was Beine hat, klettert in den mächtigen Wagen, der breit und wippend wie ein Doppelbett ist, mit zwei hohen Türmen: dem Kutscherbock vorn und dem Dienersitz hinten.
Die Mutter, der Vater, Karlomchen, Fömarie, Herr Tiedebök, Marja Petrowna, die russische Gouvernante, Doktor Martinell, die Pastorin – alles hat rechts und links auf dem Doppelbett Platz, und in der Mitte ist noch so viel Raum, daß Aurel und Adda zwischen den beiden Rückenmauern liegen können. Bal sitzt natürlich vorn auf dem Bock neben dem Kutscher, und Rei und Tof sind hinten auf den Dienersitz hinaufgeklettert. Janz und Karlin sind mit allen Vorräten in einer Fuhre vorausgefahren.
Marz klatscht mit der langen Peitsche, und das rollende Haus setzt sich in Bewegung. Es rollt auf der alten Landstraße, an dicken Weidenstümpfen, an Korn- und Kleefeldern, an endlosen Heuschlägen vorbei, bollert dumpf über eine Bohlenbrücke, schaukelt durch kühlen, schattigen Fichtenwald. Sechzehn Werst sind es bis zu den Aa-Heuschlägen, wo die Knechte und Mägde seit einer Woche beim Mähen sind.
Aurel liegt auf dem Rücken: zwischen den dunklen Tannenmauern ist ein blauer Himmelweg, auf dem weiße Lämmerwolken ziehen. Manchmal hat die Mauer ein Loch, und dann wird der blaue Weg plötzlich breiter. Endlich hören die grünen Wände auf, Land und Himmel öffnen sich weit und rund. Die Räder knirschen im tiefen Sand, eine dicke Staubwolke zieht neben dem Wagen her. Manchmal, wenn es aufwärts geht, muß man aussteigen.
Herr Tiedebök geht wippend voran, reißt hier und dort eine Blume ab und fragt, wie sie auf lateinisch heißt und wie viele Staubfäden sie hat.
Doktor Martinell geht neben der Mutter und ist begeistert: vom Wetter, vom Weg, vom Leben. Auch der Tod kann ihm nichts anhaben:
„Wenn er früher nach Meran gekommen wäre“, sagt er und tupft mit dem Taschentuch die rote Stirn, „aber es war zu spät, viel zu spät. Oder gewissermaßen auch zu früh: in zehn Jahren wird es in zivilisierten Ländern keine Tuberkeln geben. Wie es heute keine Pest gibt. Der Fortschritt der Wissenschaften …“
Marja Petrowna zeigt auf die Pferde und sagt: „Loschadji!“ Und Aurel soll es auch sagen. Aber warum soll er das tun? Die Pferde verstehen bestimmt kein Russisch. Er läuft zum Vater hinüber und geht hinter ihm her. Manchmal bleibt der Vater stehen und schnauft. Dann bleibt Aurel auch stehen. Aber der Vater sieht sich nicht um.
Fömarie sagt: „Es staubt!“ Und stelzt mit hochgezogenen Röcken am Grabenrande.
Die Pastorin geht auf der anderen Seite neben dem Roggenfeld und pflückt Kornblumen. Sie trägt ein blaues Sommerkleid, und rund und blau sieht sie selbst wie eine Kornblume aus.
Dann steigt alles wieder ein, und das fahrende Haus rollt weiter.
Endlich ist man angekommen, auf einem weiten Heuschlag mit alten, einzeln dastehenden Eichen. Zwischen gelben, glatten Sandbänken windet sich die Aa, das Wasser glänzt und flimmert wie Silberpapier in der Sonne. Noch nie hat Aurel einen so großen Fluß gesehen und so viel Sand. Er darf mit Adda Schuhe und Strümpfe ausziehen und mit nackten Füßen auf dem heißen Sand herumlaufen.
„Aber nicht ins Wasser!“ ruft Fömarie. „Nicht ins Wasser!“
Die großen Brüder gehen mit Herrn Tiedebök hinter den Ellernbüschen baden. Doktor Martinell krempelt sich die Hosen bis zu den Knien auf und watet im flachen Wasser.
„Herrlich!“ ruft er und fuchtelt begeistert mit dem Taschentuch in der Luft. „Herrlich!“ Aber dann rutscht er aus und liegt – patsch – im Fluß. Hinter den Ellern trocknet er sich in der Sonne, seine weiß karierte Hose hängt an einem Ast.
Aurel und Adda haben hinter einem Schilfdickicht einen kleinen Bach entdeckt und patschen im kühlen Wasser. Hier kann Fömarie sie nicht sehen. Dann helfen sie den Knechten und Mägden beim Heuen, schleppen eifrig Heubündel hin und her, kratzen mit einem Rechen, wälzen sich auf den Haufen. Heuschrecken zirpen und hüpfen in der flimmernden Luft, Aurel fängt ein fettes grünes Tier: was für große Augen und spitze Beine es hat – er will es Adda zeigen, aber dann macht es einen gewaltigen Satz und ist verschwunden.
Karlomchen ruft zum Essen. Am Ufer, unter einer schattigen Eiche, ist ein weißes Tischtuch auf dem Grase ausgebreitet. Es gibt kalte Hühnerbeine zum Knabbern, dicke Milch mit jungen Kartoffeln und kalten Reispudding mit Pflaumen und Äpfeln. Und nachher Kaffee und Kuchen.
„Ist es nicht herrlich“, sagt Doktor Martinell und beschreibt mit den Armen einen weiten Bogen, als wenn er das alles – Sonne, Wiese und Fluß – selbst eingerichtet hätte, „nirgends ist der Sommer schöner als bei uns, da kann mir dieser ganze Süden mit seinen Palmen gestohlen werden!“
„Der Sommer“, sagt die Mutter, „aber der Sommer ist kurz!“
Der Vater ist aufgestanden und geht langsam am Ufer entlang. Aurel folgt ihm. Hier ist das Ufer steil und ausgewaschen und drüben flach und sandig. Eine Eiche ist umgestürzt und liegt mit ihrem dicken Stamm halb im Wasser; eine andere klammert sich noch ans Erdreich, aber ihre ausgespülten Wurzeln hängen unten schon in der Luft.
Der Vater bleibt nachdenklich stehen, und auch Aurel steht.
„Im nächsten Frühling wird die Aa auch diese Eiche holen“, sagt der Vater und klopft mit dem Stock an den Stamm, „und jedes Jahr geht ein Stück von unserem Heuschlag mit!“
„Warum?“ fragt Aurel verwundert.
„Weil unser Ufer das hohe ist“, sagt der Vater, „das Wasser nimmt immer den Sand vom hohen Ufer und schwemmt ihn an das flache an: das hohe wird immer kleiner und das flache immer größer.“
„Und drüben das flache gehört nicht uns?“ erkundigt sich Aurel.
„Nein, das gehört den Esten. Die Aa ist die Grenze“, sagt der Vater.
„Und kann man nichts dagegen tun?“
„Nichts“, sagt der Vater und geht weiter.
Und wie er so, ein wenig vornübergebeugt, am Rande des hohen, Stück für Stück abbröckelnden Ufers geht, hier und dort stehenbleibt und mit dem Stock in der Erde herumstochert, sieht der Vater plötzlich alt aus – so alt hat ihn Aurel noch nie gesehen. Und warum muß gerade unser Ufer mit dem fetten Gras und den hohen Eichen jedes Jahr immer kleiner und drüben das flache mit dem vielen Sand, auf dem nichts wächst, immer größer werden? Nein, das begreift er nicht. Der flimmernde Fluß, der sich wie eine Schlange zwischen den gelben Bänken schlängelt, erscheint ihm mit einem Mal heimtückisch und das Ufer auf der andern Seite, mit den Esten, die dort wohnen, böse und feindlich. Zum ersten Mal fühlt Aurel dunkel, daß es etwas gibt, was noch mächtiger ist als der Vater.
Dann lag Aurel wieder ausgestreckt auf dem wippenden Polster der Familiendroschke; die Hufe klapperten, die Räder rasselten, hin und wieder zischte die lange Peitschenschnur mit einem kurzen Knall durch die Luft. Halb schlief er, halb lag er wach. Dunkle Äste, schwarze Baumkronen schaukelten im blaßgrünen Himmel vorüber. Als der Wagen in die Allee einbog, wehte es schwül von den Zweigen, die noch die Mittagswärme aufbewahrten.
Es war Sommer, immerfort Sommer, und jeder Tag hatte seine besonderen Freuden. Es braucht ja nicht gerade eine Flöte zu sein oder ein Haus, das man baut, oder eine Fahrt zu den Aa-Heuschlägen, es gibt so viele kleine, ganz winzige Dinge, die Aurel glücklich machen: ein glatter gelber Stein, den er im Grandhaufen findet und der so merkwürdig schimmert, wenn man ihn gegen das Licht hält, oder ein Stück rosig-weiße Birkenrinde, die so dünn ist wie Seidenpapier und so weich und kühl, wenn man sie an die Wange hält. Oder Aurel hockt auf der Verandastufe, die nackten Füße auf dem Schutzeisen, mit dem die Stufenkanten beschlagen sind: wie das Eisen brennt. Oder es kommt ein Guß, und aus dem Blechrohr der Dachrinne schießt das Wasser, rennt mit schäumender Zunge über den Grandweg zum Rasenrand, und man kann nachher mit bloßen Füßen im nassen Grase laufen.
Aber man braucht nicht einmal etwas mit den Händen oder mit den Füßen zu befühlen, manchmal genügt es schon, wenn man nur schnuppert.
Da sind die Weichselholzpfeifen des Vaters; die stehen im Schreibzimmer in der Ecke am Fenster, aufgereiht auf dem runden Pfeifenständer. Und wenn der Vater nicht zu Hause und die Tür offen ist, beriecht Aurel manchmal heimlich die süßlich duftenden Rohre, die gelben Bernsteinmundstükke, die einen kalten, bitteren Tabakgeruch ausströmen. Oder er zerreibt ein Blatt vom Buchsbeerstrauch: wie das duftet! Das ist der schönste Geruch, den er kennt. Oder er sucht auf dem Heuschlag am Waldrande die weißen Kerzen der Nachtviolen, die am Abend so betäubend duften, daß man sie auf die Veranda hinausstellen muß.
Aber auch ganz gewöhnliche Geräusche können Aurel sehr glücklich machen: das Knarren vom Ziehbrunnen, das Wäscheklopfen unten beim Waschhaus und mittags und abends das Geklapper mit dem Klöppel auf dem in der Luft baumelnden Brett, wenn die Knechte zum Essen kommen sollen. Die klagenden Rufe des Viehhüters: „Maja, maja, maja!“ – das Blöken der heimkehrenden Herde.
Und dann kam der Abend, die Nacht, in der die Stimmen und Klänge überhaupt nicht verstummten, die bis in den Morgen vom Gesang der Leute und vom Gebrumm der Ziehharmonika erfüllt war. Bei Indrik, dem Gärtner, fing es an: dort versammelten sich die Knechte, Mägde und Weiber. Singend – ein schwermütiger, eintöniger Gesang – kamen sie auf den Hof gezogen, auf den Rasenplatz vor die Veranda. Das Lied hatte unzählige Verse, aber immer dieselbe Melodie, dieselbe klagende Anrufung des heidnischen Sonnengottes: „Ligoa, Ligoa, Ligoa!“
Alle Mägde und Knechte tragen Blumen-, Laub- und Beerenkränze auf den Köpfen, oft viele Kränze aufeinander, die sich tief in die Gesichter drükken, so daß es von der Veranda aussieht, als stände und sänge dort ein Wald von mächtigen Gras- und Blätterkränzen.
Karlin und die schwarze Tina laufen die Stufen herauf und hinunter. Sie schenken Bier und süße Himbeerlimonade aus und tragen gewaltige Schüsseln umher mit Kuchen und gelbem Johanniskäse. Karlomchen füllt immer wieder die Krüge und Karaffen. Und dann fliegen die Kränze auf die Veranda, die Mutter bricht fast unter der Last, die sich auf ihrem Kopf türmt, zusammen. Auch Aurel steht da mit einem schweren Blumen- und Blätterturban, der sich tief über seine Augen senkt, so daß er nur noch zwischen herunterhängenden Grashalmen und Laubgewirr sehen kann, wie die Knechte und Mägde auf dem Rasenplatz tanzen, während Mickel auf der Ziehharmonika spielt. Endlich wandern die Leute singend durch die Allee zum Krug; immer weiter entfernt sich der Gesang, aber er verstummt nicht, und die windstille Luft trägt die Stimmen noch lange von der Landstraße her in die weiß dämmernde Sommernacht.
Und oben auf der höchsten Birke beim Eiskeller lodert eine Teertonne, und überall hinter den weiten Heuschlägen und dunklen Wäldern flammen rote Feuergarben auf in den blaßgrünen Himmel.
Aurel darf länger aufbleiben. Es geht mit der Mutter in die Allee, und dort, am Stamm einer alten Linde, setzen sie sich auf eine Bank.
„Hörst du?“ fragt die Mutter.
Und er hört: aus dem Kleefelde tönt ein heller Vogelruf: „Ki–zoi–witt, ki–wi–witt, ki–wi–witt!“
Dann ist es wieder still.
„Das ist die Schlagwachtel“, sagt die Mutter, „und immer schlägt sie dreibis fünfmal, nie mehr und nie weniger!“
Und immer zählt Aurel: drei Schläge, vier Schläge, fünf Schläge, dann verstummt der Vogel. Und nur die Schnarrwachtel knarrt unermüdlich und ohne Pause.
„Nie mehr und nie weniger“, wiederholt die Mutter seufzend. „Drei Monate, dann ist der Sommer zu Ende, und fünf Monate, dann ist es wieder Winter. Aber jetzt mußt du ins Bett!“
Aurel nimmt die vielen Kränze mit und hängt sie am Bettpfosten über dem Kopfkissen auf. Wie die Wiesenblumen und Gräser duften! Ein Kranz ist voll überreifer Walderdbeeren, die süß auf der Zunge zergehen.
Aber noch lange liegt Aurel wach.
Durch das offene Fenster wehen vom Krug Gesang und Harmonikagedudel, quarren die Frösche im Teich, meckert weit auf dem Heuschlag eine Bekassine, bellt ein schreckender Rehbock im Wald. Die weiße Johannisnacht singt mit all ihren Stimmen das Lied vom kurzen Sommer.