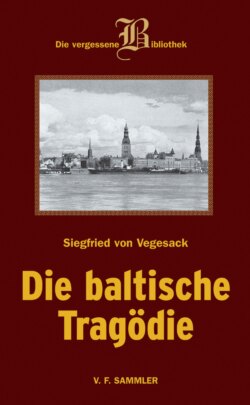Читать книгу Die baltische Tragödie - Siegfried von Vegesack - Страница 12
Die Welt ist voller Tanten
ОглавлениеRei war auf den Ahorn hinaufgeklettert, der am Eingang der Allee stand, Tof baumelte auf einem Ast, Aurel klebte unten am Stamm wie ein Frosch mit hochgezogenen Knien, und Adda reckte sich auf den Fußspitzen.
Da schrie Bal hoch oben von der Dachluke:
„Sie kommen! Sie kommen! Ich sehe ganz deutlich eine Staubwolke bei der Grenzbrücke!“
Und bald rief auch Rei vom Ahorn herunter:
„Ja, sie kommen! Ich kann schon die drei Schimmel erkennen! Jetzt sind sie bei der Flachsweiche!“
Aurel versuchte immer wieder hinaufzuklettern, rutschte aber jedesmal an der rauhen Borke herunter.
Und dann bog die Kalesche mit den drei Pferden beim Kruge in die Allee ein. Eine Staubwolke wirbelte, Hufe klackerten, Räder knirschten, jetzt rollte die Equipage um den runden Rasenplatz, und Onkel Oscha saß winkend im weißen Staubmantel in der heruntergeklappten Kalesche.
Alles drängte sich auf der Veranda. Die kleine Karlin öffnete den Wagenschlag. Onkel Oscha schnaufte die Stufen herauf, umarmte und küßte alle der Reihe nach: die rechte Backe, die linke und wieder die rechte, der weiße, stachlige Vollbart kitzelte.
Janz und die schwarze Tina schleppten den schweren, mit Lederriemen zusammengeschnürten Koffer – den „Tschemodan“ – die Treppe hinauf. Der eine Schimmel spreizte so komisch die Beine. Ein dampfender Strom rauschte in den trockenen Grand und ergoß sich bis zum Rasenrande. Dann durften Aurel und Adda in die Kalesche klettern, der Kutscher gängelte die Pferde um den Platz.
Onkel Oscha war Mamas Bruder. Er war der einzige Onkel, der keine Tante hatte, und deshalb fuhr er wohl mit seiner Kalesche immer von Verwandten zu Verwandten. Auf seinem eigenen Gut war er nur selten, und was sollte er auch da so allein tun?
Onkel Oscha war klein und breitschultrig, hatte eine dicke Goldkette über dem Bauch mit vielen Berlocken: Bärenkrallen, eine plattgedrückte Bleikugel und eine feuerrote Koralle. Den Bären hatte er selbst geschossen und mit der Bleikugel einen Elch erlegt, der ihn fast zertrampelt hatte. Wenn Onkel Oscha erzählte, strich er sich mit beiden Händen die Vollbartspitzen nach rechts und nach links, und jedesmal, wenn er kam, befühlte er die Ohrläppchen der Kinder, und wenn sie dick waren, zog er süße Karamelbonbons aus den Ohren. Aber er konnte auch das Elfenbeinpapiermesser auf seinen Knien schleifen, und wenn man ihn dann noch immer nicht in Ruhe ließ, sprang er plötzlich auf und rannte hinter einem her:
„Warte, jetzt, wirst du abgemurchelt!“
Dann half kein „Mundspitzen“, kein „Zähneklappern“ – man wurde gemurchelt, bis man die „Engel im Himmel pfeifen“ hörte:
„Hörst du sie?“
„Nein! Noch nicht!“
„Und jetzt?“
„Noch immer nicht!“
Aurel konnte nie die Engel pfeifen hören. Aber dafür hörte er jetzt jeden Abend in der Waschküche, unten beim Knechtshaus, wie Indrik, der Gärtner, mit der schwarzen Tina, Karlin, Rosalia und den anderen Mädchen das Morgenständchen einübte. Und dann kam Mamas Geburtstag.
Die Tür zu ihrem Schlafzimmer und ihr Stuhl am Speisetisch waren mit Laubgirlanden umrankt. Es roch nach Safran, nach Wachskerzen, nach frischen Kümmelkuchen.
Indrik und die Mägde schlichen am frühen Morgen auf bloßen Füßen in den Saal, stellten sich räuspernd vor der Tür auf – der Gärtner hob die Hand, schwang sie im Takt, und seine tiefe, schöne Stimme tönte mit dem schrillen, hohen Gesang der Mägde durch das noch schlafende Haus.
„Wie die Kalkhühner stinken“, sagte später der Vater, als er paffend durch den Saal ging.
Auf dem Tisch im Speisezimmer lag ein mächtiger gelber Safrankringel, zwischen dessen Rundungen auf zwei umgestülpten Tellern bunte Wachskerzen flackerten. Aber die braunen Mandeln hatten Aurels kleine Finger hier und dort aus der knusprigen Kruste schon herausgeknibbert, und jetzt wartete er darauf, mit Adda die Kerzen auszupusten.
Und dann stampfte Tante Olla durch den Saal. Die Kristallzapfen am Kronleuchter zitterten, und auch Aurel erschrak, als er diese mächtige Tante zum ersten Mal sah. Denn sie hatte einen tiefen Baß, ein dröhnendes Lachen und einen richtigen Schnurrbart im braun gebrannten, von einer zottigen weißen Mähne umwucherten Gesicht. Wenn Aurel ihr die Hand küßte, stieß seine Nase immer gegen den grünen Malachitstein ihres Siegelringes, und wenn er neugierig um sie herumging, dann war es eine weite Wanderung: so gewaltig war ihr Umfang. Daß dies Mamas Schwester war, konnte er nie begreifen.
Nach der Umarmung sank die Mutter immer erschöpft auf das Sofa, und Tante Olla holte sich ein silbernes Kästchen aus dem Beutel, klappte es auf, nahm ein Stück Papier, bestreute es mit Tabak und rollte sich eine Zigarette. Dann warf sie den Kopf zurück und paffte.
Die großen Brüder hatten einmal gesagt: „Tante Olla ist ein Mann.“ Aber warum trug sie dann Röcke? Oder hatte sie darunter vielleicht doch Hosen an? Aurel kroch unter den Tisch, um das Rätsel zu ergründen. Aber dann mußte er wieder heraus und eine neue Tante begrüßen.
Die Welt war voller Tanten, voller knisternder schwarzer Seidenröcke, Lavendelgeruch, klappernder Stricknadeln und warmer, etwas feuchter Tantenküsse.
Da war Tante Melanie, die immer Jäckchen häkelte. Aurel mußte ihr manchmal das Garn halten, die Hände steif nach oben, der Faden lief immer in der Runde, von einer Hand zur andern. Aber Aurel schielte doch hinüber und sah, wie Tante Melanie heimlich in Papier eingewickelte Schokoladeplätzchen in den Wunderknaul steckte, die dann beim Häkeln zum Vorschein kamen. Deshalb saß er doch oft bei dieser Tante und starrte gespannt auf den sich abwickelnden Knaul.
Dann war das Tante Constance, die mit ihrer weißen, welken Hand, an der viele blitzende Ringe und ein goldenes Armband klirrten, immer Karten auslegte.
„Man muß sich in Geduld üben“, sagte sie belehrend und tupfte mit dem Zeigefinger über die Karten, „und deshalb heißt dieses Spiel auch Patience – das heißt Geduld!“
Wenn aber Aurel seine Hand in die Hosentasche steckte, dann sagte sie streng:
„Kind, die Tasche ist nicht für die Hand! Das schickt sich nicht!“
„Warum schickt sich das nicht?“
„Weil ich es dir sage!“ erklärte sie ungeduldig.
Aurel zog die Hand aus der Tasche und ging fort. Tante Constance mußte sich wohl noch lange in Geduld üben.
Aber die liebste von allen war ihm Tante Madeleine. Sie war schmal und schwarz und so ausgelassen wie ein Füllen, machte immer Unsinn und schaukelte sogar oben im Großen Korridor, bis sie mit den Fußspitzen die Decke berührte.
„Madeleine, je t’en prie!“ sagte Onkel Nicolas und hielt die Schaukel an. Onkel Nicolas und Tante Madeleine sprachen oft französisch, damit man es nicht verstehen sollte. Wenn sie kamen, mußten sich alle Kinder im Saal in einer Reihe aufstellen: Balthasar, Reinhard, Christof, Aurel und Adda. Und dann mußte jeder seinen Namen und sein Alter nennen.
„Mon Dieu, wieviel Jungen!“ sagte Tante Madeleine, tupfte mit der Hand über die Scheitel und zählte: „Eins, zwei, drei, vier! Und nur ein kleines Mädel! Mais quelle gentille petite fille! Sollen wir nicht tauschen? Zwei Jungen gegen zwei Mädchen! Wieviel lieber hätte ich eine solche Rasselbande!“
Dann dürfen die großen Brüder abmarschieren. Und Tante Madeleine nimmt Aurel an der Hand, er muß sich an den Türpfosten stellen, die Schuhe ausziehen, sie mißt ihn mit dem Zentimeterstock.
„Genau so groß wie Boris“, sagt sie nachdenklich, „und genau so alt. Die würden gut zusammenpassen! Willst du mitkommen?“
Aber Aurel schüttelt den Kopf. Dann sagt er stockend:
„Du mußt hierbleiben!“
„Und Boris?“
„Der soll auch herkommen!“
Und dann öffnet Janz, in einem grauen Dienerrock mit blanken Knöpfen, die roten Hände in weiße Glacéhandschuhe gepreßt, die Flügeltür und bittet zu Tisch.
An diesem Festtag dürfen Aurel und Adda gleichzeitig mit den Großen essen. Aber Aurel fürchtet sich, er weiß, was später kommen wird, und daß dann wieder alle über ihn lachen werden. Er kneift sich heimlich mit dem Daumennagel in die Wade – vielleicht gelingt es ihm diesmal, das Schreckliche zu überstehen.
Das weiße, lange Gesicht vom Pastor bekommt schon rote Flecke, die schwarze Halsbinde um den niedrigen Kragen ist zur Seite gerutscht, so daß man den Messingknopf sehen kann. Die Stimmen schwirren, die Messer und Gabeln klappern. Dann wird es plötzlich still. Der Doktor ist aufgestanden, die goldene Kette funkelt auf seinem weißen Bauch. Im Aufschlag des schwarzen Bratenrockes steckt eine weiße Aster. Er klopft an sein Glas, räuspert sich, und dann hält er seine Rede auf das Geburtstagskind.
Doktor Martinell redet gern, redet lange und mit viel Gefühl. Er fängt immer mit dem Frühling an und endet mit dem Herbst: „Wir freuen uns an den Blüten, aber wir genießen die Früchte! Und die Kinder sind die Früchte der Frau: an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen!“ Dann hebt er sein Glas – Aurel kneift sich tief in die Wade: jetzt, jetzt kommt es. Alles hat sich erhoben, der Pastor stimmt an, und dann tönt es grell und herzzerreißend:
„Hoch soll sie leben, hoch soll sie leben! Dreimal hoch!“
Aurel schluckt und schluckt, Eiskugeln rollen ihm über den Rücken, und in der Kehle brennt es heiß. Lange hält er sich tapfer, starrt angestrengt auf seinen Teller, auf das Wachstuch mit den bunten Max-und-Moritz-Bildern, aber plötzlich verschwimmt alles vor seinem Blick, brennend schießt es in seine Augen, es strömt und strömt, er schluchzt mit zuckenden Schultern.
Und dann hört er dies schreckliche Gelächter, sieht durch den Tränenschleier lauter lachende Köpfe, auch das vom Wein gerötete Gesicht des Vaters lacht, ja, er macht sich sogar über ihn lustig und zuckt, ihn nachäffend, mit den Schultern. Noch nie war der Vater ihm so fremd, ja, in diesem Augenblick haßt er ihn.
Auch die Mutter versucht zu lächeln, aber es glückt ihr nicht ganz. Nur Tante Madeleine lacht nicht, sie ist aufgesprungen, sie stellt sich schützend zwischen ihn und das grausame Gelächter. Dann führt sie ihn hinaus, legt ihn im Grünen Gastzimmer auf ihr Bett, erzählt ihm von Boris, seinem Vetter, von Isa, Maurissa und Warinka, seinen Cousinen, die er noch nie gesehen hat, legt ihre kühle Hand, die so gut riecht, auf seine heiße Stirn, bis er beruhigt einschläft.
Am Abend brennen überall weiße Alabasterlampen. Sogar im Flur, im Treppenhaus, im Großen Korridor – überall ist der weiße Schein der matten Kugelkuppeln, die wie lauter Monde aussehen. Nur im Lesezimmer flackern Wachskerzen in schweren silbernen Leuchtern: dort sind die grünen Kartentische aufgeschlagen, die Herren spielen Whist und trinken Rotwein. Dicke Rauchwolken stehen in der Luft. Alle Türen sind offen. Auch zum Schreibzimmer des Vaters, wo der Kamin prasselt, der Schaukelstuhl leise knarrt und in der Ecke die vielen langen Weichselholzpfeifen aufgereiht im Kreise um einen runden Pfeifenständer stehen.
Karlomchen huscht überall herum, schraubt die Dochte, damit die Lampen nicht blaken, klappert mit dem Schlüsselbund.
„Setz dich doch endlich hin!“ sagte die Mutter.
Karlomchen setzt sich. Aber gleich darauf ist sie wieder verschwunden.
Und dann müssen alle auf die Veranda: rund um den Rasenplatz, in allen Bäumen und Büschen, ja sogar tief in die Allee hinein, leuchten rote, grüne, blaue, gelbe und rosa Papierlaternen. Wie unergründlich, wie geheimnisvoll ist das Dunkel der Zweige im schwachen Schein der bunten Lichter. Dann und wann streicht eine Fledermaus dicht an der Veranda vorüber.
„Mein Gott, eine Fledermaus!“ schreit Fömarie: „Man muß die Fenster schließen!“
Tante Madeleine führt aber Aurel auf die andere Seite des Hauses, auf die Gartenveranda. Hier brennen keine bunten Laternen, aber hoch über den Lebensbäumen funkeln und flimmern die Sterne in der schwarzen Augustnacht. Noch nie hat Aurel so viele und so helle Sterne gesehen.
„Warum zittern sie so?“ fragt er verwundert.
„Weil jeder Stern einen Menschen hat, den er liebt und für den er fürchtet! Wenn der Mensch etwas Schlechtes tut, verliert der Stern seinen Glanz. Und jeder Stern will glänzen!“
Eine Sternschnuppe fliegt schnell über den Himmel und fällt hinter die Apfelbäume.
„Sahst du?“
„Ja, ein Stern ist heruntergefallen“, sagt Tante Madeleine. Lange sieht sie schweigend zum Himmel hinauf. „Und wenn ein Stern herunterfällt“, sagte sie leise, „dann ist ein Mensch gestorben!“
In der Lindenlaube schreit ein Kauz: „Kuwiht, kuwiht, kuwiht!“ Es klingt wie schrilles Gelächter oder wie der Schrei eines Kindes.
Dann fahren die vielen Tanten wieder fort.
Im Grünen, im Rosa Gastzimmer, im Treppenzimmer, im Eßzimmer – überall werden die Betten mit weißen Spitzentüchern zugedeckt, die Waschschüsseln umgestülpt, die Vasen mit den welken Astern hinausgetragen. Die schwarze Tina klappert mit den Eimern, Karlomchen zählt die Wäsche, die Tür zum Lesezimmer ist wieder geschlossen.
Als letzter fuhr Onkel Oscha. Aurel und Adda durften bis zur Flachsweiche mitfahren. Wieder stand alles winkend auf der Veranda, bis die Kalesche von der Allee auf die Landstraße einbog. Aber hier, beim Krug, ließ Onkel Oscha halten. Er ging mit den Kindern in den Kramladen. Wie es hier in der Bude nach Wagenschmiere, nach Heringen, Teer, Juchtenleder, Lakritzen und Wasserstiefeln roch! Mit zwei spitzen Tüten Karamelbonbons kamen sie wieder heraus.
„Warum kannst du nicht länger hierbleiben?“ fragte Aurel verzweifelt, als die Schimmel bei der Flachsweiche hielten.
„Weil ich noch viele andere Ohren untersuchen muß!“
Die Pferde zogen an, Onkel Oschas weißer Staubmantel beugte sich noch lange aus der halbaufgeschlagenen Kalesche heraus, dann war er hinter der dicken Staubwolke verschwunden. Die Kinder standen allein auf der Landstraße, die Bonbontüten in den Händen. Sie setzten sich am Grabenrand neben einen Weidenstumpf und fingen an zu lutschen. Die bunten klebrigen Papierchen werden in die Taschen gesteckt, die Finger abgeleckt, alles ist süß und klebrig. Eine Dreschmaschine summt irgendwo, und auf dem Heuschlag am kleinen Fluß stelzen drei Störche. Wenn sie ein Stückchen auffliegen, hängen die langen roten Beine so komisch in die Luft.
Aurel wendet den Kopf und erschrickt: da kommt auf der Landstraße der „verrückte“ Schweinehüter mit seinen Schweinen gerade auf sie zu. Dieser Schweinehüter ist ein Idiot, der immer mit sich selbst redet und lallend mit einem Stock hinter den Schweinen hertorkelt. Er hat einen zerrissenen, schwappenden Strohhut, zerlumpte Hosen, ein unheimliches, bärtiges Gesicht mit immer offenem Mund und verblödeten Augen.
Die Kinder sind aufgesprungen, halten sich an den Händen und rennen, was sie können. Aber jetzt fängt auch der Verrückte an zu laufen, mit geschwungenem Stock und weißem Schaum vor dem Munde – Aurel sieht es ganz deutlich, als er sich umwendet –, und alle Schweine galoppieren hinter ihm her. Bis nach Hause ist es noch weit, Adda kann nicht schnell laufen, und der Verrückte kommt immer näher. Aber da ist die Flachsweiche mit dem hohen Schilf und den dichten Weidenbüschen.
Aurel klettert über den Graben, zieht Adda nach, und beide verkriechen sich in dem grünen Dickicht. Am ganzen Leibe zitternd, hören sie den Verrückten lallend vorbeistolpern, das Grunzen und Quieken der Schweine. Noch lange hocken sie da versteckt. Aurel zieht einen Kalmusstengel aus der moorigen Erde, schält das rote Ende ab und riecht am weißen Mark: wie geheimnisvoll das duftet! Und genau so merkwürdig schmeckt auch der dikke, kühle Stengel, wenn man daran knabbert. Dann bricht er einen braunen Schilfkolben ab, der sich wie Samt anfühlt, und einen für Adda, und beide wandern Hand in Hand über die kahlen Stoppelfelder heimwärts.
Die Tage werden immer kürzer, in den Nächten friert es schon. Janz muß wieder die Öfen heizen. Aber mittags scheint noch die Sonne warm auf die Veranda, die Mutter sitzt auf dem rotweiß gestreiften Ecksofa, den weißen Schal um die schmalen Schultern, und stopft. Der Ahorn am Eingang zur Allee ist blutrot. Und die Laubgardine vor dem Wirtschaftsweg wird immer gelber und dünner.
Einmal, vor dem Mittagessen, nahm die Mutter Aurel mit zur Windmühle. Karlomchen trug einen großen Korb Verbandzeug, Watte, Wachssalbe und Baldrian. Mit Wachssalbe und Baldrian wurde alles kuriert, und das half immer. Aber diesmal war es etwas Ernsteres: die kleine Christin vom Müller hatte sich mit kochender Milch das Bein verbrüht. Wie dunkel und stickig war es in der armseligen Stube, überall hockten Kinder in Lumpen herum, starrten mit stumpfer Freudlosigkeit zu den Fremden auf. Und auf dem einzigen Bett lag etwas unsäglich Jämmerliches und wimmerte vor sich hin. Wieder wurden die Hände geküßt, Aurel hielt sie krampfhaft hinter dem Rücken versteckt, aber es half ihm nicht, und wieder fühlte er etwas widerlich Feuchtes und Kaltes auf seiner Haut.
Auf dem Heimweg fragte Aurel die Mutter:
„Haben sie nur ein Zimmer und nur ein Bett?“
„Ja, der Müller ist arm“, seufzte die Mutter und blieb erschöpft auf der Anhöhe stehen.
Eine dunkle Erinnerung stieg in Aurel auf: alle diese Äcker, Heuschläge und Wälder – gehörte nicht alles dem Vater?
„Und warum ist der eine arm und der andere reich?“ forschte Aurel weiter.
„Weil der liebe Gott es so eingerichtet hat“, meinte die Mutter und nahm den Jungen an der Hand. „Aber im Himmel werden wir alle gleich sein!“
Warum erst im Himmel? grübelte Aurel. Und warum hat Gott es so eingerichtet, wenn er wirklich allmächtig ist? Und der Vater? Warum baut er nicht einfach ein paar Zimmer und noch ein paar Betten für den armen Müller – er hat doch so viel Bäume im Wald?
Aber dann öffnete sich wieder die Gartenpforte, die tief herunterhängenden, schwerbeladenen Apfelzweige nahmen ihn schützend auf, und alle unbeantworteten Fragen blieben hinter dem grauen Bretterzaun zurück.
Viel wichtigere Fragen stürmten jetzt auf ihn ein: ob im Grase unter dem alten Birnbaum wieder die gelben, kleinen Birnen liegen, die ein wenig holzig, aber doch gut schmecken, besonders wenn man sie in der Bratröhre schmoren läßt, bis sie ganz weich und faltig werden.
Manchmal fallen sie auch in den dichten Johannisbeerbusch, und man muß tief hineinkriechen, um sie zu finden. Und wenn der Baum von selbst nichts hergeben will, klettern die großen Brüder hinauf und schütteln: dann prasselt es von den Zweigen.
Mit dumpfem Aufschlag fällt hier und dort ein reifer Apfel auf den Erdboden. Man muß nur aufpassen, die richtigen Bäume und Verstecke kennen, wo sie am liebsten hinplumpsen: die Stachelbeersträucher, das Klettendikkicht, ja, manchmal rollen sie sogar bis zu den Erdbeerrabatten hinunter. Die rosa gemaserten Birnäpfel werden in den Frostnächten schon klar und durchsichtig, und wenn man sie gegen das Licht hält, sieht man die schwarzen Kerne wie hinter Glas. Aber die bekommt die Mutter. Und wenn einer besonders schön ist, muß Aurel ihn dem Vater bringen.
Der Vater beißt unbekümmert hinein und liest dabei die Zeitung.
„Sieh doch, wie durchsichtig …“
Aber dann ist nichts mehr zu sehen: nur der Stengel und das abgenagte Kerngehäuse – der Vater wirft sie über das Geländer der Veranda, ohne aufzublicken. Und greift wieder nach der Pfeife.
Grischa, der Apfelrusse, ist nun auch gekommen, hat im neuen Garten, zwischen den jungen Obstbäumen, ein richtiges Indianerzelt aus dicken Strohmatten aufgeschlagen, in dem er das Fallobst aufsammelt und am Tage, eingewickelt in einen Schafspelz, schläft. Denn nachts muß er wachen. Dann wandert er ruhelos zwischen den beiden Gärten hin und her, horcht, ob irgendwo der Zaun verdächtig knackt, irgendein Baum sich plötzlich zu schütteln anfängt. Einmal hat er sogar einen Apfeldieb, einen kleinen Burschen, gefangen. Er heulte und wurde zum Verwalterhaus geführt. Hier sollte er gezüchtigt werden. Aber die Mutter bat für ihn, und nun sollte er sich bei ihr bedanken. Heulend stand der Junge da, mit blanken Füßen vor der Veranda.
„Wenn du Äpfel haben willst“, sagte die Mutter, „dann brauchst du sie nicht zu stehlen!“
Und Karlomchen mußte ihm einen vollen Korb geben, den er kaum tragen konnte.
„Ob du ihm so das Stehlen abgewöhnen wirst?“ lachte der Vater.
„Sicher!“ meinte die Mutter zuversichtlich. „Wenn er Äpfel bekommt, wozu soll er sie dann noch stehlen?“
„Und wenn sich zwanzig Apfeldiebe fangen lassen?“
„Mein Gott, wir haben so viel Fallobst, das sonst verfault!“ seufzte die Mutter.
Aber jetzt, mittags, schnarcht der Apfelrusse in seiner dunklen Höhle.
Wenn man sich bückt und hineinschaut, kann man seine faltigen Stiefel und die plumpen fettigen Pumphosen sehen. Einmal, als Grischa ihm einen roten Apfel hinhielt, war Aurel sogar zu ihm hineingekrochen. Wie es da drin nach Äpfeln, Stroh, Zwiebeln und Schafsfell roch! Aber kein Wort konnte er verstehen, was der bärtige Russe mit den gelben Zähnen sagte, und so war er schnell mit dem roten Apfel wieder davongerannt.
Das nächste Mal behielt er den sonderbaren Klang der fremden Worte im Ohr:
„Jabloko, chotschesch Jabloko?“ hatte der Russe gefragt, als er ihm den Apfel hinhielt. Und dann verstand Aurel: „Jabloko“ heißt Apfel. Komisch. Wenn Janz oder Indrik „Abol“ für Apfel sagten, so war das kein großer Unterschied. Aber Jabloko – wie konnte ein gewöhnlicher Apfel einen so verrückten Namen haben? Oder waren die russischen Äpfel anders? Und die Russen selbst – sind das überhaupt richtige Menschen? Mit solchen komischen Hosen, die wie Säcke um die Knie fallen, und einem Pelz mitten im Sommer?
Einmal hatte Onkel Oscha gesagt: „Ich möchte so lange leben, bis der letzte Russe hinter Kamtschatka ersäuft!“ Ob dies der letzte Russe war? Und warum sollte er hinter Kamtschatka ersaufen? Das war wohl noch weiter als die Flachsweiche. Nein, der Apfelrusse soll lieber lebenbleiben, dann kann Onkel Oscha niemals sterben.
„Warum kann Grischa nicht richtig sprechen?“ fragte einmal Aurel die Mutter.
„Grischa spricht richtig, aber er spricht Russisch!“ sagte die Mutter, nahm einen Apfel aus dem großen Korb, der vor ihr stand, und schälte ihn. Sie saßen alle auf der Gartenveranda: die Mutter, Karlomchen, die schwarze Tina, Karlin, die alte Minna, und schälten Äpfel.
„Und warum spricht er Russisch?“ erkundigte sich Aurel weiter. „Wenn ihn doch niemand versteht?“
„Die Russen verstehen ihn schon“, lachte die Mutter, „und in Rußland wird man dich wieder nicht verstehen!“
Russen? Er war also doch nicht der letzte, stellte Aurel erleichtert fest: Onkel Oscha wird lange leben!
„Gibt es viele Russen?“ forschte er nach einer Weile, um ganz sicher zu sein.
„Viele, viele Millionen“, seufzte die Mutter und warf den geschälten Apfel in eine braune Tonschüssel.
„Und alle sprechen Russisch?“
„Ja, das tun sie, und du wirst auch einmal Russisch lernen!“ Die Mutter griff nach einem neuen Apfel.
„Warum?“
„Weil wir zu Rußland gehören“, sagte die Mutter nachdenklich und drehte den Apfel. In einer dünnen, langen Spirale hing die Schale über ihren Knien in die Luft.
„Und warum sprechen wir dann nicht Russisch?“
Die Mutter hielt im Schälen inne, blickte auf, und ihre Augen bekamen ein besonderes Leuchten. Dann sagte sie ernst und bestimmt:
„Weil wir Deutsche sind!“
Aber Aurel war damit noch nicht beruhigt; die Mutter mußte ihm ausführlich erzählen, wie einmal die Deutschen, richtige Ritter in blitzenden Rüstungen und mit Schwertern, das heidnische Land erobert, Letten, Liven und Esten zum Christentum bekehrt hatten und dann später von den Russen besiegt wurden; wie der General, dessen Bild im Lesezimmer hängt, so tapfer gegen die Russen kämpfte, daß Peter der Große ihn in seine Dienste nahm und ihm für alle seine Nachkommen versprach, daß sie die deutsche Sprache und den deutschen Glauben behalten sollten.
„Und darum sind wir deutsch und sprechen Deutsch!“ schloß die Mutter und schälte weiter.
Aber Aurel grübelte noch lange, und als er in seinem Gitterbett lag und die Mutter ihm nach dem Abendgebet den Gutenachtkuß gab, hielt er ihre Hand fest und fragte:
„Warum sprechen die Menschen so viele verschiedene Sprachen, und warum kämpfen sie?“
„Weil sie die Himmelssprache vergessen haben“, sagte die Mutter und hob langsam den Kopf, „einmal sprachen alle die Himmelssprache, aber dann bauten die Menschen einen hohen Turm, und jedes Volk wollte höher sein als das andere. Da vergaßen sie Gottes Wort, und nun versteht kein Volk das andere! Aber einmal –“, und die Hand der Mutter strich leise über das Haar des Jungen, „einmal werden alle wieder die Himmelssprache sprechen!“
„Auch Grischa?“
„Auch Grischa. Aber wir selbst müssen sie auch lernen!“
Aurel schlief beruhigt ein.
Aber dann kam ein Abend, den Aurel nie vergaß und der sich tief in sein Herz brannte.
Es war schon dunkel, als der Vater mit den großen Brüdern von der Jagd heimkehrte. Mickel blies auf dem Horn, draußen vor der Veranda, wo die Brettdroschke hielt. Die Brüder kamen aufgeregt ins Haus gelaufen, und dann rannte alles zum Eiskeller, die schwarze Tina, Karlin, Fömarie, und Aurel rannte mit. Fömarie war so erregt, daß sie ganz vergaß, Watte in die Ohren zu stopfen.
Und hier, auf dem kurzen, flachgetrampelten Kamillengrase, lag ein riesiges Tier ausgestreckt, so groß, wie Aurel noch nie eins gesehen hatte. Indrik hielt die Stallaterne in der Hand, und der gelbe Schein wanderte über einen mächtigen Rücken, über ein dunkelbraunes Fell, lange, schmale weiße Beine und einen gewaltigen merkwürdigen Kopf, mit gebogener Rammsnase, großen Ohren und spitzen Hörnern.
Mickel, der Buschwächter, hockte auf dem Tier und erzählte aufgeregt, wie und wo der Elch gelaufen war und wie der Vater ihn geschossen hatte. Er tastete mit den blutigen Händen das Fell ab, bohrte den Zeigefinger tief in ein schwarzes Loch, hob den schweren Kopf am Geweih, ließ ihn dumpf auf den Erdboden fallen, öffnete das riesige Maul, zerrte an der blauroten Zunge und zeigte die gelben Zähne. Und Waldi, Sagrei und Schamyl, die Jagdhunde, schnüffelten mit wedelnden Schwänzen und hängenden Zungen am toten Tier.
In dieser Nacht hatte Aurel einen furchtbaren Traum. Aus der Allee kam ein riesiger Elch gelaufen, so groß, daß er mit dem Geweih an die Äste des Ahorns stieß. Aber er lief nicht auf dem Weg um den runden Rasenplatz, sondern geradeaus über das Gras auf das Haus los. Er lief und lief, mit gesenkten Hörnern, und seine kleinen schwarzen Augen starrten mit bösem Blick auf Aurel, der vor der Veranda stand. Aurel wollte ins Haus laufen, aber er konnte sich nicht rühren, nicht einmal den Kopf zur Seite wenden, und der Elch kam immer näher. Schon hörte er ihn schnaufen, schon sah er seine großen gelben Zähne.
Aber dann war es plötzlich Grischa, der Apfelrusse, der über den Rasenplatz auf ihn zuging, und auch Grischa war so groß, daß er mit seiner Fellmütze an die Zweige des Ahorns stieß. Und sein Schafspelz verdeckte die ganze Allee, seine Pumphosen waren so breit wie der Platz, und seine faltigen Wasserstiefel zerstampften den Rasen. In der Hand hielt er aber einen roten Apfel, und er lachte mit seinen gelben Zähnen und fragte: „Jabloko, chotschesch Jabloko?“
Jetzt aber war es der Verrückte, der über den Rasen kam, mit seinem schwappenden, flachen Strohhut, den zerlumpten Hosen. Lallend schwang er seinen Stock, starrte mit bösem, verblödetem Blick auf Aurel und lief auf ihn zu. Und von allen Seiten kamen grunzende Schweine angerannt, wühlten den Rasenplatz mit ihren Rüsseln auf und zertrampelten das Gras. Aber plötzlich waren alle Schweine Wölfe geworden, mit aufgerissenen Rachen und hungrigen Augen. Auch der Verrückte trug ein Wolfsfell, und als er seinen Mund öffnete und seine blaurote Zunge und die gelben Zähne zeigte, war sein Maul so groß wie der Rachen des Elches.
Und jetzt wußte Aurel: es war der Wolfsmensch, der über den Rasenplatz auf ihn zukam, der Wolfsmensch, der Mila geholt hatte und der nun auch ihn fressen wollte. Und der Wolfsmensch und die heulenden Wölfe kamen immer näher – schon spürte Aurel ihren schnaufenden Atem im Gesicht …
Mit einem Schrei wachte der Junge auf. Minka, die Katze, saß schnurrend auf seiner Brust. Er zitterte am ganzen Körper und konnte sich nicht beruhigen.
„Warum träumst du so verrücktes Zeugs“, schalt ihn Fömarie, steckte sich Watte in die Ohren und drehte sich auf die andere Seite.
Aber Aurel lag noch lange wach, preßte die Katze an sein hämmerndes Herz und starrte mit kaltem Entsetzen in die unbarmherzige Finsternis. Endlich schlief er ein.