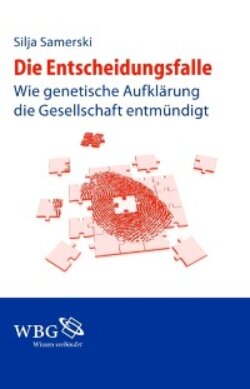Читать книгу Die Entscheidungsfalle - Silja Samerski - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.3.3 Ein neues Ziel: die informierte Entscheidung
ОглавлениеIm Laufe der 1970er und 1980er Jahre gelang es der genetischen Beratung, sich zu einem modernen Serviceangebot für schwangere Frauen und werdende Eltern zu mausern. Das Risiko- und Präventionsdenken hielt Einzug in die medizinische Schwangerenbetreuung und neue Untersuchungstechniken, allen voran der Ultraschall, schufen einen neuen Patienten: das Ungeborene. Der Fötus* und seine normgerechte Entwicklung rückten ins Zentrum der medizinischen Aufmerksamkeit. Ultraschalldurchleuchtung und Fortschritte bei der Chromosomendarstellung machten es Ende der 1960er Jahre möglich, mit einer Kanüle durch die Bauchdecke der Schwangeren Fruchtwasser zu entnehmen und kindliche Zellen auf ihre normgerechte Chromosomenausstattung zu überprüfen. Im Laufe der 1970er Jahre führten Gynäkologen und Humangenetiker den Chromosomencheck nach Fruchtwasserpunktion* in die Schwangerenvorsorge ein. Der Gesetzgeber lockerte das Abtreibungsrecht und ermöglichte den Schwangerschaftsabbruch nach der sogenannten „eugenischen Indikation“.48 Schwangere, die auf Anraten ihres Arztes eine Fruchtwasseruntersuchung durchführen ließen, befanden sich plötzlich in einem völlig neuen Zustand: Sie waren nicht mehr „guter Hoffnung“, sondern schwanger auf Probe. Bevor sie tatsächlich ein Kind erwarten konnten, musste der Test grünes Licht geben. Wies dieser hingegen eine chromosomale Normabweichung nach, dann wurden sie gedrängt, die Schwangerschaft abzubrechen. Stück für Stück wurde die genetische Überprüfung und Auswahl kommender Bürger alltäglich.
Den humangenetischen Instituten gab diese neue Selektionstechnologie großen Auftrieb. Der pränatale Chromosomencheck bescherte ihnen nicht nur eine neue Einkommensquelle im Chromosomenlabor, sondern auch eine neue Beratungsklientel: Ganzen Schwangerenkohorten drückten Ärzte plötzlich den Stempel „risikoschwanger“ auf und erklärten sie für „beratungsbedürftig“. Die statistische Wahrscheinlichkeit für eine Trisomie 21*, den chromosomalen Befund für das Down-Syndrom*, korreliert mit dem Lebensalter der Schwangeren. Diese ansteigende Wahrscheinlichkeit schrieben Mediziner zunächst allen Frauen ab 38 als sogenanntes „Altersrisiko“ zu, und nach der Erhöhung der Laborkapazität allen Frauen ab 35. Damit erklärten sie eine ganze Population gesunder Schwangerer zu Patientinnen, die einer medizinischen Sonderbehandlung bedürfen: des vorgeburtlichen Chromosomenchecks. In den 1980er Jahren wurden schließlich erste genetische Tests auf monogene Erbkrankheiten* entwickelt, durch die das Ungeborene nicht nur als Chromosomenträger, sondern auch als Genträger klassifiziert werden konnte.49 Die Zeit, in der Genetiker in erster Linie genetische Eheberatung betreiben konnten, war vorbei. Endlich hatten sie etwas Vielversprechenderes anzubieten als nur die missliebige Empfehlung, aufgrund statistischer Häufungen und Mendelscher Gesetze die Verlobung aufzulösen oder auf Kinder zu verzichten. Ganz zeitgemäß verhieß die Humangenetik nun „Wissen“, „Vorsorge“ und einen vorgeburtlichen Gesundheitscheck.
Die vorgeburtliche Qualitätskontrolle ist inzwischen zur Routine geworden: Praktisch jede Schwangere wird heute mehrfach mit dem Ultraschallgerät durchleuchtet, und eine große Zahl lässt sich anhand des Ersttrimestertestes* das Risiko einer fötalen Chromosomenstörung berechnen. Ungefähr jedes zehnte Kind, das in den vergangenen Jahren zur Welt kam, wurde vorher durch eine Fruchtwasseruntersuchung auf seinen normgerechten Chromosomensatz getestet.50 Diese intensive medizinische Überwachung einer gesunden Bevölkerungsschicht ist paradigmatisch für die neue Form der risikoorientierten Medizin, die Armstrong „surveillance medicine“ nennt (Armstrong 1995). Die Überwachungsmedizin, so Armstrong, unterscheidet sich grundlegend von der bisherigen Klinikmedizin. Erstens verwischt sie den Unterschied zwischen „normal“ und „pathologisch“, der bis dahin das ärztliche Denken und Handeln bestimmt hatte. Die Pränataldiagnostik erklärt alle Schwangeren für betreuungsbedürftig – auch, wenn ihnen gar nichts fehlt. Nicht mehr nur die Kranken sind Zielscheibe medizinischer Überwachung und Behandlung, sondern vor allem die gesunde Bevölkerung: „Surveillance Medicine requires the dissolution of the distinct clinical categories of healthy and ill as it attempts to bring everyone within its network of visibility“ (Armstrong 1995, 395). Zweitens geht es in der Pränataldiagnostik nicht mehr um Heilung, sondern um Risikomanagement. Ziel ist es nicht, eine abhandengekommene Gesundheit wiederherzustellen, sondern sich der Zukunft zu bemächtigen. „Surveillance Medicine […] attempt[s] to transform the future by changing the health attitudes and health behaviours of the present“ (Armstrong 1995, 402).
Diese Problematisierung des Gesunden und die Vorwegnahme der Zukunft haben besonders in der Schwangerschaft dramatische Auswirkungen. Vorgeburtliche Untersuchungen stellen einen Patienten her, dem nicht zu helfen ist. Er kann nicht geheilt, sondern nur abgetrieben werden. Wer jedoch kann eine solche Entscheidung treffen? Wer kann bestimmen, welche Diagnosen und Risiken ein Grund dafür sind, Menschen gar nicht erst auf die Welt kommen zu lassen? Bis in die 1995er Jahre fiel ein Schwangerschaftsabbruch nach pränataler Diagnostik unter die sogenannte eugenische bzw. embryopathische Indikation. Diese Indikation suggerierte, es könnte medizinische Gründe dafür geben, die Geburt von außergewöhnlichen Menschen zu verhindern. Tatsächlich war es bis in die 1980er Jahre üblich, dass Mediziner und Genetiker darüber urteilten, ob ein Kind angesichts seiner prognostizierten Entwicklungschancen geboren werden sollte oder nicht. Mit der Neufassung des §218 von 1995 ist die eugenische Indikation jedoch in der medizinischen Indikation aufgegangen, die einen Schwangerschaftsabbruch ohne zeitliche Befristung für straffrei erklärt, wenn damit „eine Gefahr für das Leben oder die Gefahr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung des körperlichen oder seelischen Gesundheitszustandes der Schwangeren“ abgewendet werden soll. Damit begründet das Recht die Legitimität des Abbruches nicht mehr mit der gesundheitlichen Normabweichung des kommenden Kindes, sondern mit der erwarteten Belastung für die Mutter. Auch wenn die Indikation von einem Arzt ausgestellt werden muss, hat der Gesetzgeber die Entscheidung damit auf die Schwangere abgewälzt. Sie muss nun unterschreiben, dass das Leben mit einem kranken oder behinderten Kind für sie, unter Berücksichtigung ihrer Lebensumstände, unzumutbar wäre. Sie soll sich also anhand der Laborbefunde das Leben mit dem kommenden Kind vorstellen und dann entscheiden, ob sie es überhaupt auf die Welt bringen möchte. Bei diesen Überlegungen muss sie sich von einem Mediziner anleiten lassen. Frauen sollen zwar selbst entscheiden, jedoch nur nach professioneller Beratung. Während Frauen, die kein Kind wollen, zur Schwangerschaftskonfliktberatung bei entsprechenden Beratungsstellen gezwungen sind, verpflichtet die Neufassung des Schwangerschaftskonfliktgesetzes, das 2010 in Kraft getreten ist, Frauen vor einem selektiven Abbruch zur Beratung durch einen Arzt. Damit soll sichergestellt werden, dass sie nicht einfach handeln, sondern eine „adäquate“ und „ausgewogene“ Entscheidung treffen (Bundesärztekammer und Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe e. V. 2009). Zudem müssen die Frauen eine dreitägige Bedenkzeit zwischen Beratung und Eingriff einhalten.51
Nicht nur vor einem Schwangerschaftsabbruch, sondern auch in Sachen Pränataldiagnostik hat der Gesetzgeber eine Beratungspflicht eingeführt. Seit Februar 2010 macht es das Gendiagnostikgesetz zur Pflicht, vor jeder pränatalen oder prädiktiven genetischen Untersuchung beim Humangenetiker vorstellig zu werden und einen entsprechenden Entscheidungsunterricht zu absolvieren. Auch hier möchte der Gesetzgeber sicherstellen, dass Schwangere informierte Entscheidungen treffen. De facto besteht diese Beratungspflicht schon seit den 1980er Jahren. Die deutsche Rechtsprechung hat nach und nach eine ärztliche Aufklärungspflicht in Sachen Pränataldiagnostik installiert – und zwar nicht nur für die Frauen, die sich testen lassen wollen, sondern potenziell für alle Schwangeren: Weist ein Frauenarzt seine schwangere Patientin nicht ausdrücklich genug auf die Wahrscheinlichkeit einer chromosomalen Normabweichung und entsprechende pränatale Testangebote hin, so läuft er Gefahr, im Falle eines behinderten oder kranken Kindes die Verantwortung übernehmen zu müssen – und zwar für dessen Existenz. Mehrfach wurden Frauenärzte und Genetiker bereits zu lebenslangem Unterhalt verurteilt, weil Frauen glaubhaft machen konnten, dass deren mangelhafte Aufklärung die Geburt ihres Kindes verschuldet hätte.52 Das Kind sei nur deshalb auf die Welt gekommen, so die Argumentation, weil sie nicht eindringlich genug auf Schwangerschaftsrisiken und pränatale Tests aufmerksam gemacht worden wären. Seither müssen Ärzte ihre Patientinnen über mögliche Fehlbildungen, Risiken und pränatale Check-ups aufklären, bevor sie überhaupt richtig schwanger sind. Ehe der Bauch richtig gewachsen oder die erste Kindsregung zu spüren ist, lernen Schwangere bereits, was alles schiefgehen könnte, welche Risiken sie eingehen müssen und welche Entscheidungen sie treffen sollen.53
Mediziner sind rechtlich auf der sicheren Seite, wenn sie ihren Patientinnen die pränatalen Tests einfach empfehlen. Das mag ein Grund sein, weshalb viele Frauenärzte ihre eigenen professionellen Richtlinien, nach denen die Frauen selbst entscheiden sollen, ignorieren. Sie drängen ihre Patientinnen zur Fruchtwasseruntersuchung und schließlich auch zum Schwangerschaftsabbruch (Braun 2006). Anders jedoch die humangenetische Zunft: Genetiker sind sehr darauf bedacht, alle anstehenden Entscheidungen an ihre Klientinnen weiterzureichen. Ausdrücklich vertreten sie den Beratungsgrundsatz, keine Empfehlungen auszusprechen. Ihre Aufgabe sehen sie darin, den Klientinnen zu einer Entscheidung zu verhelfen. Über diese Grundregel, im Fachjargon „Non-Direktivität*“ genannt, sind sich genetische Berater fast weltweit einig. Sie wird als emanzipatorische Errungenschaft gefeiert, als Abkehr von eugenischen Zielsetzungen und als Bollwerk gegen staatliche Bevölkerungspolitik. Markstein für diesen Übergang vom Paradigma der Prävention zum Paradigma der Entscheidung ist in Deutschland das Buch „Genetische Beratung: Hilfestellung für eine selbstverantwortliche Entscheidung?“, das der Humangenetiker Helmut Baitsch und die Psychologin Maria Reif gemeinsam verfasst haben (Reif und Baitsch 1986). Die Autoren verabschieden alle eugenischen und präventiven Bestrebungen und verkünden ein neues Ziel der genetischen Beratung: die selbstverantwortliche Entscheidung. Durch eine Mischung aus wissenschaftlicher Belehrung und psychosozialer Betreuung sollen Genetiker ihre Klienten dazu befähigen, eine „selbstverantwortliche Entscheidung, die sie verstehen und zu der sie auch längerfristig stehen können, zu ermöglichen“ (Reif und Baitsch 1986, 13). Sie sollen ihnen beibringen, auf der Grundlage von Genen, Chromosomen und Risiken eine Entscheidung zu fällen, die sie als die ihrige betrachten und für die sie sich selbst verantwortlich fühlen.54
Bis heute sind Schwangere, die zur Entscheidung über pränatale Testangebote befähigt werden sollen, die wichtigste Klientel der genetischen Beratung.55 Mit der Anzahl prädiktiver Gentests* wächst aber auch die Zahl derjenigen, die über einen genetischen Check-up entscheiden sollen, der ihnen ihre eigene Zukunft voraussagt. Die meisten solcher „voraussagenden“ Tests prophezeien kerngesunden Menschen eine beängstigende Erkrankung – und zwar in Form eines genetischen Risikos. Von seltenen Ausnahmen wie Chorea Huntington abgesehen, lassen sich von genetischen Befunden nur Wahrscheinlichkeiten ableiten, also statistische Häufigkeiten, die den Beratenen als Erkrankungsrisiken zugeschrieben werden. Der Test attestiert ihnen ein erhöhtes Risiko für Krebs, Hämachromatose, Alzheimer oder Schlaganfall. Da sich die genetische Forschung der Suche nach Risiko-Genen bzw. Suszeptibilitäts-Genen verschrieben hat, kommen vermehrt Gentests auf den Markt, die gesunden Menschen ein genetisches Risiko anhängen. Bereits vor Jahren haben Humangenetiker beschlossen, nur diejenigen genetisch zu testen, die sie vorher auch beraten haben (Berufsverband Medizinische Genetik e. V. 1996, Berufsverband Medizinische Genetik e. V. 1997). Das neue Gendiagnostikgesetz macht die genetische Beratung vor einem prädiktiven Test nun auch gesetzlich zur Pflicht. Allerdings drängen zunehmend private Unternehmen wie „DeCodegenetics“ oder das von Google gesponserte „23andMe“ auf den Markt, die Gentests an nationalen Gesetzen vorbei über das Internet anbieten. Doch auch hier sollen Beratung und Aufklärung Abhilfe schaffen. Um Bürger vor faulem Genzauber zu schützen, so die Forderung aus Wissenschaft und Politik, sollen sie zu aufgeklärten Konsumenten erzogen werden. Auch Otto Normalverbraucher, so die Hoffnung, könnte dazu befähigt werden, sich im Dschungel genetischer Verheißungen, genetischer Testangebote und genetischer Risiken zurechtzufinden. Damit er von Google nicht an der Nase herumgeführt wird, soll ihm beigebracht werden, informierte Entscheidungen zu treffen.
Ein dreiviertel Jahrhundert nachdem der Philanthrop Osborne von einer Gesellschaft träumte, deren Mitglieder eugenisch denken und handeln gelernt haben, ist genetische Aufklärung alltäglich. Zahlreiche Informations- und Beratungsveranstaltungen versuchen heute, Menschen zu genetisch informierten Entscheidungen anzuhalten. Im folgenden Kapitel nehme ich einen solchen Entscheidungsunterricht genauer unter die Lupe. Am Beispiel der genetischen Beratung untersuche ich, was Genetiker Bürgern beibringen, wenn sie diese über genetische Fehler, bedrohliche Risiken und genetische Testoptionen informieren. Der versteckte Lehrplan genetischer Aufklärung wird hier deutlich sichtbar: Genetiker und Laie sitzen sich direkt gegenüber und sprechen sich persönlich an. Ein genetischer Berater adressiert seine Aufklärung nicht an ein anonymes Publikum, sondern an ein konkretes Visavis. Beratungsklienten erwarten daher, dass der Experte Aussagen macht, die für sie verständlich und bedeutsam sind. Der Genetiker wiederum ist bemüht, seine Expertise so zu vermitteln, dass sie seinen Klienten relevant erscheint. Er verleiht seinem Fachwissen nicht nur lebensweltliche Bedeutung, sondern bezieht es auch persönlich auf seine Klienten. Am Beispiel der genetischen Beratung zeigt sich daher besonders deutlich, welche Form des Denkens und Handelns die genetisch informierte Entscheidung Bürgern abverlangt.
Zunächst werde ich aus Beratungssitzungen berichten, in denen Frauen für eine informierte Entscheidung über einen Darmkrebs- bzw. Brustkrebs-Gentest präpariert werden. Der genetische Entscheidungsunterricht spitzt sich zu, wenn das attestierte Risiko und der angebotene Test nicht die zukünftige Gesundheit der Klientin infrage stellen, sondern das Kommen ihres Kindes. Daher wende ich mich gegen Ende des dritten Kapitels vor allem genetischen Beratungsgesprächen zu, in denen eine Schwangere zur informierten Entscheidungsträgerin über ihr kommendes Kind gemacht wird.
Alle genetischen Beratungssitzungen, von denen ich berichte und aus denen ich zitiere, habe ich teilnehmend beobachtet und auf Tonband mitgeschnitten. Non-verbale Mitteilungen und Ereignisse habe ich in Protokollen festgehalten. Alle Zitate sind wörtlich meinen Beratungstranskripten entnommen (Transkriptkonventionen siehe S. 143). Die vier Gespräche über Brust- und Darmkrebs-Gentests fanden an einem Zentrum für tumorgenetische Beratung eines großen Universitätsklinikums statt. Die genetischen Beratungen mit Schwangeren konnte ich an der genetischen Beratungsstelle einer Universitäts-Frauenklinik sowie an einem universitären Humangenetischen Institut beobachten.56 Vereinzelt greife ich auch auf Ausschnitte und Formulierungen aus einem anderen Korpus an Beratungsgesprächen zurück, sofern mir diese besonders vielsagend oder illustrativ erscheinen. Auch diese habe ich an universitären genetischen Beratungsstellen beobachtet, mitgeschnitten und anschließend transkribiert.