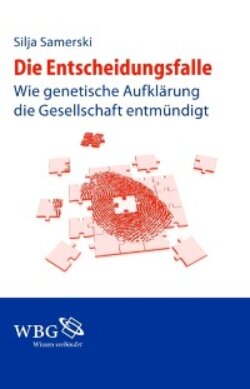Читать книгу Die Entscheidungsfalle - Silja Samerski - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление2.2 Die Aufklärungs-Kampagnen
2.2.1 Unmündige Bürger? Ein Bremer Kongress
„Gute Gene – schlechte Gene?“, lautete der Titel eines Bundeskongresses für politische Bildung, der Anfang September 2003 in Bremen stattfand.18 Drei Tage debattierten Vertreter aus Wissenschaft, Politik und Industrie über die „Chancen und Risiken der Gentechnologie“. Die Veranstalter, die Bundeszentrale für politische Bildung in Kooperation mit der Bremer Landeszentrale, sahen ein gentechnologisches Zeitalter angebrochen und hielten es für ihre Aufgabe, die Öffentlichkeit darauf vorzubereiten. „Die Biowissenschaften und die Biotechnologie lernen derzeit mit enormer Geschwindigkeit, fundamentale Lebensprozesse zu verstehen, zu steuern, ja zu verbessern“ (Bundeszentrale für politische Bildung 2003), wurde in der Ankündigung behauptet. Angesichts dieser beschworenen Machbarkeiten wollten die Förderer der politischen Bildung zur „aktive[n] Einflussnahme auf Entscheidungsprozesse“ befähigen (Bundeszentrale für politische Bildung 2003). Zu diesem Zweck luden sie drei Dutzend hochrangige Experten aus aller Welt nach Bremen ein: einen israelischen Molekulargenetiker, der mit dem ehemaligen Bundesjustizminister Hans-Jochen Vogel über die ethische Vertretbarkeit der Stammzellforschung diskutierte, einen Mediziner aus Nikosia, der vom kirchlich und staatlich durchgesetzten Eugenik-Programm auf Zypern berichtete, eine amerikanische Historikerin aus Philadelphia, die das zypriotische Zwangsprogramm anschließend rechtfertigte, und einen Humangenetiker aus Leuven in Belgien, der sich dafür einsetzte, dass Eltern „die Verantwortung für die Genetik der Kinder“ übernehmen. Begleitet wurde der Kongress von einem thematischen Kulturprogramm mit Filmen und Lesungen. Einen besonderen Gag erlaubten sich die Veranstalter im Bremer Ostertor-Viertel: Kurz vor Kongressbeginn öffnete dort der fingierte Gen-Shop „chromo'''soma“ seine Pforten, in dem neugierigen Passanten zahlreiche „genetische Produkte und Dienstleistungen“ feilgeboten wurden. Kunden konnten z. B. „gen'''max“ erwerben, um „verschüttetes genetisches Potenzial“ wiederzubeleben und das Lebensgefühl zu intensivieren, oder „book'''a'''baby“, das Angebot, einen Wunschembryo herzustellen und bis zum geeigneten Zeitpunkt zwischenzulagern.19
Die Bundeszentrale für politische Bildung ist eine Institution, die Bürger zu politischer Mitbestimmung anregen will. Ihre Aufgabe ist es, „Menschen in der Bundesrepublik Deutschland zu motivieren und zu befähigen, mündig, kritisch und aktiv am politischen Leben teilzunehmen“ (Bundeszentrale für politische Bildung 2010). Dieses Ziel verfolgten die Veranstalter auch mit dem dreitägigen Gen-Kongress: Sie beabsichtigten, das Thema Gentechnologie „in die breite gesellschaftliche Auseinandersetzung hineinzutragen“. Der öffentliche Disput, so wurde auf dem Abschlussplenum behauptet, habe einen hervorragenden „Beitrag zur Aufklärung und Emanzipation der Öffentlichkeit“ geleistet, der Bürger auf „dem Weg zu einem reflektierten Urteil“ unterstützen würde (Bundeszentrale für politische Aufklärung 2003).
Dieses Vorhaben, Bürger in Sachen Genetik zu „emanzipieren“ und zur Partizipation anzuhalten, fand die volle Unterstützung von Wissenschaft und Industrie: Bei der Kongresseröffnung im Bremer „Marriott-Hotel“ beklagten nicht nur die Veranstalter, sondern auch Genetiker und Pharmavertreter, dass die Bevölkerung in Sachen Genetik abgehängt sei. Sie würde nicht mitbestimmen, wo und auf welche Weise Gentechnologie zur Anwendung käme. Vor allem Frauen und andere Betroffene, hieß es, meldeten sich einfach nicht zu Wort. Die dreitägigen Sitzungen mit genetischen und bioethischen Experten sollten eine erste Abhilfe schaffen. Die Ursache für die fehlende demokratische Mitbestimmung war den Experten nämlich schon klar: Die Bevölkerung, so ihre Diagnose, sei in puncto Genetik schlichtweg zurückgeblieben. Was DNA, Vererbung und Gentests angeht, verharrten die meisten Menschen in Unwissenheit und Unmündigkeit. Meinungen hätten sie zwar schon, aber: Volkes Stimme war sowohl den Veranstaltern als auch den Experten zu unqualifiziert. „Wahrnehmungen“, beklagte der Leiter der Bremer Landeszentrale für politische Bildung, aber nicht „Wissen“ würden derzeit die Haltung der Bürger gegenüber der Gentechnik bestimmen. Und der Leiter des Bremer Zentrums für Humangenetik führte Vorbehalte gegenüber seinem Fach schlicht auf „Fehlinformation“ zurück: Überzogene Hoffnungen, behauptete er lapidar, führten zu überzogenen Befürchtungen. Er verschrieb seinen Mitbürgern daher Beratung und Aufklärung, um sie zu einem vernünftigen Umgang mit der Genetik zu befähigen. Bestärkt sahen sich die Experten durch die aktuellen Meldungen aus dem Gen-Shop „chromo'''soma“: Etwa ein Drittel der Kunden, berichteten die Betreiber aufgebracht, ließen sich die fingierten Produkte andrehen. „Der Wissensstand der Kunden war erschreckend niedrig“, empörte sich der Leiter des Ladens und beklagte eine „massive Aufklärungslücke“. Besonders mokierte er sich darüber, dass seine Kunden das Machbare nicht vom Fiktionalen unterscheiden könnten und „überhöhte“ Vorstellungen hätten. Daher forderte auch er Aufklärung und Beratung: Die fiktionalen Anteile, so hieß es, sollten zugunsten einer „richtigen“ Einschätzung und Bewertung der Genetik abgebaut werden.20
Doch nicht nur Wissenschaft und staatliche Bildungsinstitutionen, sondern auch die Industrie pochte auf einen aufgeklärten Bürger, der an einer „demokratischen Biopolitik“ beteiligt werden kann. Was sie sich davon verspricht, das machte der Pharmavertreter von Roche gegen Ende seines Vortrages sehr deutlich: Die „Verantwortung“ für die Gentechnik, so erklärte er, trage nicht die Industrie, sondern die Gesellschaft. „Die Gesellschaft muss entscheiden, wie sie mit der Gentechnik umgeht“, forderte er. Während seines Vortrages wurde schnell klar, dass sich die Industrie jedoch nicht einfach dem Willen der Bevölkerung unterwerfen will. Bisher, so monierte er, fehlten der Bevölkerung das „Wissen“ und die „Beurteilungsmöglichkeiten“. Die Gesellschaft, so machte er klar, müsse erst für ihre neue Aufgabe präpariert werden. Er sagte wörtlich: „Man muss der Gesellschaft helfen zu verstehen … Man muss der Gesellschaft erklären, wie sie es verstehen soll und wie sie entscheiden muss.“
Das Ziel, das sich die Bundeszentrale für politische Bildung gesteckt hatte, erreichte der Kongress nicht. Im Gegenteil: Eine öffentliche Auseinandersetzung blieb weitgehend aus. Zur Diskussion mit den anwesenden Bürgerinnen und Bürgern kam es nicht. Nur vereinzelt meldete sich nach den Vorträgen jemand aus dem Publikum zu Wort. Die Atmosphäre im Saal war die meiste Zeit eigentümlich gedrückt, ja geradezu gelähmt. Offenbar hatte es den meisten Zuhörern die Sprache verschlagen. Obwohl die Auftritte der Experten ja eigentlich zur Diskussion anregen sollten, waren sie nicht allgemein verständlich gehalten, sondern mit alltagsfernem Fachvokabular gespickt. Von „Zygoten“ vor und nach der „Kernverschmelzung“ war die Rede, von „Chromosomenaberrationen“, „Genen für“ verschiedenste unbekannte Krankheiten, von „Erkrankungswahrscheinlichkeiten“, „genetischen Dispositionen“ und „Risikoträgern“. Ganz selbstverständlich wurde davon ausgegangen, dass nicht mehr der Common Sense Ausgangspunkt einer demokratischen Auseinandersetzung ist, sondern die wissenschaftlichen Begriffe der Experten. Nicht das, was Bremer Bürger erleben, fürchten und wünschen, wurde hier besprochen, sondern wissenschaftliche Laborkonstrukte und bioethische Problemkonstellationen. Um Menschen und ihre Erfahrungen ging es in vielen Vorträgen nur dann, wenn die Genetiker durch mitleidsheischende Schicksalsberichte für Forschungsgelder und Deregulierung plädierten.
Der Bremer Kongress ist ein eindrückliches Beispiel für den Versuch, Bürger zur Mündigkeit in Sachen Genetik zu erziehen. Statt Hürden für die demokratische Mitbestimmung abzubauen, stellte er neue auf. Die Bundeszentrale für politische Bildung versammelte Experten, die erklärten, ihr Fachwissen sei eine notwendige Voraussetzung für eine demokratische Auseinandersetzung und die gesamte Bevölkerung daher beratungsbedürftig. Nur derjenige, der sich von Genetikern und Bioethikern im Denken unterweisen lässt, sollte in Bezug auf die Gentechnologie eine Stimme haben – und zwar nicht im Hinblick auf wissenschaftliche, sondern auf gesellschaftliche Fragen. Thema des Kongresses war ja nicht die fachgerechte Sicht auf Genfunktion und DNA-Struktur, sondern es sollte um die Auswirkungen einer neuen Technologie auf das menschliche Zusammenleben gehen. Und genau hier sprachen die Redner ihren Mitbürgern die Mündigkeit ab. Damit war jeder demokratischen Auseinandersetzung der Boden entzogen. Sprecher, die keine genetische und bioethische Schulung durchlaufen hatten, wurden für zurückgeblieben erklärt. Sie waren im Kongressprogramm auch gar nicht vorgesehen: Weder dem jahrelangen Protest von Anwohnern und Ökologiebewegten gegen die Freisetzung von genmanipuliertem Mais noch dem „Nein danke!“ der Frauen- und Krüppelbewegung zur vorgeburtlichen Selektion hatten die Veranstalter Gehör geschenkt. Stattdessen hatten sie als Hauptredner Vertreter aus Wissenschaft und Industrie geladen, die verlangten, das Denken und Handeln der Bürger an die Vorgaben der Gentechnologie anzupassen. Erst dann, wenn Bürger gelernt hätten, ihre Entscheidungen nach wissenschaftlichem Input zu treffen, wollten sie diese an einer „demokratischen Biopolitik“ beteiligen.