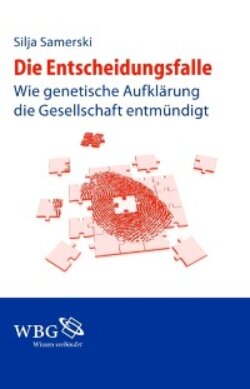Читать книгу Die Entscheidungsfalle - Silja Samerski - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1 Einleitung: Gene als Entscheidungsgrundlage?
ОглавлениеDie Anti-Matsch-Tomate aus dem Genlabor wird im Volksmund „Gentomate“ genannt und die manipulierten Lebensmittel der Gentechnik-Industrie „Gen-Food“. Wie Umfragen zeigen, gehen viele Menschen davon aus, dass eben dieses „Gen-Food“ Gene enthält, die Tomate aus dem eigenen Garten jedoch nicht.2 Über diese angebliche Ignoranz der Bevölkerung zeigen sich Genetiker und aufgeklärte Journalisten entsetzt. „Die Mehrheit weiß nicht, dass sie andauernd auf Genen herumkaut“, lamentiert ein Kommentator in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (Müller-Jung 2006). Und der hannoversche Pflanzengenetiker Hans-Jörg Jacobsen stellt sogar infrage, ob derart unwissende Bürger überhaupt demokratisch mitbestimmen können: Man fragt „sich unweigerlich, wie unsere demokratische Gesellschaft auf einer derartig schmalen und uninformierten Basis weitreichende Entscheidungen treffen will. Ein sachgerechter öffentlicher Diskurs erscheint somit in Frage gestellt und einseitigen ideologisch begründeten Festlegungen sind Tür und Tor geöffnet“ (Jacobsen 2001).
Dieses Lamento über eine unaufgeklärte Bevölkerung und die Notwendigkeit von „sachgerechter“ Information ist weit verbreitet. Im Zeitalter der Genetik wünschen sich Wissenschaft, Politik und Industrie einen Bürger, der an biopolitischen Debatten partizipieren und informierte Entscheidungen treffen kann. Die beklagte Unwissenheit der Bevölkerung möchten sie daher dringend beheben – und zwar durch Information und Aufklärung. Genetikunterricht an Schulen, in öffentlichen Laboren und in Diskussionsveranstaltungen sollen Bürger dazu befähigen, die Welt durch die Brille des Genetikers zu sehen. Sie sollen erkennen, dass Tomaten ebenso wie Menschen Genträger sind und darauf ihre Entscheidungen gründen.
Dieser Versuch, Bürger zu informierten Entscheidungen in Sachen Genetik anzuleiten, ist Thema dieses Buches. Ich möchte die Annahme infrage stellen, dass genetische Aufklärung zu einem eigenen, unabhängigen Urteil befähigen kann. Mir scheint vielmehr, dass genetische Aufklärung eine Freiheit verkehrt: die Freiheit, ohne Bevormundung selbst wissen und entscheiden zu können. Der einst emanzipatorische Aufruf, sich nicht bevormunden zu lassen, sondern sich seines eigenen Verstandes zu bedienen, verkehrt sich in die Pflicht zur informierten Entscheidung. In allen Lebenslagen werden Menschen heute dazu angehalten, professionelle Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, um sich in aufgeklärte Entscheidungsträger zu verwandeln: Krankenkassen mahnen ihre Kunden zur Eigenverantwortung und stellen Entscheidungshilfen ins Netz (Techniker Krankenkasse 2008), der Pharmakonzern Roche möchte aus Bürgern eigenverantwortliche Gesundheitsmanager machen (Höhler 2009), Diskursprojekte schulen für biopolitische Partizipation und am Krankenbett ermitteln Mediziner individuelle Gesundheitsvorstellungen und Therapiepräferenzen (Lupton 1995, Whatley und Worcester 1989). Als Immanuel Kant (1724 – 1804) im Jahre 1794 den Aufruf „Sapere aude!“ zum Leitmotiv der Aufklärung erhob, konnte er einen solchen Aufklärungs- und Beratungsbetrieb nicht vorhersehen. Damals gab es noch keine „Wissensgesellschaft“, in der industriell hergestellte Information als handfestes Wissen verkauft wird. Er konnte nicht ahnen, dass Bürgern einmal eine ganze Armee von Experten ihre Dienstleistungen aufdrängen würde, um sie zu sogenannten informierten Entscheidungen zu befähigen. Begriffe wie „Aufklärung“ und „Selbstbestimmung“, mit denen Kant noch zur Emanzipation von hergebrachten Autoritäten aufrief, sind heute zu Schlagwörtern einer neuen Sozialtechnologie1* verkommen.
Dass heute nicht mehr Zwang und Repression die vorherrschenden Formen von Machtausübung sind, sondern die Lenkung von Selbstbestimmung bzw. die „Führung der Selbstführung“, das haben die Gouvernementalitätsstudien bereits vielfach dargelegt (u. a. Bröckling, Krasmann, und Lemke 2000, Rose 1999). Aufbauend auf Michel Foucaults Arbeiten zu modernen Techniken der Menschenführung analysieren sie die Mobilisierung zu „Wissen“, „Eigenverantwortung“ und „Selbstbestimmung“ nicht als emanzipatorischen Fortschritt, sondern als neue Herrschaftsform. Diese Studien haben mir geholfen, den Aufruf zur informierten Entscheidung anhand von Genen und Risiken als Form der gesellschaftlichen Steuerung zu untersuchen. Ich konnte fragen, auf welche Weise genetische Aufklärung und Beratung als Sozialtechnologie funktioniert. Was wird von Bürgern gefordert, wenn Mündigkeit voraussetzt, die eigene Urteilskraft von Experten „updaten“ zu lassen? Gibt nicht die vermeintlich „sachgerechte“ Information bereits das Entscheidende vor, nämlich sowohl den Rahmen und die Grundlage der Überlegungen als auch die Entscheidungsmöglichkeiten? In welche Form des Denkens werden Bürger eingewiesen, wenn sie sich nicht mehr von erfahrbaren und umgangssprachlich fassbaren Wirklichkeiten bewegen lassen sollen, sondern von wissenschaftlichen Konstrukten wie Gen und Risiko?
Was ich untersuchen möchte, lässt sich als versteckter Lehrplan der genetischen Aufklärung bezeichnen. Ich frage nach dem, was die Belehrten jenseits des vermittelten Fachwissens lernen – über sich selbst, ihr Sosein, ihr Urteilsvermögen und ihre Pflichten als Bürger einer technologischen Gesellschaft. Diesen versteckten Lehrplan kann ich besonders gut dort analysieren, wo Expertenwissen und Alltag direkt zusammenkommen: Also dort, wo Genetisches und Biographisches, Dienstleistungsangebote und alltagsbezogene Wünsche, Wissenschaftsjargon und Alltagssprache3, technologische Rationalität und persönliche Sinngebung unmittelbar aufeinandertreffen. Ein solcher Ort ist die genetische Beratung. Bei der genetischen Beratung handelt es sich um eine professionelle Dienstleistung, durch die Laien zu Entscheidungsträgern in Sachen Gene und Risiken ausgebildet werden sollen. Ein- bis zwei Stunden instruiert ein Genetiker seine Klienten über DNA-Aufbau, Vererbungsregeln, Mutationen, Krankheitshäufigkeiten, statistische Risikoberechnung und genetische Testmöglichkeiten. Eine solche Beratungssitzung ist ein Musterbeispiel für den Versuch, Bürger zur Mündigkeit in Sachen Genetik zu erziehen. Ausdrückliches Ziel der Aufklärung ist die informierte Entscheidung – in der Regel eine Entscheidung darüber, sich selbst oder ein kommendes Kind genetisch testen zu lassen oder nicht. Fast drei Dutzend solcher Gespräche habe ich inzwischen teilnehmend beobachtet, mitgeschnitten und transkribiert; in fünfen davon werden Frauen bzw. ein Ehepaar für die Entscheidung präpariert, ob sie sich auf Krebsrisiken genetisch testen lassen. In den anderen, auf die ich hier eingehe, werden Frauen oder Paare über Schwangerschaftsrisiken aufgeklärt sowie über die Option, ihr kommendes Kind genetisch untersuchen zu lassen.
Distanzierung als Forschungsansatz
Wie lässt sich der versteckte Lehrplan genetischer Aufklärungsveranstaltungen untersuchen? Wie kann ich die verborgenen Denkzwänge, Suggestionen und unterschwelligen Aufforderungen in einem genetischen Beratungsgespräch erkennen? Die Gegenwart lässt sich am besten dann erforschen, wenn ich mich an ihr befremde. Würde meine Analyse auf den gleichen Grundannahmen aufbauen wie mein Untersuchungsgegenstand, dann liefe sie Gefahr, lediglich bestehende Selbstverständlichkeiten zu wiederholen. Bestaune ich selbst das „genetische Wissen“, glaube an die statistische Vorhersagbarkeit der Zukunft und halte die informierte Entscheidung für den Inbegriff von Autonomie, kann ich die zeitgeschichtliche Bedeutung genetischer Aufklärung nicht erfassen. Verwechsele ich selbst eine Korrelation mit einer Ursachenfeststellung, vermische ein statistisches Risiko mit der erlebbaren, konkreten Gefahr oder betrachte ein kommendes Kind als intrauterinen Genträger, so sitze ich dem Weltbild der Genetik bereits auf: Ich gestehe ihr genau diejenige Deutungsmacht über die Wirklichkeit zu, die Gegenstand meiner Analyse sein soll.
Meine zweigleisige Ausbildung als Natur- und als Sozialwissenschaftlerin ist mir dabei behilflich gewesen, eine kritische Distanz zur modernen Gen-Gläubigkeit einzunehmen. Sie hat mich vor zwei Fallen bewahrt, die bei der Erforschung der „Freisetzung genetischer Begrifflichkeiten“ drohen: Weder halte ich Gene und Risiken für objektive Tatsachen oder gar natürliche Sachen noch für Begriffe, deren Bedeutungen – wie bei umgangssprachlichen Wörtern – vom Sprecher bestimmt oder im Gespräch ausgehandelt werden können. Bereits während meines Biologiestudiums setzte ich mich mit der Eigenart biologischer Begriffsbildung auseinander, und meine Arbeit im zytogenetischen und molekulargenetischen Labor bescherte mir so manche Ernüchterung bei der Herstellung und Verbreitung des sogenannten genetischen Wissens. Während dieser Zeit wurde ich zur Grenzgängerin zwischen Biologie, Philosophie und Sozialwissenschaften, und das Hin und Her zwischen Labor und der Lektüre von Ludwik Fleck, Lorraine Daston und Barbara Duden hat sich als äußerst fruchtbar erwiesen. Mir ging auf, wie hypothetisch und kontextabhängig wissenschaftliche Tatsachen sind, wie präzise und beschränkt ihre fachinterne Gültigkeit ist und wie sehr sie sich verändern, wenn sie in den Alltag auswandern. Bereits damals nahm ich aus Neugier an genetischen Beratungsgesprächen teil und fertigte erste Gesprächsprotokolle an. Mich beschäftigte die Frage, wie ein Laborkonstrukt im Aufklärungsgespräch zu einem schicksalsträchtigen Verdikt wird. Eine veränderte DNA-Sequenz, also eine molekulare Variation, verwandelt sich in ein fatales „Gen für Zystische Fibrose*“ und stellt das Kommen des Kindes infrage; eine statistische Häufung mutiert zu einem Risiko, das einer Schwangeren schlaflose Nächte bereitet. Aus dieser Zeit meines Grenzgängertums habe ich also zwei grundlegende Einsichten mitgenommen: erstens die Einsicht, wie sehr wissenschaftliche Forschungsergebnisse auch durch Vorurteile, Versuchsaufbau, Drittmittelauflagen und Karrierebemühungen bestimmt werden, und zweitens die Erkenntnis, welche Kluft zwischen Labor und Lebenswelt liegt und welche Scheinwirklichkeiten entstehen können, wenn sie überbrückt werden soll.
Es ist jedoch nicht nur meine zweigleisige Ausbildung gewesen, die mir Distanz zu modernen Selbstverständlichkeiten verschafft hat. Je mehr ich versuchte, die Eigentümlichkeit von genetischen Zukunftsvorhersagen, professionellen Aufklärungsritualen und der Pflicht zur informierten Entscheidung zu begreifen, desto unerlässlicher schien mir ein historisches Bewusstsein unserer Zeit. Genetische Aufklärungs- und Beratungsveranstaltungen werden auf ganz neue Weise fragwürdig, wenn mir klar ist, dass es vor dem 20. Jahrhundert überhaupt kein professionelles Beratungswesen gab und sich dessen Ausbau nur im Zusammenhang mit der wachsenden Expertenmacht im Sozialstaat verstehen lässt. Ebenso kann ich erst dann begreifen, wie verrückt die Ermächtigung von Medizinern und Genetikern über die Sorge um das Kommende ist, wenn ich weiß, dass eine Schwangere bis vor wenigen Generationen „guter Hoffnung“ war und keinesfalls das „uterine Umfeld“ für eine „fötale Entwicklung“. Auch, wenn ich keine Historikerin bin und daher keinen „Ankerplatz“ in der Geschichte habe – die methodische Distanzierung, also der Versuch, mich „im Rückblick von der Vergangenheit her an der Gegenwart zu befremden“ (Duden 2002, 7), ist mir ein unerlässlicher Abstützpunkt für mein Denken geworden.
Die Aufklärung über Gene und genetische Risiken erscheint so lange natürlich, solange ich an die Allgemeingültigkeit und Bedeutsamkeit dessen glaube, was dort als Wissen vermittelt wird. Um den versteckten Lehrplan genetischer Aufklärung zu analysieren, muss ich mich daher von meiner Gen-Gläubigkeit befreien. Zuhilfe kommt mir dabei die zunehmende Fragwürdigkeit des Genbegriffs in der Wissenschaft. Im folgenden Kapitel werde ich kurz auf die wissenschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung des Gens eingehen, um deutlich zu machen, dass es sich beim Gen nicht um eine natürliche Sache, ja nicht einmal um eine wissenschaftliche Tatsache im Fleckschen Sinne handelt, sondern um einen wissenschaftlich begründeten Mythos. Anschließend will ich verschiedene Kampagnen und Bemühungen zur genetischen Aufklärung der Bevölkerung schildern und erste Beobachtungen über deren pädagogisches Programm festhalten. Im dritten Kapitel werde ich meine Leserinnen und Leser schließlich an Aufklärungsgesprächen teilhaben lassen, in denen Bürger durch genetisches Fachwissen zur Selbstbestimmung befähigt werden sollen. Ich werde sie in genetische Beratungsstellen führen, wo Genetiker Frauen und Paare über Gene, Risiken und Entscheidungsoptionen unterrichten. Am Beispiel dieser Sitzungen will ich Schritt für Schritt untersuchen, welchen versteckten Lehrplan genetische Aufklärungs- und Beratungsveranstaltungen haben, die Bürger zu informierten Entscheidungen anleiten.