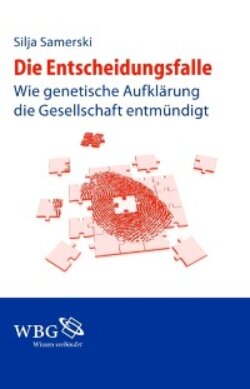Читать книгу Die Entscheidungsfalle - Silja Samerski - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3 Die informierte Entscheidung. Wie genetische Berater ihre Klienten zur Selbstbestimmung befähigen
ОглавлениеFrau M. sitzt im Beratungszimmer eines großen Universitätsklinikums einer Genetikerin gegenüber. Sie befinden sich mitten in einem Beratungsgespräch. Bis eben hat die Genetikerin Frau M. einer ausführlichen Befragung unterzogen: Einen ganzen Katalog an Fragen zu ihrer Gesundheit und zur Gesundheit ihrer Verwandtschaft hat sie ihr gestellt und sich dabei allerhand Notizen gemacht. Die Fragerunde ist jetzt abgeschlossen und die Genetikerin wechselt den Gesprächsmodus: Sie geht von der Befragung zur Belehrung über. Nun will sie ihre Klientin über Gene, Mutationen, Krankheitsrisiken und Testverfahren unterrichten: „Dann würde ich jetzt gerne mit Ihnen so’n bisschen die Diagnostik, überhaupt, was sind Gene, wie sieht so ’ne Vererbung aus, was bedeutet das und so weiter, durchgehen, ja?“ Frau M. ist Mitte vierzig und wurde von ihrem Hausarzt zur genetischen Beratungsstelle geschickt. Er empfahl ihr den Besuch in der Humangenetik, nachdem sie einen Polypen im Darm entfernen lassen musste und ihm von Darmkrebserkrankungen in ihrer Verwandtschaft berichtet hatte. Nun hofft sie, von der Genetikerin mehr über diese Krankheit, ihre eigene Anfälligkeit und über Vorsorgemaßnahmen zu erfahren. Mehrfach betont sie, dass sie gerne aktiv werden möchte, um der möglichen Erkrankung gezielt vorzubeugen. Schon ihre Mutter, so berichtet sie, hätte sie immer vor dem Darmkrebs in der Familie gewarnt: „Weil ich eben von meiner Mutter weiß, alle sind an Darmkrebs gestorben so um sie herum“, sagt sie und fügt hinzu: „Und das möchte ich nicht.“
Die Genetikerin führt regelmäßig genetische Beratungen durch. Sie ist eine junge Medizinerin in der Ausbildung zur Fachärztin für Humangenetik. Sie macht es zu ihrem Beruf, andere Menschen über Gene, genetische Risiken und genetische Testmöglichkeiten aufzuklären, um sie zu einer informierten Entscheidung zu befähigen. Fachlich hat sie sich nach ihrem Studium auf Chromosomen, DNA und Biostatistik spezialisiert, und aus dieser Perspektive schaut sie auf ihre Klientin. Dass sie diese nur informiert, ihr aber keinen Ratschlag gibt, diesen Beratungsgrundsatz hat sie bereits verinnerlicht. Während ihrer Belehrung gewährt sie Frau M. Einblick in die Welt ihres Fachwissens: Sie spricht über DNA, Basenpaare, triggernde Gene, Mutationen, mismatch-repairs und Krebshäufigkeiten. Anschließend klärt sie ihre Klientin darüber auf, dass sie die internationalen Kriterien für eine Hochrisikoperson erfüllt. Es bestünde also eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, folgert die Genetikerin, dass Frau M. eine Genveränderung haben könnte – wobei sie das „könnte“ besonders betont. Deshalb käme sie für einen genetischen Test infrage und müsse sich dringend den regelmäßigen Früherkennungsmaßnahmen unterwerfen. „Sicherheitshalber“, wie sie sagt. Der Test allerdings sei nur ein Angebot: Es läge ganz bei Frau M. sich zu überlegen, ob sie ihn machen lassen wolle oder nicht. Frau M. solle selbst entscheiden, wie sie mehrfach wiederholt, was für sie der „richtige Weg“ ist.
Die genetische Beratung hat das Ziel, die Selbstbestimmung von Frau M. zu fördern. Sie soll lernen, eine „autonome, selbstverantwortliche Entscheidung für oder gegen eine Untersuchung zu treffen“, wie es genetische Berater formulieren (Zoll 2009, 87).57 Zu diesem Zweck wird sie anderthalb Stunden über DNA, Krebsrisiken, genetische Analyseverfahren, onkologische Früherkennung und Entscheidungsoptionen informiert. Was Frau M. schließlich mit diesen Ausführungen anfängt, bleibt ihre Sache. Zumindest was den angebotenen Gentest angeht, möchte die Genetikerin keine Schlüsse aus ihrer Aufklärung ziehen. Das sei Aufgabe von Frau M., wie sie betont. „Informationen kann ich Ihnen vermitteln“, fasst ein Kollege einer anderen Beratungsstelle das Prinzip des genetischen Entscheidungsunterrichtes zusammen, „und wie Sie mit umgehen, entscheiden letztendlich Sie selbst.“