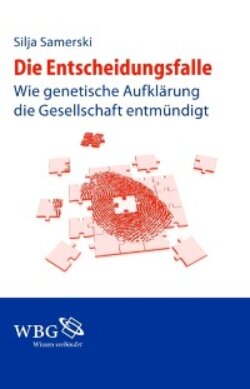Читать книгу Die Entscheidungsfalle - Silja Samerski - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление2 Genetische Aufklärung
2.1 Das Gen
Epochen erhalten meist einen Namen, wenn sie zu Ende gehen. Erst dann, wenn Selbstverständlichkeiten fragwürdig werden, gerät die Eigenartigkeit einer bestimmten Zeitspanne in den Blick. Evelyn Fox Keller hat das 20. Jahrhundert das „Jahrhundert des Gens“ genannt und ein kundiges Buch sowohl über den Aufstieg als auch über den Niedergang des Gen-Denkens in der Biologie geschrieben. In Berufung auf eine wachsende Zahl von Biologen und Genetikern kommt sie zum Schluss, dass das Gen als erkenntnisleitende Vorstellung ausgedient hat. Die These von definierbaren, steuernden und verursachenden Genen ist wissenschaftlich antiquiert (Keller 2001). Die Kritik des Genetikers Wilhelm Johannsen an der Gen-Gläubigkeit seiner Kollegen ist also heute so akut wie vor fast hundert Jahren. 1909 hob er den Begriff „Gen“ aus der Taufe und sah sich bereits kurze Zeit später genötigt, die um sich greifende Gen-Euphorie zu dämpfen. Die Vorstellung, es gäbe diskrete merkmalsbestimmende Erbeinheiten, „muß nicht nur als naiv, sondern auch als ganz und gar irrig aufgegeben werden“ – so Johannsens Mahnung im Jahre 1913 (Johannsen 1913, 144).
Johannsens Einwand fand Anfang des 20. Jahrhunderts kein Gehör, ist aber heute, fast ein ganzes Jahrhundert später, wieder hochaktuell: Immer mehr Genetiker räumen inzwischen ein, dass es nicht mehr vertretbar ist, vom Gen als diskretem Abschnitt auf dem Chromosom, als hinreichende Ursache für Krankheiten, als Baustein für den Organismus, als Träger von Information oder auch nur als Vererbungseinheit oder funktioneller Einheit zu sprechen.4 Vor allem die Ergebnisse des Humangenomprojektes* sind es gewesen, die auch eingefleischten Gen-Deterministen die unübersichtliche Komplexität von Entwicklung und Vererbung vor Augen geführt haben und deutlich machten: Die Vorstellung „von Genen als Ursachen“ ist „definitiv erschüttert“ (Keller 2001, 176). Neue Forschungen zeigen, dass es sich beim Gen für Trinksucht, geringe Intelligenz, Altersvertrottelung oder dicken Bauch um eine Reihe von Fiktionen gehandelt hat. Für das Verständnis biologischer Zusammenhänge, so fasst Keller zusammen, ist der Genbegriff nicht nur überholt, sondern sogar hinderlich geworden.
Wissenschaftliche Konzepte und Theorien kommen und gehen – diese Einsicht verblüfft heute niemanden mehr. Bereits im vorletzten Jahrhundert bekam der Glaube an den Fortschritt des Wissens und die Endgültigkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse erste Risse. Ende des 19. Jahrhunderts packte den französischen Mathematiker und Physiker Henri Poincaré wie viele seiner Kollegen der Schwindel, als er erkennen musste, wie kurzlebig wissenschaftliche Theorien sind, wie viele neue Beobachtungen jeden Tag hinzukommen und wie widersprüchlich und unvereinbar diese oftmals bleiben (Daston 2001, 213). Wenige Jahrzehnte später, in den 1920er und 30er Jahren, analysierte der Mediziner und Wissenschaftstheoretiker Ludwik Fleck in einer bis heute originellen Pionierarbeit die „Entstehung und Entwicklung wissenschaftlicher Tatsachen“ (Fleck 1980) als soziales Geschehen und bahnte damit den Weg zu einem sozial- und kulturgeschichtlichen Verständnis wissenschaftlichen Erkennens. Fleck machte deutlich, dass auch eine naturwissenschaftliche Tatsache ein sozial hergestellter „Denkzwang“ ist (Fleck 1980, 131) – ein Denkversuch, der sich schrittweise zu einer Wahrheit verdichtet und dann nur noch so und nicht mehr anders gedacht werden kann. Nicht nur die Drapetomania, der angeborene Fluchtzwang von Sklaven, die Freudsche Libido und die Hysterie des Weibes, sondern auch die Spirochäte als Syphiliserreger und die Normalverteilung der Statistik setzen eine bestimmte, sozial und kulturell bedingte Wahrnehmungsbereitschaft voraus, um denkbar und plausibel sein zu können. Diese unbewusste Ausrichtung des Denkens, „gerichtetes Wahrnehmen, mit entsprechendem gedanklichen und sachlichen Verarbeiten des Wahrgenommenen“, nennt Fleck „Denkstil“ (Fleck 1980, 130). Verändert sich der Denkstil, dann können wissenschaftliche Objekte, die bis dahin als felsenfest bewiesene Tatsachen angesehen wurden, entweder eine völlig neue Bedeutung erlangen oder einfach wieder verschwinden.5
Auch das Gen ist nichts anderes als ein sozial und kulturell hergestellter Denkzwang, der mehrere Generationen die Köpfe von Biologen, Medizinern, Bioethikern und Forschungspolitikern beherrschte. Bereits im 19. Jahrhundert, bevor die Wiederentdeckung Mendels endlich den Beweis für die Existenz von Erbeinheiten zu liefern schien, war das biologische Denken auf Gene eingestellt. Verschiedene Gelehrte, von Charles Darwin (1809 – 1882) über Francis Galton (1822 – 1911) und August Weismann (1834 – 1914) bis hin zu Hugo de Vries (1848 – 1935) hatten bereits Vererbungskorpuskel postuliert, und Mendel schien nur noch das zu belegen, was für naheliegend und offensichtlich gehalten wurde. Heute hingegen, im Zeitalter von „dynamischen Netzwerken“, „Interaktion“ und „irreduzibler Komplexität“ ist die determinierende Erbanlage endgültig veraltet. Der Denkstil unserer Zeit, von kybernetischen* bzw. systemtheoretischen Axiomen und Konzepten geprägt, hat sich schließlich auch in der Genetik niedergeschlagen und aus der Entität „Gen“ ein emergentes Konstrukt des zellulären und organismischen Systems gemacht. Alles, was ein ganzes Jahrhundert das wissenschaftliche Denken über das Lebendige bestimmte, ist heute antiquiert.6 Wir befinden uns an einer „Wasserscheide“ in der Biologie (Beurton, Rheinberger und Falk 2000, ix), die längst nicht alle Biologen, geschweige denn die Öffentlichkeit zur Kenntnis genommen haben.7 Und mit dieser Wasserscheide hat das Gen, wie auch andere wissenschaftliche Tatsachen, sei es das Phlogiston8 oder das Bohrsche Atommodell, nun eine Geschichte mit Anfang und Ende. Eine Zeitlang war es ein plausibles und nützliches wissenschaftliches Konzept, das sich zur erkenntnisleitenden Tatsache verdichtete, bis es neuen Hypothesen und Theorien weichen musste.9
Im Unterschied zum Phlogiston oder Bohrschen Atommodell hat das Gen jedoch nicht nur innerhalb der Wissenschaft eine abenteuerliche Karriere hinter sich, sondern auch außerhalb. Es hat nicht nur Forschung und Theorien bestimmt, sondern auch Politik gemacht, die Medizin umgekrempelt und grundlegende kulturelle Vorstellungen besetzt. Gene, so haben Genetiker glauben gemacht, sind das A und O des Lebens. Sie determinieren das Werden eines Menschen, sein persönliches Sosein, seine Gesundheit und seine Krankheiten. Sie sind, so das Gen-Credo, verantwortlich für den Knoten in der Brust und bedingen das nervöse Nägelkauen oder den dicken Bauch (Duden und Samerski 2007); sie binden die Mutter ans Kind und verschulden die männliche Untreue; sie prophezeien den verminderten IQ des Ungeborenen und das kommende Siechtum der Zwanzigjährigen. Und so viel, wie das Gen zu erklären scheint, so viel verspricht seine Erforschung und Manipulation: Als Bausatz der Gentechnologen verheißt es Bakterien, die den industriellen Giftmüll fressen, und begrünte Wüsten, auf denen satte afrikanische Kinder spielen; und in den Laboren von Hoffmann-LaRoche verspricht es individuelle Gesundheitscocktails und neue Allheilmittel gegen Krebs, Gebrechlichkeit, Altern und Tod. „Die Gene sind heute ja alles. Da herrscht ein fundamentalistischer Glaube“, so bringt der Biochemiker Erwin Chargaff die moderne Gen-Gläubigkeit auf den Punkt (Chargaff 2001, 249).10
Gen-Gläubigkeit ist jedoch nicht einfach ein vermeidbarer Nebeneffekt der genetischen Forschung, sondern ihre existenzielle Grundlage. Das Definieren, Diagnostizieren und Patentieren von sogenannten Genen ist Big Business. Die Pharma- und Agrar-Industrie, die wissenschaftliche Forschung und der wachsende Dienstleistungsmarkt der Pränataldiagnostik*, der Gentests und der Bioethik leben vom Glauben ans Gen.11 Genetiker räumen zwar ein, dass die bisherigen Gen-Vorstellungen „naiv“ waren (Klein und Venter 2009), leiten aus dieser Erkenntnis jedoch nichts anderes als vermehrten Forschungsbedarf ab. Sie machen sich auf die Suche nach einer neuen Form von Genen: nach probabilistischen Genen oder Suszeptibilitäts-Genen*. Auf der Grundlage der Datenlawinen, die in den Genlaboren produziert werden, konstruieren sie statistische Korrelationen* zwischen genotypischen* und phänotypischen* Merkmalen, die dann als Suszeptibilitäten oder Dispositionen gedeutet werden. Hypothesen über Krankheitsentstehung und Krankheitsursachen sind dafür nicht nötig. Als bioinformatische* Konstrukte stehen diese Gene für Zusammenhänge, die rein statistisch sind. Auf dieser Grundlage verkünden Genetiker weiterhin die Entdeckung von „Genen für“, sei es für das Altern, Schwulsein, Sprechen, Rauchen oder das „Gottes-Gen“.12 Sie befördern einen neuen genetischen Pandeterminismus, in dem das Gen zwar nicht mehr als alleinige Ursache gilt, aber als vermeintlicher Mitverursacher überall eine Rolle spielt – ganz gleich, ob frühzeitige Vertrottelung, Schulversagen, Grippe oder Freitod.13
Auch wenn der Genbegriff in der Forschung ausgedient hat, wird das Gen-Gerede noch lange nicht verstummen. Um es aufzugeben, dazu ist „Gen“ als Kürzel im Fachgespräch zu praktisch, als didaktisches Mittel zu eingängig, als Verkaufsschlager zu profitträchtig und als Propagandainstrument zu wirksam. Dass Gene nicht nur in der Biologie von Nutzen sind, sondern auch in Politik und Gesellschaft, ist kein neues Phänomen. Noch bevor die Existenz von Erbeinheiten überhaupt als bewiesen galt, lieferten die Vorläufer des Gens bereits Stoff für Machbarkeitsfantasien und Heilsversprechen. Vererbungswissenschaftler wie Francis Galton oder Alfred Ploetz (1860 – 1940) bemühten sich Ende des 19. Jahrhunderts nicht nur um die Klärung naturwissenschaftlicher Fragen, sondern auch um eine Neuordnung der Gesellschaft. Mit ihren genetischen Erkenntnissen wollten sie dazu beitragen, eine wissenschaftlich begründete Sozialordnung zu schaffen. Die „Mendelschen Einheiten“, die Johannsen 1909 „Gene“ nannte, rückten die Vision von einer rationalen Fortpflanzungspolitik, die Familiengründung und Kinderkriegen nicht mehr dem Einzelnen überlassen würde, in greifbare Nähe. Denjenigen, die sich nicht an die Erfordernisse der Industriegesellschaft anpassten, unterstellten Vererbungsforscher krankhafte oder schädliche Gene und taten sie als biologischen Ausschuss ab. Ob Landstreicher, Faulenzer, Siechender, Säufer, Krüppel oder andere Sonderlinge – diejenigen, die das Bild einer modernen, rationalen Gesellschaft störten, wurden als genetisch minderwertig abgestempelt und sollten entweder durch medizinische und pädagogische Maßnahmen adaptiert oder durch Einsperrung, Sterilisation oder Euthanasie ausgesondert werden.14
Die Zeiten, in denen das Gen zur Stigmatisierung und Aussonderung unliebsamer Bevölkerungsgruppen diente, sind vorbei. Heute ist das Gen kein Instrument autoritärer Bevölkerungspolitik mehr, sondern ein Instrument zur Mobilisierung der Bürger. Es wird als Grundlage einer aktiven, selbstverantwortlichen Lebensgestaltung angepriesen.15 Nur wer genetisch aufgeklärt ist, so verkünden Wissenschaft, Politik und Industrie, kann ein mündiger Bürger sein und sein Schicksal in die eigene Hand nehmen. Verschiedene genetische Aufklärer, von Genetikern und Industrievertretern über Wissenschaftsjournalisten und Kommunikationsexperten bis hin zu Sozialwissenschaftlern, Ethikern und Werbeagenturen versuchen, Bürger über das Innenleben ihrer Zellkerne zu unterrichten und sie im Abwägen von Chancen und Risiken zu schulen. Zum einen, so die Begründung für diese Mobilisierung, werden Genfood und Gentests in wenigen Jahren alltäglich sein. Und wer in einer genetisierten16 Gesellschaft nicht abgehängt werden will, der muss über DNA, Gentechnik, Risiken und ethische Dilemmata Bescheid wissen. Zum anderen, so die Verheißung von vielen Genetikern und anderer Gen-Gläubigen, führe genetische Aufklärung zur Selbsterkenntnis und Selbstbestimmung. So, wie alle Tomaten Gen-Food sind, meinen sie, sind alle Menschen Genträger. „Genetisches Wissen“ betrachten sie daher als Conditio sine qua non für Selbstbestimmung und Mündigkeit. „Respect for autonomy actually leads to […] the obligation to pursue genetic knowledge“, fordert beispielsweise die Ethikerin Rosamund Rhodes (1998, 17). Geht es nach ihnen, so stehen die Begriffe „Selbstbestimmung“ oder „Autonomie“ ausschließlich für die Pflicht, informierte Entscheidungen zu treffen.17