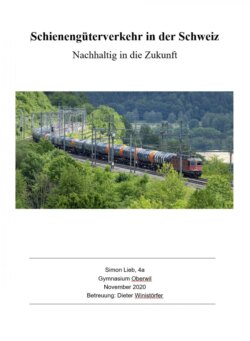Читать книгу Schienengüterverkehr in der Schweiz - Simon Lieb - Страница 7
Оглавление4.3 Güterverkehrspolitik
In diesem Kapitel wird die Güterverkehrspolitik in der Schweiz betrachtet. Dabei geht es um das Regulativ auf der Strasse und um die Förderung des SGVs in der Fläche. Weiter wird kurz auf den Ausbau der Eisenbahninfrastruktur und die Verlagerungspolitik im alpenquerenden Güterverkehr eingegangen.32
4.3.1 Verkehrspolitische Instrumentarien im Strassengüterverkehr
Im Vergleich zu den Nachbarländern wird in der Schweiz ein grosser Teil des Güterverkehrs auf der Schiene abgewickelt. Dies ist insbesondere dem geltenden Regulativ im Strassengüterverkehr zu verdanken. Darunter fallen als wichtigste Bestandteile das Nacht- und Sonntagsfahrverbot für Lkws, die Gewichts- und Grössenbeschränkungen (40-Tonnenlimite), das Kabotageverbot und die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA). Das Nachtfahrverbot ermöglich dem SGV den konkurrenzlosen Nachtsprung, indem Güter über die Nacht zu ihrem Ziel transportiert werden. Mit dem Kabotageverbot dürfen keine ausländischen Unternehmen im Schweizer Binnenverkehr tätig sein, was aufgrund der geringeren Arbeitsstandards im Ausland für den SGV gefährlich wäre. Die LSVA schliesslich ist eine Abgabe, die die berechneten, externen Kosten des Strassengüterverkehrs zu etwa einem Drittel internalisiert (vgl. Kapitel 6). Dabei ist die maximale Höhe für eine Transitfahrt durch die Schweiz vertraglich mit der EU auf 325 Franken festgelegt und die Höhe ist abhängig von der Euro-Kategorie. Um den KV zu fördern, wird die LSVA im Vor- und Nachlauf als Pauschale rückerstattet.
4.3.2 Verkehrspolitische Instrumentarien im SGV in der Fläche
Während im alpenquerenden Güterverkehr die Verlagerung von der Strasse auf die Schiene in der Verfassung festgeschrieben ist, besteht im SGV in der Fläche kein eigentlicher Verlagerungsauftrag. Trotzdem gibt es verschiedene Förderinstrumentarien. Dabei verfolgt der Bund das Ziel, die für den SGV notwendige Infrastruktur bereitzustellen und mit den Rahmenbedingungen einen eigenwirtschaftlichen Betrieb zu ermöglichen.
Die finanzielle Förderung des SGVs in der Fläche wird durch das Gütertransportgesetz (GüTG) geregelt, das 2016 totalrevidiert wurde. Der Bau, die Erweiterung und die Erneuerung von privaten Anschlussgleisen und KV-Terminals wird jährlich mit 50-60 Mio. Franken gefördert. Dabei darf der Investitionsbeitrag des Bundes 60% der Kosten nicht überschreiten. Zudem werden die Beiträge nur vergeben, wenn pro Tag mindestens zwei Wagen transportiert werden und bei KV-Terminals ein diskriminierungsfreier Zugang Dritter gewährleistet wird.
Die weiteren Anlagen des SGVs, konkret das öffentliche Schienennetz, Freiverlade und Güterbahnhöfe, sind Teil der öffentlichen Infrastruktur und werden wie im Personenverkehr über Leistungsvereinbarungen mit der SBB Infrastruktur gefördert.
Auch können neu Investitionen in technische Neuerungen finanziell gefördert werden. Dazu stehen 10 bis 15 Mio. Franken pro Jahr für den SGV und Personenverkehr zur Verfügung.
Mit dem GüTG wurden direkte Betriebsabgeltungen zuhanden der SBB Cargo im Umfang von etwa 30 Mio. Franken bis 2019 vollständig abgebaut. Der Bundesrat wollte die SBB auch von der Pflicht entbinden, Güterverkehr anzubieten, was aber vom Parlament abgelehnt wurde. Nur noch Schmalspurbahnen wie die RhB werden bei Beteiligung der Kantone direkt subventioniert. Zudem besteht eine Anschubfinanzierung bei neuen Angeboten.
Neben der finanziellen Förderung des SGVs gibt es weitere wichtige Bestimmungen. So wurde zusammen mit dem GüTG mit dem Konzept für den Gütertransport auf der Schiene die Entwicklung, Planung und Finanzierung der SGV-Anlagen konzeptionell festgelegt, um die für den SGV erforderliche Infrastruktur raumplanerisch zu sichern. Zur selben Zeit wurden mit dem Netznutzungskonzept und Netznutzungsplan Instrumente geschaffen, um die davor geltende Priorisierung des Personenverkehrs bei der Trassenvergabe zu beenden und für den SGV Trassen zu sichern.
Um den Eisenbahnlärm zu reduzieren, werden seit dem Jahr 2000 lärmarme Güterwagen gefördert und erhalten beim Trassenpreis einen Lärmbonus. Zudem gelten ab 2020 Emissionsgrenzwerte für alle Güterwagen, die auf dem Schweizer Netz verkehren (Verbot der lauten Graugussbremsen). Weiter werden auch Lärmschutzwände und Schallschutzfenster finanziert.
Bevor auf den Ausbau der Eisenbahninfrastruktur eingegangen wird, ist noch anzumerken, dass der SGV seit 1999 liberalisiert ist und freier Netzzugang herrscht, das Schienennetz also jedem EVU unter Abgabe eines Trassenpreises offensteht (vgl. Kapitel 5.3.3).
4.3.3 Ausbau der Eisenbahninfrastruktur
Mit der FABI-Vorlage, die 2014 zur Abstimmung kam, wurde der Bahninfrastrukturfonds (BIF) geschaffen und der davor geltende FinöV-Fonds ersetzt.33 Der BIF ist ein zeitlich unbefristeter Fonds, durch den einerseits Betrieb und Unterhalt sowie andererseits der Ausbau der Bahninfrastruktur finanziert wird. Ausserdem wurden die Abläufe und Zuständigkeiten geregelt und die Gütertransportbranche wird miteinbezogen. Die Finanzierung erfolgt zum grössten Teil über allgemeine Bundesmittel, die LSVA, die Mehrwert- und Mineralölsteuer. Jährlich entspricht dies rund 5 Mia. Franken. Der Ausbau verläuft im Rahmen des Strategischen Entwicklungsprogramms (STEP) schrittweise in den sogenannten Ausbauschritten, die alle vier oder acht Jahre vom Parlament beschlossen werden («rollende Planung»). Dabei stehen für den jeweiligen Ausbauschritt finanzielle Mittel aus dem BIF zur Verfügung. Entsprechend der Höhe der Mittel können Ausbauprojekte umgesetzt werden. Bis 2050 sind rund 40 Mia. Franken für Ausbauten vorgesehen. Die Höhe der finanziellen Mittel wurde anhand der prognostizierten Nachfrageentwicklung bestimmt. Dabei richtet der Bund den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur vor allem auf die prognostizierte Nachfrageentwicklung aus, mit dem Ziel, Engpässe zu vermeiden.
Der Ausbau und die Finanzierung des Nationalstrassennetzes verläuft gleich wie bei der Schieneninfrastruktur. So sind bis 2030 über 13 Mia. Franken für Ausbauprojekte geplant.34
Für das aktuelle Eisenbahnpaket, den Ausbauschritt 2035, wurden 2019 12,89 Mia. Franken bewilligt (vgl. Abbildung 11). Für den Güterverkehr soll ein Ausbau der Trassen und insbesondere der Expresstrassen für kürzere Transportzeiten resultieren. Damit soll schweizweit ein Güterexpressnetz aufgebaut, auf der Ost-West-Achse der Halbstundentakt und die Einschränkungen während der Hauptverkehrszeiten des Personenverkehrs reduziert werden. Die meisten Ausbauprojekte dienen jedoch vor allem dem Ausbau der Angebote im Personenverkehr.
| Abbildung 11: Projekte des Ausbauschrittes 203535 |
Auch in den letzten Jahren wurde mit Bahn 2000, NEAT, ZEB und weiteren Programmen viel Geld in die Eisenbahninfrastruktur investiert, wobei diese Ausbauten vor allem auf den Personen- oder Transitverkehr ausgerichtet waren.
4.3.4 Exkurs: Verlagerungspolitik im alpenquerenden Güterverkehr
Der alpenquerende Güterverkehr betrifft zwar vor allem den Transitverkehr. Da dort aber ein umfassendes Verlagerungsinstrumentarium besteht, ist es auch für den SGV in der Fläche interessant, diesen kurz zu betrachten.36
1994 wurde die Alpeninitiative in einer Volksabstimmung angenommen. Im anschliessenden Gesetz wurde festgelegt, dass der Strassentransitverkehr 2009 (später auf 2018 verschoben) auf maximal 650`000 Fahrten reduziert werden muss. Grund war die stark steigende Umweltbelastung entlang der Gotthardverkehrsachse im Alpenraum in Folge des schnell zunehmenden Strassengüterverkehrs nach dem Bau der Gotthard-Autobahn mit dem Strassentunnel.
Um dies zu erreichen, wurden verschiedene politische Massnahmen ergriffen: Mit der LSVA wurde eine Lenkungsabgabe eingeführt, um Strassentransporte zu verteuern. Doch da gleichzeitig aufgrund der EU im Rahmen der Bilateralen Abkommen die Gewichtslimite der Lkws von 28 auf 40 Tonnen angehoben werden musste, wurden deren Effekte fast vollständig kompensiert. Weiter werden Investitionsbeiträge an KV-Umschlagsanlagen gesprochen und nicht kostendeckende Angebote im KV an die Operateure abgegolten. Um zu verhindern, dass auf der Strasse die Arbeits-, Sicherheits- und Umweltstandards unterschritten werden, werden zudem sogenannte Schwerverkehrskontrollen durchgeführt, bei denen die Lkws kontrolliert werden.
Eine der wichtigsten Massnahmen ist zudem der Bau der NEAT mit den Basistunneln am Gotthard, Ceneri und Lötschberg, welche die Transitachse zu einer Flachbahn machen. Die Folge sind höhere Kapazitäten für den SGV, kürzere Strecken und Fahrzeiten sowie das Entfallen der Schiebelok bei den steilen Bergstrecken, was zu Produktivitätssteigerungen führt. Weiter wird auch der Ausbau der Zulaufstrecken im Ausland finanziell gefördert, da die Verlagerung des Transitverkehrs stark von den Bedingungen im Ausland abhängt. Zudem wird momentan die Gotthardachse für Lkws mit Eckhöhen bis 4 Meter ausgebaut (4-Meter-Korridor), um für diese mehr Kapazitäten bereitstellen zu können.
Weitere Massnahmen mit Wirkungen auf den Transitverkehr waren die Liberalisierung des SGVs und die Erhöhung der Interoperabilität (Harmonisierung technischer Standards) zwischen den nationalen Eisenbahnsystemen, welche im Transitverkehr für Effizienzgewinne und Qualitätszuwächse gesorgt haben.
Auch wiederholt diskutiert wurde eine Alpentransitbörse, welche die Überfahrtsrechte beschränken und versteigern würde. In Folge würde sich der Preis am Markt bilden und die Anzahl Alpenquerungen begrenzt werden. Doch muss dies aufgrund dem Landverkehrsabkommen der Bilateralen mit der EU verhandelt werden.
Trotz dieser Massnahmen wurden die Fahrtenziele wiederholt verfehlt (vgl. Abbildung 12). So wurden 2009 statt 650`000 Lastwagenfahrten 1,18 Millionen gezählt und auch 2018 waren es noch 941`000. In diesem Jahr wurden 39,6 Mio. Tonnen Güter durch die Alpen transportiert (1985: 16,7 Mio. Tonnen), davon 70,5% auf der Schiene, wovon wiederum die SBB Cargo einen Marktanteil von 65% hält.
| Abbildung 12: Entwicklung alpenquerender Güterverkehr auf der Strasse37 |