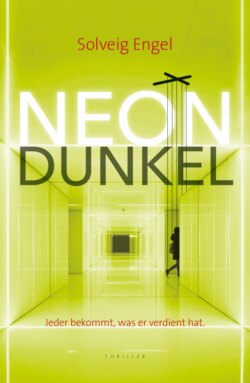Читать книгу Neondunkel - Solveig Engel - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Freitag, 27. Februar
ОглавлениеIch sitze in meinem Büro und starre auf den Bildschirm. Ich kann einfach nicht fassen, was ich dort lese. Wieder und wieder zwinge ich meine Augen dazu, den Buchstaben zu folgen. Aber sie streifen über die Zeichen, ohne ihre Bedeutung zu entziffern. Der Sinn ihrer Worte entgleitet mir, bevor ich ihn fassen kann. Es kann nicht sein. Es darf einfach nicht wahr sein, was dort steht.
George ist tot.
Phils E-Mail ist kurz und knapp, als hätte er sie in großer Eile getippt, Helvetica, Fontsize 12. Das erkenne ich sofort, als würde sich mein Verstand in den Details verhaken, um so dem schrecklichen Inhalt zu entfliehen.
Der Raum um mich herum dreht sich. Ich fühle mich wie damals vor 27 Jahren, gefangen in einem dichten Strudel aus Bildern, mein ganzes bisheriges Leben zeitgleich, im Zerrbild meiner Erinnerung. Ich sehe die unzähligen Stunden, Tage, Wochen und Jahre alle seltsam synchron, parallel zueinander. Ein schauriges Hologramm meines Lebens. Mein altes Kinderbett mit der bunten Bettwäsche. Der leblose Körper meiner Mutter. Meine Schwester und ich mit Schleifen im Haar. Mein Doktorhut. Rüdiger, tot. Der weiße Sarg meiner Mutter. Rosengestecke auf Eichenholz. Auf einmal wird mir klar, dass Zeit eine Illusion ist, zumindest die Zeit, an die ich bislang geglaubt habe, der einfache, geradlinige Verlauf der Dinge, wo ein Jahr dem anderen folgt, eine Erinnerung der nächsten. Wenn Zeit tatsächlich existiert, dann unabhängig von mir und dem Leben mit all seiner Vergänglichkeit. Was bedeutet schon vorher oder nachher, wenn es am Ende irgendwann sowieso passiert? In der Erinnerung verschwimmen die einzelnen Ereignisse zu einer grellbunten Collage. Ihre Chronologie wird unbedeutend.
Diese Erkenntnis trifft mich wie ein Meteorit und wirft mich aus meiner Bahn. Marionettenhaft hänge ich im zeitlosen Raum, unfähig mich aus eigenem Antrieb zu bewegen. Nur die Details, die unbestreitbaren Kleinigkeiten sind es, die mir einen zerbrechlichen Halt geben.
So war es auch damals. 52. Das war die Zahl, das unbeirrbare Detail. 52, nicht 51 oder 53, genau 52 bunte Pillen waren es, die um meine Mutter verstreut lagen. 24 blaue, 13 gelbe und 15 rote auf schwarz-weiß gekacheltem Boden. Ich habe sie gezählt. Ich habe auf den toten Körper meiner Mutter gestarrt und konnte nicht fassen, was ich dort sah. Also habe ich mich auf die Tabletten konzentriert. Blaue, gelbe und rote. Nur grüne waren nicht dabei. Ich weiß noch, dass ich meinen Vater gefragt habe, wo die grünen Pillen seien. Aber er hat mich nicht verstanden. Doch aus irgendeinem Grund hatte ich das Gefühl, dass es wichtig war, dass es die grünen Tabletten waren, auf die es ankam. Vielleicht hat es etwas mit dem verworrenen Harmoniebedürfnis eines kleinen Mädchens zu tun. Blau, gelb, rot und grün. Es gibt immer alle vier Farben. Im Buntstiftset, die Spielfiguren bei ,Mensch Ärgere Dich Nicht‘ und sogar die Saftgläser in der Küche. Vielleicht hätte ich meine Schwester fragen sollen. Sie hätte mich verstanden. Aber Kati war aus irgendeinem Grund nicht da. Später habe ich die Frage vergessen. Eigenartig, dass sie mir jetzt wieder einfällt.
„Wieso gab es keine grünen Tabletten?“, murmle ich laut vor mich hin und versuche mich an meiner eigenen Stimme festzuhalten.
„Er hat sie vertauscht“, tönt die Antwort aus dem Nichts. Der Ton ist klar und überaus deutlich, eine helle, freundliche Stimme, deren Klang mich umgehend aus meiner Starre reißt.
Vor Schreck springe ich auf, sodass meine Knie gegen die Tischplatte stoßen und mein Schreibtischstuhl rückwärts gegen die Fensterwand schlägt. Adrenalin pulsiert in meinen Adern. Mein Herz hämmert so fest, dass ich glaube, es ebenfalls zu hören. Ich fahre herum, lasse den Blick durch mein Büro schweifen. Doch da ist niemand.
Was war das? Wer war das?
Ruhig! Ich muss mich zusammenreißen. Wieder klar denken. Ich bin in meinem Büro. Es ist noch früh, gerade 7 Uhr 30. Um diese Zeit bin ich normalerweise allein. Und trotzdem diese Stimme. Ich habe sie so deutlich gehört, wie das Ticken der alten Buffetuhr auf meinem Schrank. Ich habe mir das nicht eingebildet. Oder doch?
Einfach weiter atmen. Das hilft.
Nach dem dritten Luftzug schaue ich mich sorgfältig im Zimmer um. Gewissenhaft lasse ich meinen Blick über die Bücherregale gleiten, die sich unter der Last unzähliger Fachbücher über Astronomie, Kernphysik, Messtechnik und Chemie biegen. Ein Board nach dem anderen suche ich ab. Ich bücke mich und schaue unter meinen Schreibtisch, wo drei Paar Schuhe durcheinander liegen. Hinter dem Drucker finde ich die Verpackungsreste eines Schokoriegels und die Verschlussringe mehrerer Cola-Dosen. Aber sonst entdecke ich nichts. Nicht einmal auf dem Tisch mit dem Wasserkocher, an der Pinnwand mit den Fotos oder zwischen den Grünpflanzen auf der breiten Fensterbank kann ich etwas erkennen, kein versteckter MP3-Player, kein Handy, kein Lautsprecher. Nichts, mit dessen Hilfe sich vielleicht jemand einen Scherz erlaubt haben könnte. Selbst die Fenster sind geschlossen. Vorsichtshalber öffne ich die Tür und werfe einen Blick hinaus in den Flur. Aber ich bin allein. Außer mir ist niemand hier.
Gerade hat Mel vor mir gestanden, die Augen aufgerissen wie ein verschrecktes Tier. Nun rast sie wie eine Irre durch ihr Büro vom Schreibtisch zu den Bücherregalen und zurück. Sie beugt sich vor, schaut unter den Tisch, wühlt in einem Berg verschiedener Schuhe, zieht Bücher, Fotos und Reiseandenken von den Regalbrettern. Sie tastet die Fensterbank zwischen unserem Blumendschungel ab und prüft die Bürotür. Das kann nur eines bedeuten: Sie hat mich gehört. Mich! Meine Stimme! Kann das tatsächlich sein?
Ich bin so glücklich. Am liebsten würde ich Luftsprünge machen, Räder schlagen, meine Arme um sie werfen und Mel ganz fest drücken. Mein allerallergrößter Wunsch ist endlich wahr geworden. Zumindest fast. Denn sehen kann sie mich nicht, sonst könnte sie sich diese Suche sparen. Ich stehe ja direkt neben ihr. Aber das ist nicht so schlimm. Wichtig ist, dass sie mich überhaupt bemerkt hat. Endlich!
Jetzt wird alles anders. Wenn sie mich hört, kann ich ihr alles erzählen. Wir können miteinander reden, zusammen plaudern wie echte Freundinnen. Nur sie und ich. Dann wird es wieder schön werden, so wie früher. Denn ich kenne Mel besser als jeder andere. Ich weiß fast alles über sie, was sie fühlt, was sie denkt. Und jetzt kann ich ihr erzählen, was ich fühle und denke und alles, was ich weiß. Wir können zusammen Bücher lesen, Filme anschauen, Witze machen, die nur wir verstehen. Wir kochen, was wir mögen, kuscheln uns zusammen in unseren Lieblingssessel unten im Labor, planen unser nächstes Experiment und kümmern uns nicht um den Rest der Welt. Denn wir haben uns. Mel wird sich nie wieder einsam fühlen – und ich auch nicht. Von jetzt an sind wir wieder zu zweit.
Aber noch während ich hier stehe und mich freue, werde ich auf einmal unsicher. Mel hetzt durch ihr Büro, als wäre ein böser Geist hinter ihr her. Dabei war ich es, die ihr geantwortet hat. Außer uns ist niemand hier. Hat sie mich falsch verstanden? Habe ich etwas Blödes gesagt? Ich habe doch nur ihre Frage beantwortet.
Ich glaube, ich habe sie erschreckt. Vielleicht weil sie mich nicht sehen kann. Das muss es sein. Ich wünschte, ich könnte sie fragen. Aber so, wie sie vor mir auf und ab rennt, wie ein Tier im Käfig, fürchte ich mich davor, sie wieder anzusprechen. Ich will ihr doch keine Angst machen.
Und deshalb werde ich traurig. Ich meine, ich habe mich so auf diesen Moment gefreut, dass ich nie darüber nachgedacht habe, wie es für Mel sein würde. Das war natürlich dumm. Ich habe einfach geglaubt, dass sie sich genauso freuen würde wie ich, mich nach all den Jahren wiederzutreffen. Das ist doch logisch, oder?
Vielleicht ist es auch nicht logisch. Wahrscheinlich braucht sie Zeit, um sich an mich zu gewöhnen. Für sie bin ich ja eine Fremde, also nicht ganz fremd, aber eben aus dem Gedächtnis verdrängt. Wenn ich darüber nachdenke und mir ihre Situation vorstelle, kann ich ihren Schreck sogar ein bisschen verstehen.
Ich löse meine Zöpfe und flechte sie neu, während ich überlege, was ich jetzt tun kann. Ich glaube, das Beste wäre es, erst einmal gar nichts zu machen. Mel muss erst wieder zur Ruhe kommen. Dann kann ich auf einen guten Moment warten und es noch einmal versuchen. Das klingt vielleicht blöd. Aber eine bessere Idee habe ich nicht.
Ich brauche also Geduld. Noch mehr Geduld. Immerhin weiß ich jetzt, dass der Moment kommen wird. Die unsichtbare Wand, die uns trennt, hat einen Riss bekommen. Vielleicht nicht heute, aber bald, sehr bald, werde ich wieder mit Mel sprechen. Und dann wird sie mich verstehen und einsehen, dass sie keine Angst vor mir haben muss, weil ich ihre allerbeste Freundin bin. Nein ich bin viel, viel besser als eine Freundin, besser als eine Schwester. Ich bin sie. Ich bin ein Teil von ihr, ihre zweite Hälfte. Sie ist Mel, ich bin Anni. Und nur zusammen sind wir Melanie.
Ich muss schlafen. Wieder zur Ruhe kommen. Gerade habe ich mir tatsächlich eingebildet, eine Stimme zu hören. Bestimmt bin ich an meinem Schreibtisch eingenickt, ohne es zu merken. Das passiert mir in letzter Zeit öfter. Wahrscheinlich habe ich geträumt. Natürlich war es so. Eigentlich ist es auch kein Wunder. Im Moment wird mir alles zu viel, der Lehrstuhl, die Forschung und die ganzen Gedanken, die durch meinen Kopf strömen. Jetzt auch noch diese Nachricht. Ich brauche dringend Urlaub. Nur dafür ist im Moment keine Zeit. Das einzige, was mir vielleicht Trost spenden kann, ist ein starker Kaffee und eine kräftige Schulter.
Mit meiner Lieblingstasse in der Hand mache ich mich auf den Weg zum Theorieflügel. Es ist fünf vor acht. Die Bürotür meines Vaters steht offen.
„Mel?“, ruft er erstaunt, als ich mich hineinschiebe.
Er blickt von seiner Lektüre auf. Ich glaube, er liest gerade die neue Veröffentlichung von Yamakuras Arbeitsgruppe.
„Was verschafft mir die Ehre zu solch früher Stunde?“
„Hast du es schon gehört?“, frage ich und lasse mich auf den Stuhl vor seinem Schreibtisch fallen.
Er schüttelt den Kopf und nutzt die Gelegenheit, seine Brille zu putzen. „Nein, was denn?“, fragt er und betrachtet mich besorgt.
Wenn ich nur annähernd so aussehe, wie ich mich gerade fühle, muss mein Anblick ziemlich übel sein.
„George ist tot“, erkläre ich ohne Umschweife.
Mein Vater starrt mich an und sagt nichts. Vielleicht ist er geschockt. Natürlich ist er geschockt. Aber ich weiß nicht, wie ich diese Nachricht hätte besser verpacken können. Wie kann man den Tod eines Menschen beschönigen, eines gesunden, aktiven Mannes, der mitten im Leben stand, große Pläne hatte und vor zwei Monaten noch den Nobelpreis verliehen bekam? Es ist einfach unfassbar, traurig und entsetzlich. Doch all diese Worte kommen mir abgenutzt vor. Sie treffen nicht den entscheidenden Punkt. Denn die Wahrheit ist noch viel schlimmer. Die Wahrheit ist: Sein Tod macht mir Angst.
„Ein großer Verlust“, sagt mein Vater schließlich, und ich nicke stumm.
Wenn ich ehrlich bin, war George von den Dreien nicht gerade mein Favorit. Ich habe ihn geschätzt, sehr sogar. Er war ein hervorragender Wissenschaftler. Er hatte vielleicht nicht die impulsive Genialität eines Rüdiger Neuhaus oder die überlegene Ruhe eines John Dalen, aber er hatte ein unglaubliches Fachwissen und einen messerscharfen Verstand. Zusammen mit seiner steifen Art ließ ihn das manchmal arrogant wirken, keine Frage. Ein sehr geduldiger Mensch war er nicht. Besonders Kollegen, die nicht seine Gabe hatten, bekamen seine Überlegenheit schnell zu spüren. Ich denke, er meinte es nicht so. Er war einfach sehr korrekt, geradezu penibel. Jede mathematische Gleichung überprüfte er mindestens dreimal. Keine vage Vermutung entkam seinem Blick. Jede Aussage musste durch hieb- und stichfeste Daten untermauert werden. Wenn man mit ihm zusammenarbeiten wollte, war das nicht immer leicht. Aber genau dieser Umstand machte unsere Daten später glaubwürdig. Ich denke, Georges Beteiligung an den Messungen war ein Grund für den Nobelpreis. Niemand aus der wissenschaftlichen Community hätte seine Ergebnisse je angezweifelt. Sein Name auf einer Veröffentlichung war wie ein Gütesiegel.
„Wie ist es passiert?“
Ich starre in meinen Kaffee und zucke mit den Schultern. Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Vielleicht stand die Antwort irgendwo in Phils E-Mail, vielleicht auch nicht. Welchen Unterschied würde es machen?
„War er krank?“, überlege ich laut. „Du hast ihn letzte Woche doch gesehen. Oder?“
Mein Vater nickt, sagt aber nichts. Also starre ich weiter in meinen Kaffee.
„Gut“, höre ich schließlich meinen Vater flüstern und schaue irritiert auf. „Wir müssen nach vorne schauen“, fügt er erklärend hinzu. „Ich denke, du solltest dich darauf einstellen, in nächster Zeit einige Anfragen zu beantworten.“
„Was denn für Anfragen?“, frage ich verwirrt.
Ich habe Trost gesucht, jemanden, der mir versichert, dass der Tod zum Leben gehört, dass alles gut wird. Aber mein Vater ist mir wie immer viele Schritte voraus.
„Nach einem Nobelpreis ist es üblich, dass die Preisträger zu Vorträgen, Talkrunden, Gesprächen et cetera eingeladen werden“, erklärt er so langsam, als würde er mit einem Kind sprechen. „Das muss ich dir wohl nicht erklären. Natürlich fragen sich jetzt alle, was das Besondere an eurem Experiment war, wie ihr auf die Idee gekommen seid, welche kleinen Erfolge euch den Weg geebnet haben, lustige Anekdoten. Du weißt schon, die ganze Litanei.“ Er wedelt gelangweilt mit der Hand. „Die Presse will wissen, was die Herren Nobelpreisträger zum Klimawandel, dem Artensterben und der Politik im Nahen Osten denken. Ihr“, sein Zeigefinger schießt auf mich zu, „steht im Rampenlicht.“
„Ihr?“
„Da Rüdiger und George jetzt ausfallen, wird die Aufgabe bei dir und John liegen.“
„Ich bin kein Nobelpreisträger“, widerspreche ich stumpf und ignoriere den immer noch auf mich gerichteten Zeigefinger.
„Nein, du hast den Nobelpreis nicht erhalten. Aber du warst dabei. Niemand kennt das Experiment so gut wie du. Du weißt besser, was ihr gemessen habt, als Rüdiger, George und John zusammen. Du weißt, was George und Rüdiger gedacht haben und was sie denken würden.“
Ich merke, dass sich in meinem Kopf ein Karussell zu drehen beginnt und konzentriere mich auf die Schafe auf meiner Tasse: 16. 16 Schafe in kunterbunten Farben. Sie sind mein Anker. Neben dem Henkel grast Lucky Woolly, Kleeblätter in der grünen Wolle. Happy Woolly - gelb. Chatty Woolly - rot.
„Das ist für dich eine großartige Chance. Das weißt du hoffentlich“, höre ich die Stimme meines Vaters.
Mir ist schwindelig. Die Schafe verschwimmen vor meinen Augen. Dann fasse ich mich wieder. Sleepy Woolly - blau-weiß gestreift, Crazy - pink …
„So schlimm ist es doch gar nicht.“
Ich sehe auf.
Mein Vater beobachtet mich durch seine Brille, als würde er auf eine Antwort lauern. „Ich denke, eine Vortragsreise ist genau das Richtige. Immerhin kommst du mal raus.“
„Das kann ich nicht!“
„Du hast schon mehr Vorträge auf Konferenzen gehalten als die meisten deiner Kollegen.“
„Das war vor Fachpublikum. Ich habe über meine Arbeit gesprochen, nicht über das Artensterben und Abrüstungsverträge.“
„Mel, du übertreibst.“ Mein Vater runzelt die Stirn. „Erzähl den Menschen von eurem Experiment.“
„Aber für eine ganze Vortragsreise habe ich gar keine Zeit“, wehre ich ab. „Diese Vorträge müssen gut vorbereitet werden, sehr gut. Die Menschen erwarten eine Menge von einem Nobelpreisträger – selbst von seiner minderbemittelten Mitarbeiterin.“ Ich weiß gar nicht, was Rüdiger erzählt hätte und was nicht. Wie George tickt, kann ich nur raten. Unser Experiment war streckenweise völlig chaotisch, kein glatter Siegeszug, wie die Leute vielleicht glauben. Es gab unzählige Pannen, blöde Fehler, Streit und Peinlichkeiten. Soll ich darüber etwa auch sprechen? Ganz zu schweigen von diesen politischen Fragen. „Wie soll ich mich im Namen meiner verstorbenen Kollegen zum Klimawandel und der Kernenergie äußern? Ich kann das nicht. Das ist mir alles zu viel.“
„Unsinn. Du arbeitest nur zwei Vorträge aus, einen für Fachpublikum und einen für Laien. Die kannst du dann, wenn es sein muss, ein bisschen strecken oder kürzen.“ Er lächelt. „Am Ende bestimmst du, wie viel du sagst. Wenn jemand dich einlädt, machst du die Regeln. Zeig Selbstbewusstsein. Du machst ein paar Witze, präsentierst schöne Aufnahmen von irgendeinem Sternsystem, und alle sind glücklich.“
„Ich bin glücklich, wenn ich in meinem Labor bin.“
Mein Vater wirft mir einen langen Blick zu. Dann holt er tief Luft. „Mel, wie stellst du dir das eigentlich vor? Den Lehrstuhl gibt es nicht mehr, jedenfalls nicht mehr lange, wenn du dich nicht bald darum kümmerst.“ Er seufzt. „Rüdiger hat eine Professorenstelle hinterlassen. Eine W3-Professur! Glaubst du, die lässt sich jemand entgehen? Denkst du, die Speichellecker auf dem Jubiläumsempfang des Rektors letzte Woche waren wegen der Freigetränke da? Dieser kleine Zögling von Enrico Roggero, wie heißt er noch?“
„Basilio Busini.“
„Busini. Genau. Er hat ziemlich lange mit dem Dekan geredet. Ich möchte wetten, dass es dabei nicht um die nächste Sommerschule in Neapel ging. Lauri Korhonen habe ich dort getroffen, angeblich weil er sowieso gerade hier in der Nähe Urlaub gemacht hat. Otto Mannström, der Festkörperphysiker, und er sind alte Freunde. Lauri hat bei der Gelegenheit gewiss ein gutes Wort für seinen Postdoc eingelegt. Ebenso wie Gustav Petermann. Er wird gute Gründe haben, wenn er innerhalb eines Monats gleich zweimal zusammen mit Tobi Neuer aus München anreist. Nein, Kleines, die Geier kreisen bereits.“
„Rüdiger ist gerade ein paar Wochen tot.“
Mein Vater schweigt für einen Moment, und ich nutze die Chance, den letzten Kaffee aus meiner Tasse zu schlürfen. Er ist kalt.
„Kennst du die Gleichstellungsbeauftragte?“
„Nina Bender?“
Mein Vater nickt. „Die Rothaarige.“
„Ja, wir kennen uns. Ich glaube, wir haben zusammen in irgendeiner Kommission gesessen. Sie ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin bei deinen Kollegen in der Theorie III.“
„Gut, dann solltest du dich mal wieder mit ihr treffen. Geht zusammen essen.“
„Warum?“, frage ich verwirrt.
„Weil sie, wenn die Professur ausgeschrieben wird, auf jeden Fall der Besetzungskommission angehören wird. Und wenn du nicht …“
„Aber …“
Mein Vater wischt meinen unausgesprochenen Einwand mit einer Hand vom Tisch.
„Genau. So weit muss es gar nicht kommen“, erklärt er und lächelt eigenartig.
„Was meinst du?“, frage ich, obwohl ich nicht sicher bin, ob ich die Antwort wissen will.
„Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Normalerweise werden freie Professuren öffentlich ausgeschrieben. Das ist ein großes Prozedere. Es kann Jahre dauern, bis das durch ist. Dabei ist nicht gesagt, dass dein geliebtes Labor nur eine neue Leitung bekommt. Wenn du Pech hast, wird nicht einmal ein Astrophysiker auf Rüdigers Stelle berufen. Es kann gut sein, dass der Lehrstuhl an die Plasmaphysik geht oder die Leute sich plötzlich für einen zweiten Hadronenphysiker stark machen. Dann war es das.“
Ich merke, dass mir plötzlich kalt wird. Natürlich kenne ich die Regeln. Ich habe selbst schon in einer Besetzungskommission gesessen, vor ein oder zwei Jahren. Aber da ging es um einen anderen Lehrstuhl, eine fremde Arbeitsgruppe. Das war etwas anderes. Unter einem neuen Professor könnte ich weiter arbeiten. Vorausgesetzt er ist Astrophysiker, oder kommt zumindest aus der Kernphysik. Doch der Gedanke, dass unser Labor durchaus geschlossen werden könnte, das Equipment ausgeschlachtet und verkauft, weil der neu berufene Institutsleiter einer ganz anderen Fachrichtung angehört, raubt mir die Luft.
„Nein“, höre ich mich ausstoßen. Meine Stimme klingt heiser, als wäre sie die einer Fremden.
Mein Vater nickt. „Genau. Wir müssen versuchen, diesen ganzen Zirkus zu umgehen. In Ausnahmefällen, wenn dadurch verhindert werden kann, dass ein renommierter Wissenschaftler die Uni verlässt, also jemand, der für das Fach von besonderer Bedeutung ist, kann, soweit ich weiß, auf das ganze Verfahren verzichtet werden.“ Mein Vater ist aufgestanden und zieht mit sicherem Griff ein Taschenbuch aus dem Regal. „Hochschulgesetz, Paragraph 38.“ Er blättert durch die Seiten. „Hier: Die Entscheidung über einen Verzicht der Ausschreibung trifft das Rektorat auf Vorschlag der Fakultät und nach Anhörung der Gleichstellungsbeauftragten.“ Er schaut auf. „Da hast du es.“ Mein Vater klappt das Buch wieder zu. Ich spüre, wie sich sein Blick durch meine Augen bohrt, als würde er direkt in meine Gedanken eindringen. „Und deswegen wirst du dich zum Mittagessen mit Frau Bender treffen.“
Als Mel und ich endlich allein sind, ist es Abend.
Den ganzen Tag war die Hölle los. Die Sache mit George hat alle am Lehrstuhl mitgenommen. Aber das Leben geht ja weiter. Mel musste in die Vorlesung und irgendwelchen Studenten Kernphysik beibringen. Das ist zwar meist ziemlich langweilig, aber ich glaube, heute war sie ganz froh über die Ablenkung. Danach hat sie sich um die Nachmittagsübungen gekümmert. Die muss sie zum Glück nicht selbst halten. Das machen Tim und Olli. Doch Mel muss mit ihnen die Übungsaufgaben besprechen, damit die Studenten nachher die Klausur bestehen und in den mündlichen Prüfungen nicht ganz so blöd dastehen, auch wenn einigen echt nicht zu helfen ist. Das sagt sogar Mel.
Dann war Doreen hier. Sie ist die Sekretärin des Lehrstuhls und meistens krank, weil sie auf ihren dünnen Absätzen ständig umknickt und sich die Bänder überdehnt oder ganz reißt. Im Moment ist sie jedoch da und humpelt auf ihren Krücken den Gang rauf und runter. Sie kam eben zu Mel ins Büro. Ich glaube, sie wollte sich den Nachmittag freinehmen. Aber Mel hat die Chance genutzt und Doreen nach der Post für Rüdiger gefragt. Sie wollte wissen, was Doreen jetzt damit macht und so. Natürlich hat Doreen bislang gar nichts damit gemacht, sondern alles auf einen großen Stapel geräumt. Als Mel sie ansprach, hat Doreen sofort angefangen rumzujammern, dass sie gar nicht weiß, was sie den Leuten schreiben soll, weil so viele Rüdiger zu Vorträgen und Konferenzen und Seminaren eingeladen hätten.
Ich meine, ich weiß nicht, warum sie die Anfragen überhaupt beantworten muss. Dass Rüdiger tot ist, wissen mittlerweile wirklich alle. Es war sogar in den Nachrichten, weil er ja wegen des Preises jetzt ziemlich berühmt ist. Sie hätte sich auch einfach einen Stempel machen lassen können ,Empfänger verstorben‘ und alles einfach wieder hübsch in den Briefkasten zurückstecken können.
Doch das hat Mel ihr nicht gesagt. Sie hat geseufzt und sich Doreens Gejammer angehört. Dann hat sie sich den ganzen riesigen Stapel Briefe bringen lassen und auch alles, was per E-Mail gekommen ist. Am Ende ist Doreen auf ihren Krücken abgerauscht, während Mel sich durch die Post gearbeitet, einen Brief nach dem nächsten gelesen und im Internet die Absender recherchiert hat.
Teilweise waren es ganz normale Unis, die musste sie natürlich nicht recherchieren, ein oder zwei Schulen waren dabei, drei Radiosender und eine Sternwarte, aber auch ein paar Talkshows und ein Lifestyle-Magazin, also so ein Heft mit bunten Bildern, das nichts über die Forschung wissen wollte, sondern eine Homestory über Rüdiger plante mit Fotos von seinem Haus, dem Arbeitszimmer, seiner Frau und der Katze. Der berühmte Nobelpreisträger privat. Das hat Mel zum Glück sofort aussortiert. Es gab auch ein paar ganz komische Briefe. Irgendeine Gesellschaft für naturwissenschaftlichen Fortschritt und soziale Gerechtigkeit e.V. wollte Rüdiger unbedingt für einen Vortrag engagieren. Und ein Mitmach-Museum fragte höflich an, ob der liebe Herr Nobelpreisträger bei ihnen irgendetwas für Kinder vorführen könne, zum Mitmachen natürlich. So ein Blödsinn. Als könnte man den Beschleuniger mal eben einpacken, woanders aufbauen und dann ein paar Gören daran herumspielen lassen. Der Beschleuniger strahlt so radioaktiv wie ein halbes Kernkraftwerk, zumindest der vordere Teil. Da hätten sich die Museumsleute ganz schön umgesehen, wenn die lieben kleinen Zuschauer plötzlich einer nach dem anderen tot umgefallen wären. Ich finde, das sollte Mel denen einfach schreiben, dann hat sich die Anfrage sofort erledigt. Doch so ist Mel eben nicht.
Sie hat sich richtig Mühe gegeben. Deswegen hat es Stunden gebraucht, nur um alles durchzusehen, vielleicht aber auch, weil sie dabei immer wieder unterbrochen wurde. Zuerst kam Tim, um zu fragen, ob Mel wüsste, wo die neue Radioquelle sei. Das wusste sie natürlich nicht. Olli hatte eine Frage zu den Übungsaufgaben, zwei Studenten wollten Termine für eine mündliche Prüfung machen, und dann war ja auch noch das Essen mit der Gleichstellungsfrau.
Ich glaube, diese Nina hatte schon mit Mels Frage gerechnet. Jedenfalls klang sie nicht sonderlich überrascht und hatte auch sofort Zeit. Ich bin natürlich mitgegangen. Mel und Nina haben sich in der Mensa getroffen und gemeinsam ihre Schnitzel mit Pommes gegessen. Nina hat direkt gesagt, dass sie findet, dass Mel die Stelle haben sollte und dass es für die Fakultät wichtig wäre, erstens eine Frau zu berufen und zweitens jemanden, der die Experimente des verstorbenen Nobelpreisträgers in seinem Sinne fortführt. Das fand ich lustig. Denn eigentlich war es ja andersherum, also dass Mel die Experimente geplant und Rüdiger nur mitgemacht hat. Aber das weiß Nina natürlich nicht. Jedenfalls meinte sie, es wäre nicht ganz einfach, das Auswahlverfahren zu umgehen. Wenn Mel schon eine Professur hätte oder ein gutes Angebot von anderer Seite, dann wäre das etwas anderes. Trotzdem will sie jetzt sehen, was sie tun kann. Im Übrigen hätte Nina gehört, dass ein gewisser Professor Glanz, genau so hat sie es ausgedrückt, sich bereits hinter den Kulissen mächtig für seine Tochter einsetzt.
Ich möchte lieber nicht wissen, was das heißt. Und ich glaube, auch Mel war das ziemlich unangenehm. Denn sie hat ganz verlegen ausgesehen und dann schnell ihre restlichen Pommes aufgegessen. Nina hat zum Glück nichts mehr dazu gesagt, sondern nur gemeint, dass sie und Mel in Kontakt bleiben würden und ein Kaffeetrinken für nächste Woche vorgeschlagen.
Das war vor ein paar Stunden. Jetzt sind wir wieder im Büro. Draußen ist es schon lange dunkel, doch dafür hat Mel Rüdigers Post fast fertig sortiert. Die Schreiben, die abgesagt werden sollen, türmen sich vor dem Computer wie der schiefe Turm von Pisa. Mel liest gerade den allerletzten Brief, als Skype piept. Dummerweise beugt sie sich deswegen so hektisch vor, dass ihr Arm den Stapel streift.
„Mist!“
Hektisch versuche ich, das Schlimmste zu verhindern und stoße fast noch meine Cola um. Immerhin schaffe ich es, die Dose aufzufangen und damit zumindest die Tastatur meines Rechners zu retten. Beim Rest bin ich weniger erfolgreich. Ich kann nur zusehen, wie eine Lawine aus über einhundert Briefen über meinen Schreibtisch rutscht, sich mit den ungelesenen Papern und meinen Notizen mischt und sich schließlich über den gesamten Büroboden verteilt.
„Allerdings!“, höre ich Katis Stimme, noch bevor sich ihr Bild auf dem Monitor vor mir aufgebaut hat. „Ich habe es gerade in den Nachrichten gehört.“
„Was?“, frage ich abwesend.
Ich bin im Moment so tollpatschig, dass ich grundsätzlich davon absehen sollte, in der Nähe meines Rechners oder anderer empfindlicher Geräte mit klebrigen Flüssigkeiten zu hantieren.
Doch ehe ich die Dose ansetzen kann, um sie in einem Zug zu leeren und unschädlich zu machen, fährt Kati fort. „Ganz schöner Schocker das mit diesem Kinsley.“
Mit einem Schlag ist die Erinnerung an den heutigen Morgen zurück. Ich lasse die Dose sinken und starre auf das Chaos aus Briefen, Papers und Notizen. Den ganzen Tag über habe ich jeden Gedanken an die schreckliche E-Mail verdrängt. Nachdem ich mit meinem Vater gesprochen hatte, bin ich von einem Termin zum nächsten gehetzt, habe mich um Rüdigers Post gekümmert und mich bemüht, meine Nase über Wasser zu halten. Doch plötzlich ist alles wieder da. Unter mir öffnet sich ein Krater, der mich mit aller Macht hinab in die Dunkelheit ziehen will. George ist tot. Die Dose in meinen Händen knackt laut, so fest kralle ich meine Finger um das dünne Stück Weißblech, als könnte es mich davor bewahren, mit meinen Gefühlen in den Abgrund zu stürzen.
Mittlerweile kann ich Kati sehen. Sie trägt einen weißen Kittel und hat ihre Haare zu einem Zopf zusammengebunden. Vermutlich skypt sie direkt aus der Praxis, obwohl sie kein Stethoskop um den Hals trägt.
Wieder bemerke ich, dass mein Gehirn eigenartig arbeitet. Es gibt so viele Dinge, über die ich nachdenken muss. Stattdessen fällt mir auf, dass jedem Arzt im Fernsehen grundsätzlich ein Stethoskop um den Hals baumelt, selbst wenn es sich um einen Orthopäden handelt.
„Was tust du jetzt?“ Kati schaut mich aus großen Augen an.
„Was meinst du?“, frage ich und kämpfe gegen die Bilder an. Statt zu verschwinden, sammeln sie sich wie ein Kloß in meinem Hals, ein Kloß, der sich auch mit einem weiteren Schluck Cola nicht hinunterspülen lässt. Ich trinke, bis die Dose leer ist und lasse sie in den Mülleimer fallen, wo sie mit einem lauten Klong verschwindet. Doch nun habe ich nichts mehr, an dem ich mich festhalten kann. Daher ziehe ich eine Haarsträhne aus meinem Pferdeschwanz und zwirble sie zwischen Daumen und Zeigefinger.
„Na, jetzt bist du fast allein, also ich meine, eine der letzten Überlebenden des Dream-Teams.“
„Sag das nicht so!“
„Du weißt, wie ich es meine.“
„Du hörst dich an wie Papa.“ Meine Stimme klingt kratzig.
„Hat er schon angefangen, deine Karrierechancen auszuloten?“, fragt Kati spöttisch.
Statt einer Antwort schnaube ich.
„Okay, ich kann es mir denken. Wahrscheinlich hat er allein heute mindestens drei verschiedene Uni-Offizielle angerufen und deine Talente angepriesen.“
Ich zucke die Achseln.
„Nimm ihn nicht zu ernst. Du bist nicht er. Du wolltest nie eine große Karriere machen. Also lass dich auch nicht dazu drängen.“
„Es ist nur so“, versuche ich eine Erklärung. „Ich kann alles verlieren.“ Meine Stimme versagt bei den letzten Worten.
Kati schaut mich einen Moment lang stumm an. „Wie geht es dir?“, fragt sie schließlich.
Es ist kein gewöhnliches ,Wie geht es dir‘, keine Floskel, auf die niemand eine Antwort erwartet, sondern eine bohrende Frage. Katis Worte bahnen sich ihren Weg tief in meine Seele. Hinein in den dunklen Krater, in die Angst, die ich den ganzen Tag über verdrängt habe. Das ist zu viel. Es ist mehr, als ich ertragen kann. Ich kann nicht antworten. Ich spüre, wie Tränen in meine Augen schießen, sich sammeln und überlaufen. Sie rinnen meine Wangen hinab, tropfen auf die Tastatur und bilden feuchte Flecken auf meinem Pulli.
„Es ist …“, stottere ich, aber dann schluchze ich nur noch.
Ich weiß sowieso nicht, was ich sagen soll. Dass alles schrecklich ist? Dass ich nicht mehr weiß, wie es weitergeht? Oder dass ich das alles nicht verstehe? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Vor wenigen Wochen haben wir Sekt getrunken. Das neue Experiment sollte losgehen. Phil war da. Ich war glücklich. Wirklich glücklich für einen kurzen, kostbaren, herrlichen Moment. Und dann?
Plötzlich ist sie da, eine ungreifbare Angst. Sie breitet sich in mir aus wie ein Monster mit tausend Armen. Sie raubt mir die Luft zum Atmen und hämmert gegen meinen Kopf. Ist es die Sorge um meine Zukunft? Die Todesfälle allein sind tragisch. Doch nun bedrohen sie auch mein eigenes Leben. Mein Labor. Meine Arbeit. Warum mussten sie sterben? So kurz hintereinander! Das alles fühlt sich ganz und gar nicht normal an. Es ist furchtbar falsch.
Die Angst, die schrecklichen Ereignisse. Etwas treibt mich zurück in eine Vergangenheit, an die ich mich nicht erinnern kann. An die ich mich auch nicht erinnern möchte. Ich will einfach nur in Ruhe meinen Job machen. Meine Forschung. Doch genau die steht plötzlich auf dem Spiel. Und meine Gedanken kreisen um TV-Ärzte und grüne Pillen. Ich werde noch verrückt. Nein! Ich darf nicht zulassen, dass die Panik mich erstickt.
Atme, Mel!
Sauerstoff. Er verdrängt die Angst, und ich spüre, wie mein Verstand wieder die Leitung übernimmt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin ganz und gar normal. Die Stimme heute Morgen habe ich mir nur eingebildet. Ich war im Halbschlaf. So etwas passiert.
Ich habe in meinem Leben schon andere Sachen überstanden. Jetzt werde ich auch diese Situation meistern. Papa hat mir Angst gemacht, aber er hat mir auch einen Weg gezeigt. Entlang dieses Wegs werde ich mich vorwärts hangeln. Ich habe ein Ziel. Ich will mein Labor behalten. Ich will forschen. Und wenn ich dafür öffentliche Vorträge halten, mit Nina Bender Kaffee trinken und eine Professur annehmen muss, dann werde ich das tun.
Ich merke, dass ich ruhiger werde. Meine Brust hebt und senkt sich. Luft strömt in meine Lungen. Ein und aus. Das Pochen in meinem Kopf lässt nach. Ich kann es schaffen. Ich werde es schaffen.
„Mel?“
Verwirrt schaue ich auf. Kati mustert mich vom Monitor aus. Über ihre Nasenwurzel zieht sich eine tiefe Falte.
„Ja?“, frage ich und versuche, meiner Stimme einen festen und entschlossenen Klang zu geben.
„Bist du okay?“
„Ja! Ja, natürlich“, antworte ich rasch. „Aber ich habe gerade viel um die Ohren, weißt du? Ich glaube, ich muss Schluss machen.“
„Bist du dir sicher, dass alles gut ist?“, höre ich noch ihre Frage.
Aber ich habe schon den roten Button gedrückt, und das Fenster der Videoübertragung schließt sich mit einem leisen Plopp.
Stille. Es ist so spät, dass außer mir und dem Mann vom Sicherheitsdienst, der irgendwo durch die endlosen Flure streift, gewiss niemand mehr im ganzen Physikgebäude zu finden ist. Kati ist weit weg, und doch fühle ich mich nicht allein. Nicht, weil ich wieder eine Stimme höre. Natürlich nicht. Es ist eher eine vage Ahnung. Sie erinnert mich an das Gefühl, das ich als Kind hatte, wenn ich nach einem Albtraum zu meiner Mutter ins Bett kroch. So, als würde ihre bloße Anwesenheit alle Monster vertreiben und jede Furcht in Luft auflösen. Allein, dass sie da war, reichte aus, damit ich mich sicher und geborgen fühlte. Es ist das ganz und gar unbegründete Gefühl, dass am Ende alles gut wird.
Ich frage mich, woher es auf einmal kommt.