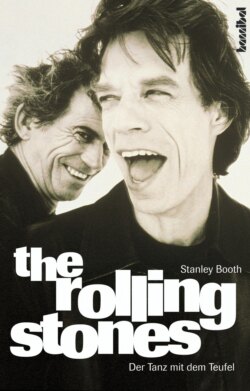Читать книгу The Rolling Stones - Stanley Booth - Страница 10
Оглавление3
Warum gibt es die Jass-Musik und demzufolge die Jass-Band? Jass war eine Manifestation der Niederungen des menschlichen Geschmacks, die sich noch nicht durch die Zivilisation ausgewaschen hat. Man könnte sogar noch weiter gehen und sagen, dass Jass-Musik die synkopierte und kontrapunktierte unanständige Story schlechthin ist. Wie auch der unschicklichen Anekdote in ihren Anfängen wurde ihr errötend hinter verschlossenen Türen und zugezogenen Vorhängen gelauscht, aber wie alle Untugenden wurde sie unverfrorener, bis sie sich in anständige Umgebungen vorwagte und dort wegen dieser seltsamen Gegebenheit toleriert wurde: Auf gewisse Gemüter hat ein lauter und bedeutungsloser Sound eine aufregende, fast vergiftende Wirkung, wie aufdringliche Farben und starke Parfums, der Anblick nackten Fleisches oder die sadistische Freude an Blut. Für solche Gemüter ist die Jass-Musik ein Genuss …
„New Orleans Times Picayune“, 1918
ich erwachte unter einem magentaroten und türkisfarbenen Bettüberwurf, der mit Motiven aus „Wizard of Oz“ bedruckt war, mit Darstellungen von Dorothy und der Vogelscheuche und all den anderen in einem Ballon. Es gab zwei Einzelbetten in dem Raum, wo früher reiche kleine Chemiemagnatenerben der Familie Du Pont geschlafen hatten. David Sandison hatte die Nacht im anderen Bett verbracht, war aber schon aufgestanden. Ich duschte und zog mich an, während ich auf das unsichtbar unter einer dichten, elefantenfarbenen Wolke daliegende Los Angeles hinausschaute. Dann durchwanderte ich die ganze Länge des Hauses in Richtung Küche und inspizierte den Kühlschrank. Es war seltsam, an einem sonnigen Morgen in einem großen, gesichtslosen Haus aufzuwachen, den Rest der Welt rundherum vor lauter schädlichem Dunst nicht sehen zu können, den Kühlschrank zu öffnen und Flaschen mit gesunder, naturbelassener Vollmilch sowie Vollkornbrot vorzufinden. Kalifornien. Es war zehn Uhr und ich saß an der runden Frühstücksbar, aß eine Orange und Vollweizenbrot mit eingemachten Brombeeren und nahm Eintragungen in mein winziges, hochoffizielles Notizbuch vor.
Als ich am Büro vorbeikam, wo Jo Bergman und Sandison Promotionsmaterial für die Pressekonferenz an diesem Vormittag zusammenstellten, teilte sie mir mit, dass Ronnie Schneider für ein paar Tage zurück nach New York gereist war. Das machte es natürlich leichter, ihm aus dem Weg zu gehen.
Jo, David und ich machten uns schon früh auf den Weg zum Beverly Wilshire Hotel, wo die Pressekonferenz stattfinden würde – in einer der Limousinen, die rund um die Uhr an allen drei Dependancen der Stones in L. A. zur Verfügung standen. Außer unserem Domizil mit der Watts-Familie am Oriole Drive gab es noch das Haus im Laurel Canyon, wo sich Keith und die beiden Micks aufhielten, und das Beverly Wilshire, wo Bill Wyman und Astrid wohnen wollten, bis es Jo gelungen war, ihnen ein Haus zu organisieren.
Die Pressekonferenz sollte im „San-Souci-Saal“ des Wilshire stattfinden, in den wir durch ein Labyrinth aus Bars und Speisesälen gelangten. Die Los-Angelisierung von Los Angeles hatte das Beverly Wilshire, wo der „San-Souci-Saal“ im sanften Licht seiner Kristallleuchter wie im Weichzeichner erstrahlte, noch nicht erreicht. Die grelle Sonne Südkaliforniens wurde von Vorhängen aus Damast und Brokat am Eindringen gehindert, schien aber stets präsent zu sein: Vor dem Fenster machte ein Presslufthammer einen derartigen Krach, dass es in Körperverletzung auszuarten drohte – so als würde er jeden Moment die Wand durchstoßen. „Was ist das für ein entsetzlicher Lärm?“ fragte Jo den mit einem blauen Nadelstreifanzug bekleideten Hotelangestellten, dem wir in den Saal folgten.
„Äh, wann ist Ihr Treffen?“
„Elf Uhr dreißig.“
„Die hören um elf auf.“
Fünfzig oder sechzig Klappsessel standen in Halbkreisen vor einem langen Konferenztisch; rechts davon gab es eine Bar und einen weiteren Tisch mit Tee, Kaffee, Fruchtsalat und kleinen Kuchen; die Tische waren mit großen Blumensträußen dekoriert. Ich spazierte im Saal herum und machte mir Notizen. Der Presslufthammer verstummte, Steckler kreuzte auf und die Presse begann einzutreffen. Sie schienen alle in ihren frühen Zwanzigern zu sein, die meisten trugen Notizbücher, Kameras und Tonbandgeräte mit sich, und alle waren durchwegs in jenem aktuellen Stil gekleidet, den man erreicht, indem man riesige Summen dafür ausgibt, arm und ramponiert wie ein neues Geschlecht von Mittelklassezigeunern auszusehen.
Kurz vor elf Uhr dreißig tauchten drei Kamerateams vom Fernsehen auf. Ihre Kleidung ging mehr in Richtung Anzug und Krawatte. Mit einem dieser Teams kam Rona Barrett, der fleischgewordene Fernsehtratsch Hollywoods, eine kleine Frau, deren riesige blondierte Frisur unter einer dicken Lackschicht aus Haarspray erstarrt war. Sie ließ sich auf einem Klappsessel nieder, eine kultivierte Perle unter all dem Wildleder und Jeansstoff.
Am Mittag stolperten die Stones einer nach dem anderen wie betrunkene Indianer in den Raum und platzierten sich am Konferenztisch. Blitzlichter ploppten, Fernsehkameras surrten. Die Stones saßen da und kratzten sich an den Köpfen.
Bei den Stones, neben Keith, saß ein weiterer junger Engländer, der eine burgunderfarbene Lederjacke und dunkle Gläser trug und dunkle fettige Locken wie ein Pirat hatte. Das war Sam Cutler, ein Neuzugang zur Entourage der Stones, dessen Funktion völlig unklar war – solange man nicht wusste, dass er alles bei sich tragen musste, womit Keith nicht erwischt werden wollte.
Schließlich hörte das Blitzlichtgewitter auf und für die Dauer eines langen Moments gab es keinerlei Fragen, wusste keiner, was er fragen sollte. Die pure Konfrontation war genug: Vor drei Jahren, als die Stones zum letzten Mal eine Tour durch die Staaten unternommen hatten, waren die meisten der jetzt hier versammelten Leute Teenager gewesen, die in verdunkelten Arenen ihre Bewunderung für die Stones herausschrieen. Und diese Stones waren in der Zwischenzeit eingebuchtet worden, hatten Frauen getauscht und sich gerüchteweise aufgelöst, waren gestorben – und saßen jetzt dennoch hier am Tisch, die Ellbogen brav aufgestützt.
Die jüngeren Reporter, von denen die meisten im Falle einer Razzia wahrscheinlich wegen des Besitzes von Dope hochgegangen wären, sahen nicht so aus wie alle anderen, die den Stones bei ihren bisherigen Pressekonferenzen in den Staaten begegnet waren. Aber auch diese Generation bestand zum Großteil aus ganz normalen Langweilern, die andere Leute – Berühmtheiten – brauchten, die ihr Leben ersatzweise für sie lebten. Und glücklicherweise gibt es immer ein paar solcher Berühmtheiten. Sie sind die Stars, und damals gab es keine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, die derart beliebt und verhasst war wie Mick Jagger. Schon der Name: ein Name, scharf wie ein Dosenöffner. Jagger, der Dosenöffner. Jagger saß lächelnd da. Er trug limonenfarbene Hosen und ein Seidenhemd mit grünen und weißen Tupfern und offenem Kragen. Ein großer Tierzahn hing an einer Kette unter seinem starken, aber wie ein Silberhalsband wohlgeformten Schlüsselbein.
Falls man hier die gleichen Fragen stellen wollte wie die meisten, die man mich über die Stones gefragt hatte, dann würden sie kurz und direkt ausfallen: Bist du schwul? Welche Drogen nimmst du? Hast du Brian umgebracht? Aber die ersten Fragen, die Jagger beantwortete, brachten nur ans Tageslicht, dass das neue Stones-Album, „Let It Bleed“, in ungefähr drei Wochen veröffentlicht werden sollte und dass die Stones keine konkreten Pläne für ein eigenes Plattenlabel hatten. „Das ist sinnlos, solange man nicht eine Armada von Lieferwagen anheuert und die Platten zum halben Preis verkauft“, sagte Mick.
Es sah so aus, als würde das Treffen freundschaftlich und langweilig verlaufen, ohne den üblichen Konflikt, der einst für alle Begegnungen der Stones mit der Presse charakteristisch gewesen war. Das große Zusammengehörigkeitsgefühl, das diese Journalisten drei Jahre früher mit den Stones verbunden hätte, wenn sie im Fernsehen eine Pressekonferenz verfolgt hätten, fehlte daher. Das veranlasste einen Reporter, nach einer Entgegnung auf das Statement in Ralph Gleasons Kolumne vom Vortag zu fragen, wonach „die Eintrittspreise zu den Konzerten überhöht wären, und es sich eine Menge Leute, die sie gerne sehen würden, nicht leisten könnten“.
Ohne sich anscheinend auch nur im geringsten vom Geschwätz eines Jazzjournalisten mittleren Alters beeindrucken zu lassen, sagte Mick großzügig: „Vielleicht können wir für diese Leute etwas arrangieren.“
„Ein Gratiskonzert?“ fragte jemand, aber Mick antwortete, das wisse er nicht und überging die Angelegenheit mit aristokratischer Leichtigkeit: „Wir können den Preis der Tickets nicht bestimmen. Ich weiß nicht, wie viele Leute sich das leisten können. Ich habe keine Ahnung.“
Ein anderer fragte, ob das US State Department den Stones Schwierigkeiten mache und beispielsweise verlange, dass sie Anti-Drogen-Statements unterschrieben, bevor sie das Land betreten dürften. Mick sagte: „Natürlich nicht, wir haben nie irgendwas Unrechtes getan.“ In das folgende Gelächter und den Applaus hinein fragte Rona Barrett: „Betrachten Sie sich als eine Anti-Establishment-Gruppe oder nehmen Sie uns nur auf den Arm?“
„Wir nehmen Sie nur auf den Arm“, antwortete Mick.
„Wir hau’n Sie übers Ohr“, murmelte Keith, während seine Reptilienlider herabsanken.
Rona ließ nicht locker: „Wie hat es Ihnen gefallen, gestern Abend im Yamato zu essen?“
„Sie war unter dem Tisch“, erläuterte Keith, wodurch sie sich aber nicht abblocken ließ.
Mick erzählte einem Fragesteller, dass die Stones hofften, Ike und Tina Turner, Terry Reid, B. B. King und Chuck Berry als Vorprogramm für die Tour engagieren zu können und wieder tauchte die Frage nach einem Gratiskonzert auf. Diese jungen Reporter schienen sogar noch vehementer als Ralph Gleason in seiner Kolumne darauf zu dringen, dass die Stones eine Verpflichtung der Öffentlichkeit gegenüber hätten, die schließlich neuerdings weitgehend nach dem Image der Stones geformt war. Aber damit hatten die Stones in all ihrer Unabhängigkeit anscheinend noch nie geliebäugelt und wieder umging Mick das Thema: „Wenn wir das Gefühl haben, wir müssten etwas in dieser Richtung tun, dann werden wir es auch tun. Ich lasse diesbezüglich alle Möglichkeiten offen und bitte das zur Kenntnis zu nehmen. Aber ich lege mich nicht fest.“
„Und wie geht es Marianne Faithfull?“ fragte Rona Barrett Mick. Hätte man es nicht besser gewusst, man hätte annehmen können, sie sei die einzige Reporterin, die sich für das Privatleben der Stones interessierte.
Drei Tage nach dem Tod von Brian Jones hatte Marianne Faithfull, Jaggers „ständige Begleiterin“ während der vergangenen zwei Jahre, die sich gerade mit Mick in Australien aufhielt, um in einem Film mitzuwirken, in den Spiegel geblickt und nicht ihr eigenes Gesicht gesehen, sondern das von Brian. Dann nahm sie eine Überdosis Schlaftabletten. Nur Glück und sofortige medizinische Behandlung retteten ihr Leben. Nachdem sie sich in Australien und der Schweiz erholt hatte, war sie in Micks Haus in London zurückgekehrt, wo sie sich nun vernachlässigt fühlte.
„Es geht ihr gut“, sagte Mick zu Rona. „Und wie geht’s Ihnen?“
Rona ließ sich nicht entmutigen und wollte wissen, ob Mick irgendwelche Pläne habe, für ein öffentliches Amt zu kandidieren: „Ich fühle mich nicht sehr messianisch“, sagte er lachend.
Weitere Fragen über Festivals und Gratiskonzerte wurden gestellt. Das Thema ließ sich einfach nicht beiseite schieben. Die Popfestivals, diese gewaltigen Zurschaustellungen von Drogen, Sex und Musik, hatten die öffentliche Meinung in diesem Jahr entweder in empörte Aufregung oder in Begeisterung versetzt, in jedem Fall aber stark beschäftigt. Das große Spektakel des vergangenen Jahres war die Polizeibrutalität in Chicago während des Konvents der Demokraten gewesen; im Jahr davor hatten die Massenmedien den unter jungen Menschen weitverbreiteten Gebrauch von psychedelischen Drogen entdeckt. Heuer hatte es an Orten wie Woodstock, Hyde Park, Atlanta, Denver, Isle of Wight oder Dallas riesige Musikfestivals gegeben, wo die Leute nichts zahlten, auch wenn Karten eigentlich verkauft wurden, wo sie nackt herumliefen, öffentlich Drogen konsumierten und Sex hatten – und das alles fast ohne Verhaftungen, weil es außer einem Krieg keine Möglichkeit gegeben hätte, Hunderttausende von Menschen festzunehmen. Es sah so aus, als wären die Kinder des Zweiten Weltkriegs zu einer Macht herangewachsen, der die traditionelle Gesellschaft möglicherweise keinen Einhalt mehr gebieten konnte. Es sollte, so sagte Keith über die Festivals, „zehnmal mehr davon geben“. „Aber“, wollte jemand noch immer wissen, „was ist jetzt mit den Preisen der Tickets für die Rolling-Stones-Konzerte?“
Mick, Keith und Sam Cutler begannen gleichzeitig zu sprechen, hörten gemeinsam auf und Sam sagte: „Dürfte ich nur das eine sagen: die Prickets …“ Und Keith küsste ihn auf die Wange. (Prickets: unübersetzbares Wortspiel mit „prick“ = Schwanz, Stich, „pricket“ = Schwänzchen).
Sie waren trotz allem eben immer noch die Rolling Stones. Mick hielt eine kleine Rede, die Fragen versiegten und Mick sagte: „Danke vielmals, Leute.“ Und dabei klang er wie Merriman Smith, der verstorbene Pressesprecher des Weißen Hauses, beim Beenden einer Pressekonferenz des Präsidenten.
Die Stones verließen den Saal. Am Ende hatte Mick noch betont: „Wir machen diese Tour nicht des Geldes wegen, sondern weil wir in Amerika spielen und eine Menge Spaß haben wollen. Mit diesen ganzen wirtschaftlichen Angelegenheiten haben wir echt nichts zu schaffen. Ich meine, man ist entweder ein Sänger und das alles oder man ist ein verdammter Ökonom. Es tut uns leid, wenn es sich einige Leute nicht leisten können, zu unseren Konzerten zu kommen. Aber wir wüssten nicht, dass diese Tour teurer als andere ist. Ihr werdet uns in dieser Hinsicht auf dem Laufenden halten müssen.“ Das wirkte wie ein ernsthafter Schritt, da die Stones es bisher immer vermieden hatten, sich von anderen Leuten sagen zu lassen, was sie zu tun hätten.
Steckler, Sandison, Jo und ich trafen die Stones in der Suite von Bill Wyman, wo es im Wohnzimmer um die nicht unwichtige Frage ging, ob die Stones vor dem Start der Tournee eine Single aus dem neuen Album veröffentlichen sollten. Steckler schlug vor, die auf dem Album enthaltene Countryversion von „Honky Tonk Women“, ihrer letzten Single, zu veröffentlichen, womit sie die erste Band würden, die den gleichen Song zweimal hintereinander auf den Markt brachte.
Jagger schlug vor, den Titelsong „Let It Bleed“ herauszubringen, „wenn ihn irgendwer im Radio spielen würde“.
„Nicht mit diesem Text“, sagte Jo.
„Na ja, der ist nicht einfach nur ordinär, ich mein’, der ist zweideutig“, sagte Mick.
„‚If you want someone to cream on, you can cream on me‘ ist ziemlich eindeutig“, sagte Jo.
„Wir müssen uns auch darauf einigen, mit welchen Presseleuten du sprechen wirst“, meinte Steckler und nannte etliche regelmäßig erscheinende Zeitschriften, die um Interviews ersucht hatten.
„‚Saturday Review‘, was ist das für ’n Blatt?“ fragte Mick.
„Das stumpfsinnigste Magazin in ganz Amerika“, sagte ich. „Stumpfsinniger als die ‚Saturday Evening Post‘. Stumpfsinniger als ‚Grit‘.“
„Das geht dann in Ordnung.“
Das Meeting war kurz; nichts wurde beschlossen – außer zu versuchen, ein paar weitere Tage am Leben zu bleiben. Keine Strategie, kein Plan.
Nach unserer Rückkehr ins Oriole-Haus und einem Lunch aus Schinkensandwiches und Bier besuchten Steckler, Sandison und ich das Haus im Laurel Canyon. Ein untersetzter junger Mann namens Bill Belmont, der zu Chip Monks Bühnencrew gehörte, fuhr mit uns in der Limousine mit und machte uns wie ein Reiseführer, der davon träumt, ein Pressesprecher zu sein, auf die Sehenswürdigkeiten aufmerksam: „Die Hütte dort, das ist Frank Zappas Haus, hat einmal Tom Mix gehört. Das Haus, zu dem wir hinfahren, wo jetzt die Stones sind, gehörte einmal Carmen Miranda und danach Wally Cox, und dann hat es Peter Tork von den Monkees gehört, und jetzt gehört es Steve Stills. Auch David Crosby hat dort eine Weile gelebt. Ich kann euch alles erzählen. Habt ihr den Artikel über die Doors im ‚Rolling Stone‘ gelesen? Der ist eigentlich von mir, denn ich hab’ dem Typen den ganzen Artikel erzählt. Er hat nur aufgeschrieben, was ich gesagt habe.“
An einer unbefestigten Straße am Abhang des Laurel Canyon befand sich zwar ein Tor, aber es war offen, und wir fuhren hinauf, umgeben von den dunkelgrünen Wänden des Tals. Das Haus war aus Stein, hatte einen Swimmingpool und eine große gepflasterte Auffahrt, in der zwei Limousinen und zwei Mietwagen parkten. Vom hinteren Ende des Hauses her konnte man über den Pool die gedämpften Klänge von elektrischen Gitarren und einer Mundharmonika hören.
Neben der Auffahrt wuchs ein Zitronenbaum und die Clowns, in deren Gesellschaft ich mich befand, vergnügten sich damit, Zitronen abzureißen und herumzuwerfen. Nur um mich nicht auszuschließen, warf ich auch eine oder zwei Zitronen, aber ich komme aus einem Ort, wo die Leute arm, aber stolz sind, und ich habe keine Freude daran, mit Essen zu werfen – es sei denn, ich will jemanden damit treffen.
Nach einer Weile gingen wir ins Haus, einem Räubernest aus Holz, Leder und Stein, mit Steinböden, einem großen steinernen Kamin und nichts, was dem Ganzen einen etwas weicheren Touch gegeben hätte. Die Küche verfügte über einen Kühlschrank, der so groß war wie jene in den Läden von Arbeitercamps bei Ölbohrstellen, nur dass in diesem hier anstelle von Schweinehälften und Riesenorangen Bier eingelagert war. Wir tranken ein paar Heinekens und warteten auf das Ende der Probensession. Belmont, Steckler und Sandison hingen auf Sesseln faul im Wohnzimmer herum. Ich hatte keine Ahnung, warum sie eigentlich hier waren. Ich war gekommen, um mit Keith und Mick über den Brief zu reden, den ich benötigte, um einen Verleger zu finden, weiterleben zu können, ein Buch zu schreiben. Ich legte mich auf eine Ledercouch, schaute zum Fenster hinaus und sah ein kleines braunes Rehkalb, das den Abhang herabkam.
Die Musik im hinteren Teil des Hauses hörte bald auf und die Stones kamen aus dem Proberaum. Ich folgte Keith in die Küche. Er öffnete eine 35-Millimeter-Filmdose, entnahm ihr mit einem kleinen Löffel ein Häufchen weißer Kristalle und bemerkte mich erst, als er den Löffel schon halb am Ziel hatte. Seine Hand hielt inne, ich sagte: „Erwischt“, und er zuckte die Achseln, hob den Löffel und schnupfte. Dann fragte ich: „Ähm, Keith, was ist mit dem, äh, Buch?“
„Ich muss mit Mick darüber reden.“
Die Zeit verging, nichts geschah. Im Wohnzimmer lungerten die Leute noch immer herum. Keith stand da, die eine Hand locker auf seinen nach vorne durchhängenden Hüften, die andere stopfte eine Bierflasche in seinen Mund und ließ ihn wie ein Baby mit Nuckelflasche aussehen. Ich fand Mick direkt vor der Tür des Proberaums am Klavier sitzend vor. „Was ist mit dem Buch?“ fragte ich.
„Ich muss mit Keith darüber reden.“
Dann ging ich zu Keith zurück und sagte: „Hast du schon mit Mick gesprochen? Wir müssen gehen.“
„Hey“, sagte Keith zu Mick, der gerade vorbeiging, „was ist mit diesem Buch?“
„Was soll damit sein?“
Sie schlenderten in die Küche, als das Tageslicht gerade verblasste. Endlich brachen wir dann wirklich auf und ich fragte Keith: „Na?“
„Du schreibst den Brief“, sagte er, „und wir werden ihn unterschreiben.“
So weit, so gut, dachte ich, während ich, zurück im Oriole-Haus, Bouillabaisse aß. Ich hatte noch nie zuvor Bouillabaisse gegessen und sie schmeckte mir. Ich überlegte mir noch immer, was ich als nächstes tun sollte. Den Brief schreiben und sie unterzeichnen lassen. Und was dann? Werden sie mich in Ruhe lassen, um einen Vertrag abzuschließen und ein Buch zu schreiben?
Ich versuchte, die Bouillabaisse und diese Fragen zu verdauen, während ich nach dem Dinner mit Jo, Sandison, Steckler und der Watts-Familie zusammensaß. Die Nacht war kühl und im Kamin machten vier Gasdüsen einem Haufen Holzscheite den Garaus. Ein paar Leute kamen vorbei, einer mit einer großen Phiole Koks, und so blieben, als dann alle anderen zu Bett gegangen waren, Sandison, Steckler und ich noch auf und redeten. Steckler enthielt sich des Kokains, war aber allein schon deshalb aufgedreht, weil er von daheim fort war. Er war in den späten Dreißigern, im Rahmen dieser Gruppe also ein älterer Mann, und er arbeitete für Allen Klein, der als Manager der beiden beliebtesten Acts der Welt, der Beatles und der Rolling Stones, wahrscheinlich der mächtigste Mann im Showbusiness war. Aber so nahe an all dieser Macht und dem ganzen Geld wirkte Steckler irgendwie naiv, er schien Dichtung und Wahrheit der Rockmusik für allzu bare Münze zu nehmen. Seine braunen Haare waren ordentlich geschnitten; er hatte ein babyrosa Gesicht und aufrichtige Augen, die sicher viele unliebsame Dinge tun, aber nie jemand belügen würden.
„Wer ist eigentlich Schneider?“ fragte ich ihn, als die Scheite zu weißem Pulver verbrannt waren und das Feuer nur noch aus vier Strahlen blauer Flammen bestand.
„Kleins Neffe.“
„Und außerdem?“
„Bis vor ein paar Wochen hat er für Klein gearbeitet. Sie hatten eine Meinungsverschiedenheit und Ronnie hat seine eigene Firma, die Rolling Stones Promotions, gegründet, um diese Tournee zu veranstalten.“
„Was macht er außer dieser Tour für die Rolling Stones?“
„Absolut nichts“, sagte Steckler.
Nachdem alle schlafen gegangen waren, trug ich eine Schreibmaschine vom Büro in die Küche, schloss alle Verbindungstüren und schrieb mir selbst einen Brief von den Rolling Stones, in dem sie mich ihrer Zusammenarbeit versicherten. Ich tippte ihre Namen unten hin und ließ Platz für ihre Unterschriften. Dann trug ich die Schreibmaschine zurück und ging auf Zehenspitzen zu Bett.