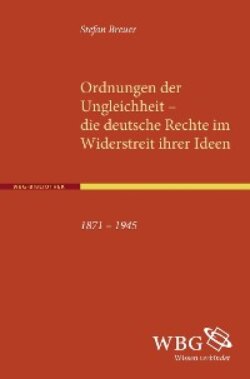Читать книгу Ordnungen der Ungleichheit – die deutsche Rechte im Widerstreit ihrer Ideen 1871 – 1945 - Stefan Breuer - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Entzauberter Chthonismus und Nationalismus in der Weimarer Republik
ОглавлениеRatzel, Moeller und Langbehn sind Autoren des Kaiserreichs, bei denen die Verbindung zur Naturphilosophie und Erkenntnistheorie des späten 19. Jahrhunderts noch unmittelbar zu erkennen ist. Nach 1918 reißt diese Verbindung ab, aus Gründen, die hier nicht erörtert werden können. Die Koppelung von Progression und entzaubertem Chthonismus hat sich jedoch über diese Schwelle hinweg erhalten, auch wenn die Begründungen dafür nun andere sind. Exemplarisch läßt sich dies an jenem Text zeigen, dem Thomas Mann seine Informationen über die ‘reaktionäre Romantik’ in der Hauptsache verdankt haben dürfte: Alfred Baeumlers großer Einleitung zur Bachofen-Auswahl Manfred Schröters (1926).
Baeumler schlägt sich in diesem Text zunächst ganz auf die Seite der Entzauberung, indem er diese als Befreiung und Entlastung deutet. Das ‘chthonische Wesen’, das sich zunächst in den archaischen Lokalkulten Griechenlands, später auch in der dionysischen Religion gezeigt habe, war in seiner Sicht bild- und gestaltlos und deshalb bedrohlich: „Das macht das Quälende alles chthonischen Wesens aus, daß es in der Tiefe verborgen ist, unsichtbar, unnahbar, unaussprechlich“ (Baeumler 1965, 75). Daß dieses Gestaltlose, ewig Wogende durch den Geist, durch die Kunst, insbesondere: durch die Tragödie gebannt wurde, erschien ihm als Fortschritt, als „Wendepunkt in der Geschichte des Abendlandes“ (79). Der dämonische Hintergrund sei dadurch gänzlich aufgelöst, die Macht des Zaubers und des Mythos gebrochen worden.
„Die Erscheinung des tragischen Kunstwerks ist das weithin leuchtende Zeichen dafür, daß die Macht der chthonischen Religionsweise, die durch den Siegeszug des Dionysischen ins Unüberwindliche gewachsen schien, in demselben Augenblick gebrochen ist, wo sich die Verehrung des Gottes durch Stiftung eines neuen großen Festes am tiefsten zu befestigen scheint. Homer hat den Griechen die Religion des olympischen Zeus geschenkt, aber Aischylos hat sie ihnen zum zweiten Male geschaffen: aus der Unterwelt hat der Schöpfer der Tragödie den Hellenen ihren Zeus zurückgegeben“ (82f.).
Im 19. Jahrhundert, so Baeumlers These, habe sich diese Konstellation wiederholt. Die dionysische Bewegung sei durch die Romantik erneuert worden, und zwar speziell durch die religiöse Romantik der Heidelberger, also Görres, Grimm, K. O. Müller und andere. Wieder sei die Macht der Erde, des Blutes, des Todes und der Mutter entdeckt, und wieder seien diese Mächte gebannt worden (172ff.): durch Bachofen, den Vollender und Überwinder der Romantik zugleich. Bachofen habe erkannt, „daß der Mythus das einmalige Ereignis der Kindheit der Menschheit sei und daß wir uns von diesem Ereignis nur immer weiter entfernen“ (267). Wie vor ihm schon Hegel habe er deutlich gemacht, daß das Heil der Menschheit nicht in der Vergangenheit, sondern in der Zukunft lag: „in der Annäherung an Apollon“. „Das Apollinische kann Gestalten annehmen, die durch den griechischen Gott Apollon nicht mehr bezeichnet werden. Eine dieser Gestalten ist das römische Recht als reines väterliches Recht. Die letzte und wichtigste Gestalt des apollinischen Prinzips ist das Christentum, das mit seiner ‘grundsätzlichen Negation’ des Stoffes den durch Apollon begründeten Spiritualismus befestigt und zum Abschluß bringt“ (227f.).
Baeumler begnügte sich indes nicht damit, Bachofen zu hegelianisieren. Er bestand auch umgekehrt auf einer „Bachofenisierung Hegels“ (Brunträger 1993, 57). Dem Spiritualismus Hegels und schon Fichtes hielt er entgegen, daß Geschlechtlichkeit, Familie und Pietät keine rein apollinischen Phänomene seien, sondern Naturverhältnisse, die nicht verdrängt werden dürften. Bachofens Leistung sei, gegenüber dem „allzu hoch gespannten paternalen Idealismus“ die „verachtete Natur“, die „verletzte Mutter“, wieder in ihre Rechte eingesetzt zu haben. Diese Rechte lägen zwar nicht auf politisch-staatlicher Ebene, welche ausschließlich als Domäne des Mannes bzw. des Männerbundes gedacht werden müsse; doch sei es möglich und nötig, sie in dem ihr zukommenden Bereich der Familie zu respektieren. Vor allem Ranke habe gezeigt, wie die Bande des Blutes für die Zwecke des Staates nutzbar zu machen seien. Und da der ganze Komplex von Mutter-Blut-Familienpietät-Ahnenkult in unauflöslichem Zusammenhang mit den chthonischen Mächten steht, läuft Bachofens Rehabilitierung des Muttertums auf eine indirekte Rehabilitierung der Erde und des Bodens hinaus – freilich im Rahmen einer Konzeption, die auf dem Primat des Apollinischen beharrt (Baeumler 1965, 237, 204, 299, 248, 59).
Baeumler hat diese Sichtweise schon bald zugunsten eines das Agonale verherrlichenden Nietzscheanismus aufgegeben. Die in der Bachofen-Einleitung hervortretende Legierung einer dynamisch-progressiven Tendenz und eines statischen Moments, in dem sich ein chthonischer Rest verbirgt, ist indessen auch bei anderen Vertretern des neuen Nationalismus erkennbar. Hans Freyer etwa, der in seiner Revolution von rechts das Kennzeichen der Moderne darin sieht, „daß der Mensch ohne wesentlichen Rest zum Gesellschaftswesen“ geworden sei (Freyer 1931a, 19), hält nichtdestoweniger eine „Revolution gegen diese Gesellschaftsordnung“ für möglich, die die Wiedergewinnung eines Bezuges zum Land und zur Erde erlauben würde (65f.). So könne jene Urkonstellation von formgebendem menschlichen (männlichen) Geist und empfangender (weiblicher) Erde erneuert werden, in der die letztere als Hort und Hegerin menschlicher Sinngehalte, als „Mutter unserer Werke“ fungiert und der erstere noch in seiner äußersten Freiheit „das Blut der Mutter“ bewahrt (Freyer 1925, 43; 1922, 5). Max Hildebert Boehm, der das Volk ganz ähnlich als primär gesellschaftliches Gebilde faßt, das durch sein geschichtliches Schicksal und nicht durch „die Erdverwerfungen urhafter Zeitalter“ bestimmt sei, kennt gleichwohl die „Dämonien des Bodens“ und die Bedeutung des Heimatsinns, durch den der einzelne wie die Gruppe „einem Stück Erde schicksalhaft verfallen und seelisch unter ihrer Gewalt“ bleibe. Auch in der erweiterten und sublimierten Gestalt, die die Heimat im Konzept des „Mutterlandes“ annimmt, „tönen noch die Stimmen der Erde“, spricht der „Geist der Mütter“ und hüllt das Raumbewußtsein in ‘chthonisches Dunkel’ (Boehm 1965, 82, 100, 102). August Winnig möchte den Staat im „Mutterboden des Volkstums“ verankert wissen, und sieht diesen seinerseits durch die „Eigennatur des umspannten Erdraums“ wie durch die „blutmäßige Zusammensetzung“ bestimmt (Winnig 1928, 15, 3, 5). Sogar Ernst Jünger, der in Großstadt und Land den Glauben an das Land als den „Glaube(n) eines untergehenden Bestandes“ entlarvt, „der, ohne es zu wissen, auf die Macht innerlich schon verzichtet hat“ und somit ein „Symbol der nationalen Krisis unserer Zeit“ ist (Jünger 1926e, 578) – sogar Ernst Jünger fordert für den neuen Nationalismus „strengste Bindung, Ordnung und Unterordnung, durch Gesellschaft, Blut und Boden bedingt“ (1926f, IX). Das Werdende sei
„auf das Elementare angewiesen, auf eine tiefere und dem Chaos nähere Schicht des Lebens, die noch nicht Gesetz ist, aber neue Gesetze in sich birgt. Dies ist das Wesen des Nationalismus, ein neues Verhältnis zum Elementaren, zum Mutterboden, dessen Krume durch das Feuer der Materialschlachten wieder aufgesprengt und durch Ströme von Blut befruchtet ist … Er ist die sichere Zuflucht zum mütterlichen Sein, das in jedem Jahrhundert neue Gestalten aus sich gebiert“ (1929, 581f.).