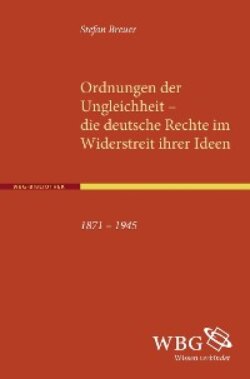Читать книгу Ordnungen der Ungleichheit – die deutsche Rechte im Widerstreit ihrer Ideen 1871 – 1945 - Stefan Breuer - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Anthropologie und Entropologie: Der gobinistische Rassenbegriff
ОглавлениеDie Einteilung der Menschheit in Rassen ist keine Erfindung der Moderne. Sie reicht weit zurück in die vormodernen Ordnungsmodelle der ‘gefallenen Natur’ (natura lapsa) und der ‘harmonischen Natur’ (oeconomia naturae), in denen die Geschöpfe die von Gott geschaffene Ordnung nicht zu ändern vermochten (GG V 135ff.; Sieferle 1989, 14f.). Auch wenn speziell im Rahmen des letztgenannten Modells, das sich im 18. Jahrhundert durchsetzte, den verschiedenen Spezies eine gewisse Plastizität eingeräumt wurde, fand diese doch ihre Grenzen in ein für allemal feststehenden Typen, deren Wesen prinzipiell unüberschreitbar war. Die Vertreter der physischen Anthropologie waren überzeugt, daß zwischen den anthropometrischen Merkmalen wie Schädelform, Hautfarbe, Körperbau und den Eigenschaften der Intelligenz und des sozialen Verhaltens eine Korrespondenz bestand, die es erlaubte, die Menschen in fest umrissene Einheiten zu gliedern – die Rassen.
Um die Mitte des 19. Jahrhunderts wurde dieses Konzept von Arthur Graf Gobineau in eine geschichtsphilosophische Konstruktion umgesetzt, die auf die deutsche Rechte einen erheblichen Einfluß ausgeübt hat. Gobineaus Ausgangspunkt war die Annahme, die Menschheit existiere nur in Gestalt von einigen Großgruppen, Rassen, die sich in vorgeschichtlicher Zeit, also noch im Horizont der Naturgeschichte, gebildet und seitdem ihre Merkmale bewahrt hätten. Die meisten dieser Rassen waren nach Gobineaus Überzeugung ‘verworfen’, d.h. unfähig, sich aus eigener Kraft zu zivilisieren; doch gab es immerhin eine „von der Vorsehung bestimmte Familie“, eine „Edelrace“, von der alles seinen Ausgang nahm, „was es an menschlichen Schöpfungen, Wissenschaft, Kunst, Civilisation, Großes, Edles, Fruchtbares auf Erden gibt“: die weiße Rasse, und in ihr speziell: die Arier, die ‘Ehrenhaften’ (Gobineau 1902–04, II, 13; I, 81; II, 8; IV, 308; I, XXI; II, 185). Sie verfügten über ein besonderes, kulturförderndes Blut, das auf dem Weg der Vererbung weitergegeben wurde und, indem es seine Besitzer mit einem „Monopol der Schönheit, der Intelligenz und der Kraft“ ausstattete, zugleich gesellschaftlich rangbildend wirkte (I, 42, 284). In diesem Sinn besaß der Naturstoff Blut zugleich eine magische Qualität: er war ein Talisman, der auf Befehl und Gehorsam beruhende Beziehungen stiftete (II, 124).
Wenngleich die Rassen nach Gobineau je für sich „in eine Art Individualität eingeschlossen“ waren, die als solche von ‘unzerstörbarer Dauerhaftigkeit’ war (I, 167, 187), gab es doch die Möglichkeit, durch Mischung aus dem Typus herauszugelangen. Für die Kultur war dies zunächst von Vorteil, gelangte das kulturfördernde Blut durch Mischung nun auch in solche Populationen, die aus eigenem Antrieb unfähig waren, irgend etwas hervorzubringen, während im Gegenzug die Geberrasse immerhin einige Eigenschaften empfing, die bestimmte, bei ihr schwächer ausgebildete Züge verstärkten, wie bspw. die künstlerische Befähigung. Auf die Dauer aber wirkten die Mischungen verhängnisvoll. Je mehr in ihnen das „leitende Racenelement“, welches allein für Kultur und Geschichte stand, sich völlig in den heterogenen Elementen auflöste, je dünner der Anteil an arischem Blut wurde, desto schwächer mußte die distanzierende und differenzierende Kraft werden, desto stärker der Trend zu Einheit und Egalität, zur „Mittelmäßigkeit auf allen Gebieten“, zu „Mittelmäßigkeit, man kann fast sagen Null, an Leibeskraft, an Schönheit, an Geistesgaben“ (IV, 319). Gobineaus Zukunftsprognose fiel deshalb düster aus: Auf die Zeitalter der Götter, der Heroen und des Adels folge nunmehr die „Aera der Einheit“, die nichts anderes sein werde als eine Nivellierung nach unten, zu einem Zustand, in dem sich alle Menschen glichen. Ende der Kultur, Ende des Wachstums, Ende der Geschichte: „Die Völker, nein, die Menschenheerden, werden alsdann, von düsterer Schlafsucht übermannt, empfindungslos in ihrer Nichtigkeit dahinleben, wie die wiederkäuenden Büffel in den stagnirenden Pfützen der pontinischen Sümpfe“ (IV, 319). In dieser Vorstellung eines rassischen Wärmetods der Kultur hat man zu Recht eine Parallele zu den Entropiemodellen gesehen, die in der zeitgenössischen Thermodynamik diskutiert wurden (Sieferle 1989, 138f.).
Der Essai sur l’inégalité des races humaines erschien von 1853 bis 1855, also noch vor Darwins Origin of Species (1859). So war es erst Georges Vacher de Lapouge, der den Gobinismus mit der biologischen Selektionstheorie verband. Lapouges Konzeption war einerseits enger als die Gobineaus, indem sie auf universalgeschichtliche Perspektiven weitgehend verzichtete und sich statt dessen ganz auf Europa, namentlich Frankreich und dessen demographische Krise, konzentrierte. Andererseits war sie weiter, insofern sie sich neuer naturwissenschaftlicher Methoden bediente, neben der darwinistischen Biologie auch der Phrenologie und Craniologie sowie der Theorie der diskreten Vererbung (Sieferle 1989, 146ff.; Mühlen 1977, 90f.,114f.).
Im Entscheidenden aber, im statischen oder konstanten Rassenbegriff, blieb Lapouge Gobineau verpflichtet. Wie dieser ging er von fixen Rassen aus, welche im Quartär entstanden seien und sich seitdem nicht weiter entwickelt hätten, „gleich als ob das Spiel der Mutationen sie damals plötzlich hervorgebracht und endgültig fixiert hätte“ (Lapouge 1908–1909, 420); wie dieser postulierte er die Ungleichwertigkeit der Rassen im Hinblick auf die soziale und kulturelle Befähigung; und er plazierte wie dieser an ihrer Spitze die Arier, weil sie über eine spezifische Naturbegabung verfügten: als race noble, race supérieure par excellence, waren sie der Motor der Geschichte, Schöpfer aller großen Kultur, allen Reichtums und aller Wissenschaft (Lapouge 1888, 16; 1887, 79f.).
Fatalerweise zog jedoch der aus dieser Eigenschaft resultierende soziale Aufstieg eine Verringerung der Fruchtbarkeit nach sich (Lapouge 1908–1909, 409f.), so daß sich die minderwertigen Elemente ungehemmt ausbreiten konnten. Aus der Mischung der Rassen ergab sich schließlich eine Bastardpopulation, die sich durch Inkohärenz der ererbten Merkmale, durch innere Disharmonie und Instabilität auszeichnete, kein Rassegefühl und keine Opferbereitschaft mehr besaß und den Fortbestand der Gattung hinter egoistischen Erwägungen zurückstellte (Sieferle 1989, 158f.). Als Folge verflüchtigte sich nicht nur die arische Oberschicht, sondern die Bevölkerung schrumpfte insgesamt. Zwar ventilierte Lapouge bereits die Möglichkeit, durch negativen und positiven „Eugenismus“ diesen Prozeß umzukehren, doch schien ihm dies, wenn überhaupt, nur noch in England und den USA möglich. In Kontinentaleuropa dagegen war aus seiner Sicht der point of no return bereits überschritten (Lapouge 1899, 341ff.; Sieferle 1989, 180).