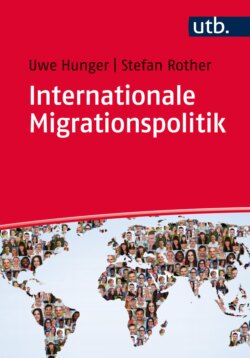Читать книгу Internationale Migrationspolitik - Stefan Rother - Страница 28
3.2 Genfer Flüchtlingskonvention und UNHCR
ОглавлениеAufgrund der schlimmen Erfahrungen aus zwei Weltkriegen und der daraus resultierenden Fluchtbewegungen hat die internationale Staatengemeinschaft nach dem zweiten Weltkrieg neue Rahmenbedingungen für die Aufnahme und Schutzgewährung von Geflüchteten geschaffen. Hierzu wurde im Jahr 1951 auf einer UN-Sonderkonferenz die Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) verabschiedet.1 Sie bildet seither die Grundlage des internationalen Flüchtlingsrechts.2 Hier wird definiert, wer als Geflüchteter gilt und welche staatlichen Schutzgarantien Geflüchteten zu gewähren sind. Zudem werden Hilfsmaßnahmen und die Rechte der Geflüchteten festgelegt. Bis heute haben 149 Staaten die GFK ratifiziert (UNHCR 2020).
Als zentrale Institution der internationalen Flüchtlingsvereinbarung wurde, ebenfalls im Jahr 1951, das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen gegründet, das Hochkommissariat der Vereinten Nationen für Flüchtlinge (engl. United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR). Der UNHCR ist in erster Linie für die Rechte der Geflüchteten und die Einhaltung der Genfer Konvention verantwortlich und soll weltweit in Krisengebieten vor Ort Hilfe leisten, wie das Organisieren von Camps für Geflüchtete und die Bereitstellung von Nahrung und Medizin (Loescher 2009). Der UNHCR ist von einer kleinen Behörde mit nur einem Kommissar (Gerrit Jan van Heuven Goedhart) und einem Sekretär im Jahr 1951 zu einer großen Organisation mit einer Belegschaft von heute über 17.000 Mitarbeiter*innen und einem jährlichen Budget von rund 8,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2018 angewachsen (UNHCR 2020). Dennoch leidet der UNHCR unter finanzieller Unterversorgung durch die UN-Mitgliedsstaaten und ist v.a. abhängig von den größten Beitragszahlern USA, EU, Deutschland, Schweden, Japan, Großbritannien, und Norwegen.
Vorgeschichte zur GFK
Bevor die GFK in Kraft gesetzt wurde, wurden Geflüchtete in bestehende Migrationskanäle integriert, wobei dies hauptsächlich nach ökonomischen Kriterien erfolgte. So wurden Geflüchtete, wie die russischen Geflüchteten, die ihr Land nach der Oktoberrevolution verlassen mussten, idealerweise in ein Land vermittelt, das Bedarf an Arbeitskräften hatte. Hierfür wurde 1922 der sog. Nansen-Pass eingeführt, mit dem ihnen die Weiterreise ermöglicht wurde. Für einige Jahre übernahm die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) die Vermittlung von Geflüchteten auf dem internationalen Arbeitsmarkt (Long 2013). So wurden Geflüchtete zu Arbeitsmigrant*innen gemacht. Die Kehrseite war, dass nicht universeller Schutz, sondern Kriterien wie berufliche Qualifizierung über ihre Aufnahme entschieden.
Im Zuge der Weltwirtschaftskrise in den 1930er Jahren brach dieses System aber weitgehend zusammen. Viele Länder schotteten sich auch vor den Geflüchteten des Naziregimes ab. Angesichts von Millionen Vertriebenen im Zweiten Weltkrieg wurden zunächst neue Institutionen geschaffen. Ein Beispiel ist die International Refugee Organization (IRO), deren Aufgaben seit 1952 vom UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR übernommen werden. Viele Staaten rechneten Geflüchtete auf ihre selbstdefinierten Zuwanderungsquoten an. Ob ein selbstbestimmtes Leben außerhalb von Lagern möglich war, hing dabei erneut von ökonomischen Faktoren ab. Die Sowjetunion brandmarkte Geflüchtetenlager als Sklavenmärkte, in denen sich westliche Mächte billige Arbeitskräfte besorgten. Für Long (2013) erklären solche Vorwürfe bis heute die Trennung in Geflüchtete und Migrant*innen sowie die Schwierigkeiten der internationalen Gemeinschaft, Geflüchtete auch als potenzielle Arbeitskräfte wahrzunehmen.
Neben den Pflichten, die Geflüchtete im Gastland erfüllen müssen, werden in der GFK vor allem die wichtigsten Rechte der Geflüchteten festgelegt, die bis heute die Grundpfeiler der internationalen Flucht- und Asylpolitik darstellen. So wird in Art. 31, Nr. l der GFK festgelegt, dass Geflüchtete, die unrechtmäßig in ein Land einreisen, um ihr Leben zu schützen, nicht bestraft werden dürfen. Auch ist es verboten, Personen, die in ein Land einreisen, um dieses um Asyl zu bitten, unter Zwang zurückzuweisen, wenn ihnen in dem Land, in das sie zurückgeschickt werden sollen, Verfolgung aufgrund ihrer Ethnie, Religion, Nationalität, politischen Einstellung oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe droht (Art. 33). Dieser Grundsatz der Nichtzurückweisung (Principle of non-refoulement) von 1951 beschränkte erstmals die nationalstaatliche Entscheidungsgewalt im Feld der Migration zugunsten der Menschenrechte (Martin 2018, S.278f.).
In Art. 1A Abs. 2 wird definiert, wann eine Person als geflüchtet im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention gilt. Demnach wird jede Person als Geflüchete*r anerkannt, die „aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen will“ (UNHCR 1951, Art. 1 A, Nr.2).
Wichtig ist hierbei zu sehen, dass in der Regel nur Personen als Geflüchtete anerkannt werden, die eine individuelle Verfolgung durch einen staatlichen Akteur glaubhaft machen können. Alle anderen Gruppen, die etwa vor nichtstaatlichen Akteuren fliehen, fallen nicht unter diese Definition (Hoesch 2018, S.22). Für sie wurde später, auf europäischer Ebene, die Kategorie der sog. subsidiär Schutzberechtigten eingeführt. Hierdurch wird eine Person geschützt, „die nicht die Voraussetzungen [der GFK] erfüllt, der aber dennoch ersthaften Gefahren für Leib und Leben, etwa aufgrund eines Bürgerkrieges, oder unmenschliche Behandlung drohen“ (UNHCR 2020), wie Folter oder Todesstrafe. In vielen Länder wird das internationale Flüchtlingsrecht zudem noch durch nationale Bestimmungen ergänzt, wie etwa in Deutschland durch das grundgesetzlich verankerte Recht auf Asyl sowie Abschiebeverbote (Hoesch 2018).
Art. 1 A, Nr.2 GFK geht zudem auch auf Staatenlose ein, die sich „infolge solcher Ereignisse [begründete Furcht vor Verfolgung wegen Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen politischer Überzeugungen] außerhalb des Landes“ befinden, „in welchem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hatte[n,| und nicht dorthin zurückkehren [können] oder wegen der erwähnten Befürchtungen nicht dorthin zurückkehren [wollen]“. Ein besonderes Augenmerk innerhalb dieser Gruppe gilt palästinensischen Geflüchteten, die in der Westbank, dem Gazastreifen, Jordanien, Syrien oder dem Libanon leben. Für diese Gruppe gibt es ein Sonderprogramm, die United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA), das bereits im Jahr 1949 als temporäres Hilfswerk der Vereinten Nationen gegründet worden war und das in Folge des ersten arabisch-israelischen Krieges3 (1947-49) die aus ihren Siedlungsgebieten vertriebenen Palästinenser*innen mit Hilfsleistungen unterstützen sollte.4 2019 gab es 5,6 Millionen anerkannte Geflüchtete nach UNRWA-Definition, laut der alle zwischen 1946 und 1948 aus Palästina Vertriebenen sowie deren Nachkommen als Geflüchtete gelten (UNHCR 2020).5
Die UNRWA bietet Programme in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Sozialleistungen und Rechtssicherheit, finanziert aber auch Mikrokredite und verbessert die Lebensbedingungen in 58 Geflüchtetenlagern, in denen ein großer Teil der palästinensischen Geflüchteten lebt (UNRWA 2019; Feldman 2012, S.390). Dabei lässt sich ein Wandel von der ursprünglichen Fürsorgefunktion hin zu Unterstützungsleistungen zur Selbsthilfe nachvollziehen, die auch verstärkt den Schutz von Menschenrechten beinhalten. Im Kontext der bewaffneten Konflikte in Syrien und im Irak hat die UNRWA gemeinsam mit dem UNHCR Schutzmaßnahmen für Palästinenser*innen in grenznahen Auffanglagern etabliert. Versuche der UNRWA, palästinensische Geflüchtete langfristig in den Aufnahmegesellschaften zu integrieren, werden allerdings von arabischen Aufnahmestaaten und auch von vielen Geflüchteten nach wie vor blockiert. Die Hilfsleistungen der seit Jahren unterfinanzierten UNRWA hängen außerdem zu über 90 Prozent an der Finanzierung durch wenige Hauptgeberländer (Akram 2016, S.7ff.; UNRWA 2020).
Aus der UNRWA-Sonderregelung ergibt sich in der Praxis eine Schutzlücke für die überwiegend staatenlosen palästinensischen Geflüchteten. So fallen UNRWA-Geflüchtete nicht unter den Schutz des UNHCR, da die UNRWA aus Sicht der Vereinten Nationen als separates Hilfsprogramm etabliert worden war. Die umfangreichen Regelungen des UNHCR zur Verantwortung von Drittstaaten gegenüber Geflüchteten (z.B. Resettlement) gelten demnach nicht für Palästinenser*innen in den arabischen Hauptaufnahmeländern. Lediglich palästinensische Geflüchtete außerhalb der UNRWA-Regionen können den Schutz des UNHCR in Anspruch nehmen, insofern sie unter die individualisierte Flüchtlingsdefinition der GFK (Art. 1A, Nr.2 fallen, s.o.). Zudem hat die UNRWA kein Mandat, um dauerhafte Lösungen zu finden, was die Möglichkeiten der Organisation gegenüber den fast zwölf Millionen Palästinenser*innen weltweit deutlich einschränkt (Akram 2016, S.6-9).
Der Israel-Palästina-Konflikt
Die Zuwanderung von Jüd*innen nach Palästina, das bis ins 19.Jahrhundert überwiegend arabisch geprägt war, begann bereits in den 1880er Jahren.6 Getragen von der Idee des Zionismus, also der Rückkehr in das ‚gelobte Land‘, immigrierten Jüd*innen aus aller Welt, um Antisemitismus und gesellschaftlicher Benachteiligung zu entfliehen. Die Errichtung eines israelischen Nationalstaates wurde schon früh zum erklärten Ziel der zionistischen Bewegung. In dem ab 1920 unter britischem Mandat stehenden Palästina kam es schon bald zu ersten, teilweise bewaffneten Konflikten zwischen der arabischen Mehrheitsbevölkerung und den jüdischen Siedler*innen, aber auch gegenüber den britischen Machthabern. Der Holocaust in Europa hatte in den 1940er Jahren nicht nur große Migrationsbewegungen nach Palästina zur Folge – die jüdische Bevölkerung umfasste schließlich über 600.000 Personen –, sondern verlieh dem Vorhaben eines jüdischen Staates auch zusätzliche Legitimität. Nachdem die britische Regierung ihr Mandat 1947 abgegeben hatte, einigten sich die Vereinten Nationen zunächst auf einen Teilungsplan (Zwei-Staaten-Plan), der jedoch von bürgerkriegsartigen Unruhen unterbrochen wurde. Die Unabhängigkeitserklärung Israels 1948 provozierte schließlich einen Krieg mit den arabischen Nachbarstaaten. Der Sieg Israels resultierte in der Vertreibung von 600.000-800.000 Palästinenser*innen, von denen mehr als die Hälfte in den Gazastreifen bzw. die Westbank umsiedelte. Viele suchten jedoch auch Zuflucht in den Nachbarländern, vor allem in Jordanien (70.000), Syrien (75.000), Libanon (100.000) und zu einem geringeren Teil im Irak und in Ägypten (Schneider 2008, S.1ff.).
Seit der Gründung des Staates Israel hat das Land, bedingt durch die weltweite Immigration aus der jüdischen Diaspora, einen durchweg positiven Wanderungssaldo. Die Bevölkerung ist im Jahr 2019 auf fast neun Millionen angewachsen, von denen nur noch ca. 21 Prozent arabischer Herkunft sind (Israel Central Bureau of Statistics 2020, S.6). Gleichzeitig leben rund 5,6 Millionen palästinensische Geflüchtete in Gaza, der Westbank (inkl. Ostjerusalem), Jordanien, Syrien und dem Libanon.
Neben Geflüchteten und Staatenlosen definiert der UNHCR zudem Asylbewerber*innen als eigene Kategorie. Hierbei handelt es sich um Flüchtende bzw. Migrant*innen, die von den offiziellen Stellen noch nicht als Geflüchtete (im Sinne der GFK oder im Sinne eines subsidiären Schutzes, s.o.) anerkannt worden sind. Ob ein Asylantrag angenommen wird, richtet sich nach den nationalen Asylgesetzen, die in der Regel den Grundsätzen der Genfer Flüchtlingskonvention folgen. Da in der Praxis nicht immer einfach zu entscheiden ist, ob es sich um erzwungene oder freiwillige Migration handelt, da sich in Migrationen politische mit wirtschaftlichen Gründen mischen können, wurde in den 1990er Jahren das Konzept der sog. ‚mixed migrations‘ entwickelt (Linde 2011). Hierbei ging es vor allem darum, die Unterscheidbarkeit von erzwungener und freiwilliger Migration zu erleichtern, und Geflüchteten zu helfen, Arbeit aufnehmen und ein normales Leben führen zu können. Die Vermischung beider Wanderungen ist insbesondere für humanitäre Hilfsorganisationen schwierig, weil diese häufig an ein bestimmtes politisches Mandat (z.B. den Schutz einer bestimmten Gruppe wie etwa Geflüchtete) gebunden sind.
Der UNHCR hat jedoch dazu aufgerufen, auch migrierenden Menschen, die keine Geflüchteten sind, Schutz zu bieten und die Gefahren, denen sie sich bei der Wanderung aussetzen, anzuerkennen. Dieses Signal ist besonders wichtig, da diese (äußerst diverse) Gruppe ansonsten keinerlei Fürsprechende hat, die sich für sie einsetzen. Damit überschreitet der UNHCR zwar sein Mandat, füllt aber eine wichtige Lücke aus.
Schutz von Geflüchteten und gemischte Wanderungen
Der UNHCR hat sich bereits früh mit dem Problem der gemischten Wanderungen auseinandergesetzt, um die Gefahren, denen Menschen, die migrieren, ausgesetzt sind, ins Bewusstsein zu bringen und deren Menschenrechte zu wahren. Er hat hierfür ein Zehn-Punkte-Programm aufgestellt, mit dessen Hilfe Migrant*innen, die keine Geflüchteten sind, geschützt werden sollen (UNHCR 2007, S.1-2). Die Punkte umfassen u.a. mehr Kooperation der beteiligten Hilfsorganisationen, eine Verbesserung der Datenlage sowie die Entwicklung einer Informationsstrategie, mit der mehr Sicherheit auf der Wanderungsroute und mehr Aufnahmemöglichkeiten für die Geflüchteten geschaffen werden sollen. Zudem soll eine unterstützte Rückkehr gefördert werden.
Einen ähnlichen Ansatz verfolgt der North Africa Mixed Migration Hub (MHub). Er setzt sich für den Schutz von Migrierenden in Nordafrika ein. U.a. sammelt er Daten zum Verstoß gegen Menschenrechte, die Politik und Öffentlichkeit aufrütteln sollen. Auch der MHub verweist auf die komplexen Wanderungsbewegungen unterschiedlichster Menschen mit unterschiedlichsten Migrationsmotiven. Er betont aber, dass all diese Menschen ständig Gefahren ausgesetzt sind. Er setzt sich damit für den Schutz der Menschenrechte ungeachtet der Form der Migration ein (MHub 2016, S.1).
Daneben hat der UNHCR auch ein Mandat für die oben angesprochenen Binnengeflüchteten, die innerhalb ihres Heimatlandes flüchten, und von der UNHCR offiziell als „Internally Displaced Persons“ (s.o.) bezeichnet werden. Wie wir schon gesehen haben, machen sie den größeren Teil der weltweit Geflüchteten aus. Obwohl sie häufig aus den gleichen Gründen fliehen (bewaffnete Konflikte, Menschenrechtsverletzungen), verbleiben sie jedoch im Gegensatz zu internationalen Geflüchteten unter dem Schutz des Rechtssystems ihres Staates (UNHCR 2014). Dennoch ist klar, dass auch diese Gruppe internationalen Schutzes bedarf, insbesondere wenn die eigene Regierung der Grund für ihre Flucht ist, wie man aktuell in Syrien sieht.
Abbildung 18:
Entwicklung der Zahl der Geflüchteten weltweit 1951-2019 (inkl. Binnenvertriebene) (in Millionen)
Quelle: UNHCR 2020.
Über die Hälfte der weltweit flüchtenden Menschen sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Viele von ihnen flüchten sogar alleine, ohne die Begleitung ihrer Eltern oder sie werden auf der Flucht von ihnen getrennt. Im Jahr 2015 wurden weltweit knapp 100.000 unbegleitete geflüchtete Kinder und Jugendliche außerhalb ihrer Herkunftsländer registriert (UNHCR 2017). Diese Gruppe der unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten gehört zu der Gruppe der „besonders schutzbedürftigen Personen“ (Müller 2014, S.10). Sie sind auf der Flucht oftmals besonderen Gefährdungen ausgesetzt, werden häufig Opfer von Gewalt, Konflikten und auch Ausbeutung. Aus diesen Gründen benötigen sie besonderen Schutz und Aufmerksamkeit (Müller 2014, S.10). Besonders problematisch ist ihre Situation an der US-amerikanischen Grenze. Hier werden trotz strenger Gesetze und Richtlinien Kinder immer wieder inhaftiert und sogar vermisst gemeldet.
Neben den UNHCR-Institutionen gibt es noch zahlreiche weitere weltweit agierende supra- und interstaatliche Institutionen und Organisationen. Dazu zählt u.a. auch die Internationale Organisation für Migration (IOM), die ebenfalls 1951 gegründet wurde. Die IOM ist eine Serviceorganisation mit 166 Mitgliedstaaten. Sie führt vor allem Hilfsprogramme durch, deren Hauptzielrichtung die Rückführung ist. Sie wird von Menschenrechtsorganisationen häufig dafür kritisiert, dass sie die Rechte der Migrant*innen nicht ausreichend schützt (→ 13 Global Migration Governance). Auch die EU kann als ein wichtiger Akteur im internationalen Fluchtregime angesehen werden. Die EU richtete 1992 eine Generaldirektion für humanitäre Hilfe ein und ist in nahezu allen Krisenregionen der Welt aktiv. Zudem ist die EU einer der größten Geber von Entwicklungsgeldern zur Bekämpfung von Fluchtursachen. Weitere intergouvernementale Behörden sind z.B. das World Food Programme (WFP) und der United Nations Children’s Fund (UNICEF).
Neben staatlichen Institutionen und Organisationen entstanden zunehmend auch Nichtregierungsorganisationen (NGOs), die sich für die Rechte und den Schutz von Geflüchteten einsetzen und oftmals staatlichen Institutionen kritisch gegenüberstehen. Diese spielen aufgrund ihrer wachsenden Einflussmöglichkeiten eine immer größere Rolle im internationalen Fluchtregime. Dazu gehören OXFAM, Terre des Hommes, Cap Anamur, Ärzte ohne Grenzen, CARE International sowie No Border Network, Human Rights Watch, das International Rescue Committee (IRC) und weitere international agierende NGOs. Aufgrund ihrer schlanken Strukturen und relativ kurzen Entscheidungswege sind NGOs häufig flexibler und damit zu schnellerer Hilfe in der Lage als staatliche Stellen (Neumayer 2016). Es wird daher von vielen Seiten gefordert. NGOs einen größeren Stellenwert im internationalen Fluchtregime zu geben (Loescher 2001; Keely 2001; Castles und Miller 2009; Kosher 2012) (zum Regimebegriff auch → 2 Migrationstheorien).