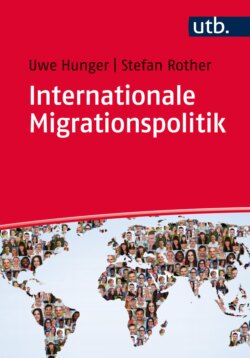Читать книгу Internationale Migrationspolitik - Stefan Rother - Страница 32
3.6 Fazit und Ausblick
ОглавлениеWie der Überblick gezeigt hat, ist das Thema Flucht und Asyl einer der komplexesten Bereiche internationaler Migrationspolitik. Obwohl die Notwendigkeit zur Aufnahme von internationalen Migrant*innen hier am größten ist, scheint die Bereitschaft der Nationalstaaten zur Aufnahme am wenigsten ausgeprägt. Daher ist es wichtig, gemeinsame Lösungen auf supranationaler Ebene anzustreben, so dass nicht einzelne Nationalstaaten den Hauptteil der Last tragen und andere sich aus der Verantwortung stehlen. Mit der Verabschiedung der Genfer Flüchtlingskonvention ist hier im Grunde ein richtiger und wichtiger Schritt gelungen. Allerdings stellt sich immer mehr die Frage, ob der Begriff des „Flüchtlings“, wie er in der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 rechtlich gefasst wurde, heute noch zeitgemäß ist. Flucht findet heute, wie wir gesehen haben, nicht mehr allein aufgrund politischer Verfolgung auf Grundlage der Ethnie, Religion, Nationalität usw. statt. Seit einigen Jahrzehnten verfestigt sich der Trend, dass Menschen eher vor Konflikten und wegen Umweltkatastrophen als vor direkter Unterdrückung und Verfolgung durch staatliche Institutionen fliehen (Zolberg und Benda 2001).
Klima- und Umweltmigration
Heute fliehen in vielen Ländern Menschen auch wegen der jahrelangen Ausbeutung ihres Landes, etwa der Bodenschätze, was dazu geführt hat, dass vielen Menschen in ländlichen Gebieten die Lebensgrundlage entzogen wurde (Ansorg 2017). Andere Migrant*innen fliehen vor Umweltkatastrophen, wie z.B. lange Dürreperioden und Verwüstungen. Insbesondere Umweltgründe werden heute noch nicht von den Kriterien der Geflüchtetendefinition erfasst. Die Vereinten Nationen begründen diesen Umstand unter anderem damit, dass der bestehende Geflüchtetenstatus nicht verwässert werden soll (Piguet et al. 2011, S.1, 17ff.; Windfuhr 2018, S.120). Dabei rechnet man damit, dass gerade die Zahlen in dieser Kategorie in den nächsten Jahrzehnten stark ansteigen werden. Die Prognosen hierzu schwanken zwischen 50 und 250 Millionen bis zum Jahr 2050 je nach Berechnungsgrundlage. Und schon heute können erste Klima-Geflüchtete ausgemacht werden, darunter aus den pazifischen Inselstaaten, deren Bevölkerung bedingt durch den steigenden Meeresspiegel und zunehmende Küstenerosion zur Umsiedlung gezwungen wird (Fritz 2010). Dieser Kampf um Begriffe und Kategorien hat für Millionen Betroffene bedeutende Folgen. Betts (2010) schlägt deshalb mit der „Survival Migration“ eine neue Kategorie vor. Diese soll alle Menschen umfassen, die ihr Herkunftsland aufgrund einer unabwendbaren existentiellen Bedrohung verlassen. Damit ließen sich laut Betts die aufgezeigten Lücken im institutionellen und normativen Rahmen für Zwangsmigration füllen, ohne dass neue Institutionen oder Konventionen erschaffen werden müssten.