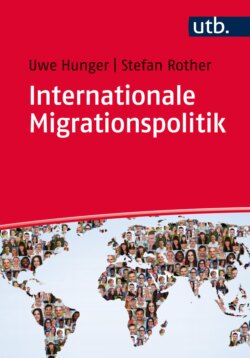Читать книгу Internationale Migrationspolitik - Stefan Rother - Страница 38
4.4 Soziale Rechte von Wanderarbeiter*innen
ОглавлениеWie aus der bisherigen Darstellung bereits deutlich geworden ist, ist ein zentrales Thema bei der Arbeitsmigration von gering Qualifizierten die Frage der Wahrung der sozialen Rechte der Arbeitsmigrant*innen. Das Kernproblem besteht dabei darin, dass die Arbeitsmigrant*innen weitgehend abhängig von den arbeits- und sozialrechtlichen Vorgaben des jeweiligen Aufnahmelandes sind. Der Einfluss internationaler Normen oder ihres jeweiligen Herkunftslandes ist relativ gering. Auch inländische Schutzmechanismen greifen oftmals nicht, da Arbeitsmigrant*innen oft am Rande oder außerhalb der regulären Arbeitsgesetze und -vorschriften, zum Teil regulär und zum Teil irregulär, beschäftigt werden. Für skrupellose Arbeitgeber*innen sind sie daher besonders leicht auszubeuten, und auch in den Betrieben und auf dem Arbeitsmarkt erleben sie häufig Ablehnung, Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung. Oftmals haben sie auch geringeren sozialen Schutz in Form von Krankenversicherung, Unfall- oder Altersvorsorge.
Um Ausbeutung und soziale Benachteiligung von Arbeitsmigrant*innen zu verhindern oder zumindest zu vermindern, wird auf internationaler Ebene seit vielen Jahren versucht, internationale Schutzstandards zu definieren, an die sich nationale Regierungen ebenso wie die Arbeitgeber*innen halten müssen. Hierbei kommt der Internationalen Labour Organisation (ILO) eine zentrale Rolle. Die ILO wurde 1919 auf der Basis der Erfahrungen des 1. Weltkriegs als eine der ersten internationalen Organisationen gegründet, die den Ausbau der internationalen Kooperation zum Ziel hatte. Ihr Bestreben war und ist es, sich weltweit für gerechtere Arbeitsverhältnisse einzusetzen, um so, wie in der Präambel der ILO heißt, den Frieden auf der Welt zu fördern, der „auf Dauer nur auf sozialer Gerechtigkeit aufgebaut werden“ könne (ILO 2012).
Die Gestaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen der Beschäftigung von Wanderarbeiter*innen, so der Duktus der ILO, stellt dabei einen Schwerpunkt ihrer Arbeit dar. Insbesondere nach dem 2. Weltkrieg wurden eine Reihe von international bindenden Übereinkommen (Conventions) beschlossen, die den Schutz von Arbeitsmigrant*innen und ihrer Familien (zur Bedeutung des Familiennachzug siehe → 6 Migration und Gender) fördern sollen. Besonders zentrale Übereinkommen sind
das Übereinkommen über Wanderarbeiter*innen aus dem Jahr 1949 (Nr.97),
das Übereinkommen über die Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf aus dem Jahr 1958, in Kraft getreten 1960 (Nr.111),
das Übereinkommen über Missbräuche bei Wanderungen und die Förderung der Chancengleichheit und der Gleichbehandlung der Wanderarbeitnehmer*innen aus dem Jahr 1975, in Kraft getreten 1978 (Nr.143), und
das Übereinkommen über menschenwürdige Arbeit bei Hausangestellten aus dem Jahr 2011 (Nr.189).
In den Übereinkommen werden Grundsätze zur Behandlung von Arbeitsmigrant*innen formuliert, die für alle Unterzeichnerstaaten bindend sein sollen (→ auch 13 Global Migration Governance). Das Problem dieser Konventionen ist einerseits, dass bei weitem nicht alle ILO-Mitgliedstaaten die Übereinkommen unterzeichnet haben und gerade wichtige Zielländer von Arbeitsmigrant*innen bei den Unterzeichnerstaaten fehlen. Anderseits fehlen Möglichkeiten, um Zuwiderhandlungen gegen die Konventionen zu sanktionieren. Unter dem Strich bleibt daher Politik und Rechtsverständnis gegenüber Arbeitsmigrant*innen bis heute fast ausschließlich „eine alleinige Angelegenheit der Nationalstaaten“ (Angenendt 2006, S.49). Wir gehen im → Kapitel 13 Global Migration Governance noch weiter auf dieses Problem ein.
Vor diesem Hintergrund kommt den nationalen Organisationen, insbesondere Gewerkschaften, eine wichtige Rolle beim Arbeitnehmer*innenschutz von Migrant*innen zu. Das 1948 von der ILO verabschiedete und 1950 in Kraft getretene Übereinkommen über die Vereinigungsfreiheit und den Schutz des Vereinigungsrechtes (Nr.87) sieht vor, dass Migrant*innen das Recht der Vereinigungsfreiheit in Gewerkschaften nicht vorenthalten werden darf („Workers and employers, without distinction whatsoever, shall have the right to establish and, subject only to the rules of the organization concerned, to join organizations of their own choosing without previous authorization (Article 2)“. In vielen Ländern, darunter auch Deutschland, gab und gibt es auch immer wieder Gründungen von sog. Migrant*innengewerkschaften, die für ihre Rechte als Arbeitnehmer*innen im Ausland einstehen. In einigen Ländern, wie Malaysia, werden ausländische Arbeitnehmer*innen dennoch von der gewerkschaftlichen Beteiligung ausgeschlossen. In anderen Ländern, wie den Golfstaaten, spielen Gewerkschaften eine eher schwache oder überhaupt keine Rolle. Der Schutz von Arbeitsmigrant*innen ist und bleibt daher eine der drängendsten sozialen Fragen des 21. Jahrhunderts.