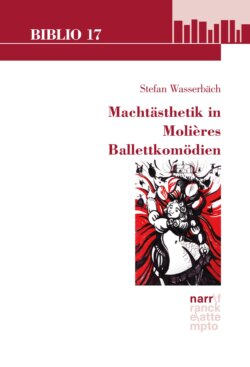Читать книгу Machtästhetik in Molières Ballettkomödien - Stefan Wasserbäch - Страница 24
2.2 Sujetstruktur
ОглавлениеDie Ebene der Geschichte spielt im Hinblick auf die Dramenstruktur eine entscheidende Rolle, da sie als Bezugspunkt für die einzelnen Kommunikationsebenen gilt. Vor dem Hintergrund eines Sinngehalts der Geschichte lässt sich das Ereignis beziehungsweise Sujet als ihr thematischer Kern verstehen. Sein Gerüst wird aus dem kulturellen System, aus welchem der literarische Text entspringt, zusammengesetzt und künstlerisch verdichtet respektive modelliert. Der Kultursemiotiker Jurij Lotman geht davon aus, dass das Sujet ein semantisches Feld ist, das in zwei komplementäre Teilmengen gegliedert ist und die binäre Struktur von Kulturmodellen reflektiert.1 Die Sujethaftigkeit in künstlerischen Texten substanziiert sich immer in ihrem Verhältnis zum kulturellen Leitbild der Norm. Einerseits kann die klassifikatorische Grenzlinie zwischen den beiden Bereichen überschritten werden, sodass Texte als revolutionär bezeichnet werden können, sofern die Grenzziehung missachtet wird und der Held sich im neu betretenen Teilbereich etabliert. Andererseits kann die Grenzlinie respektiert werden, sodass Texte als restitutiv bezeichnet werden können, sofern der Held innerhalb eines Teilbereichs verweilt.2 Dergestalt stellt die Versetzung einer Figur über die Grenze eines semantischen Feldes ein Ereignis innerhalb der Geschichte dar.3 Die Anordnung von Ereignissen bildet die übergeordnete Handlungsstruktur, also das Sujet, sodass das Ereignis im Umkehrschluss „die kleinste unzerlegbare Einheit des Sujetaufbaus“4 darstellt. Die Entfaltung eines Ereignisses respektive der Übergang über eine semantische Grenzlinie ist somit als Sujet zu bezeichnen.5 Das Sujet kann entweder assimilierend in Bezug auf die Kohärenz einer alten Ordnung oder akkommodierend in Bezug auf eine neue, noch vage Kohärenz wirken.6 Daraus ergibt sich, dass die Sujethaftigkeit in verschiedene Abstufungen einzuteilen ist.
Die verschiedenen Grade der Sujethaftigkeit sind nach Lotman mit den Termini ‚Ereignis‘ und ‚Metaereignis‘ zu fassen und hängen davon ab, ob das Ereignis reversibel oder irreversibel ist:7 Der Begriff ‚Ereignis‘ ist hierarchisch als Oberbegriff einzelner Ereignisse zu verstehen und impliziert auf dieser Ebene eine Aktion, die eintritt, wenn eine Figur die Grenze zweier semantischer Räume8 übertritt, allerdings das System dieser semantischen Räume in der dargestellten Welt dabei „in der Zeit invariant“9 bleibt und sich nur der Zustand der Figur verändert, die Weltordnung aber in ihrer Konstanz erhalten bleibt. Für ein Ereignis ist es irrelevant, ob es sich physisch konkret oder innerhalb der Psyche der Figuren zuträgt. Es restituiert folglich die Ausgangssituation der Handlungswelt in der Komödie. Dagegen liegt ein Metaereignis dann vor, wenn eine Figur die Grenze zweier semantischer Räume überschreitet, allerdings infolgedessen das System dieser semantischen Räume in der dargestellten Welt „selbst in der Zeit transformiert wird“10 und sich nicht nur der Zustand der Figur verändert, sondern auch die Weltordnung modifiziert wird. Es revolutioniert folglich die Ausgangssituation der Handlungswelt in der Komödie. In letzter Konsequenz verlieren etablierte Ordnungsgrundsätze der Handlungswelt ihre semantischen Räume.
Die in Molières Ballettkomödien existierenden Metaereignisse bedürfen einer weiteren Erklärung. Obschon sich das Weltbild tatsächlich ändert, sind die Reichweite und deren revolutionäre Wirkung beschränkt, fehlt doch das ästhetische Handlungskohärenzkriterium der innerfiktionalen vraisemblance, die in der Klassik auf dem Kompositionsprinzip der raison fußt. So kann beispielsweise die Rechtfertigung für die gezogene semantische Grenzlinie innerhalb der Fiktion fehlen und die Fiktion dennoch sinnfällig erscheinen. Außerdem kann die Handlungswelt verfremdet in einem exotischen respektive märchenhaften Raum-Zeit-Universum dargestellt werden und die schicksalhaften, übermenschlichen Fügungen können nur indirekt mit der höfischen Weltordnung korrespondieren. Es fehlt ein apodiktischer, lebensweltlich legitimierter Maßstab innerhalb der Fiktion, der diese Metaereignisse bedingt mit dem zeitgenössisch-kulturellen Kontext in Einklang bringen lässt. Unter Berücksichtigung dieser Einschränkungen ist hinsichtlich des Grenzgängertums von einem limitierten Metaereignis zu sprechen.
Der von Andreas Mahler eruierte frühneuzeitliche Sujetwandel11 impliziert verschiedene Grade der Sujethaftigkeit literarischer Texte, die zu Molières Zeiten vorwiegend im Theater ausgedrückt werden. Transformation gestaltet sich in der Tragödie weitaus stärker als in der Komödie, da in Letzterer das Konstruktionsprinzip in Zusammenhang mit dem Auftreten des Komischen und seiner Aufhebung steht.12 In Molières Ballettkomödien greift dieses Restitutionsprinzip nicht mehr ganz. Das dynamische Moment des Sujetumbruchs gibt sich darin deutlich zu erkennen, dass die Aufhebung des Komischen an manchen Stellen nicht mehr stattfindet. Die konfliktive Situation wird einfach überspielt, hinweggespielt. Es manifestieren sich neue Strukturen, die unterschwellig auf ein Metaereignis hinweisen, da der Konflikt am Ende der Komödie nicht aufgelöst, sondern mittels musikalischer und tänzerischer Einlagen fortgetragen wird. Das moralische Substrat wird ästhetisch neutralisiert, seinem moralischen Duktus enthoben. Die transformierte Handlungswelt besteht weiterhin ohne die Restitution der alten Ordnung fort, allerdings unter dem Deckmantel einer List, die den subversiven Charakter des Sujets maßgeblich mitprägt.
Unter diesem Gesichtspunkt erscheint es notwendig, eine dritte Abstufung der Sujethaftigkeit zu etablieren, das Pseudo-Metaereignis, das – so meine Definition – dann vorliegt, wenn eine Figur die Grenze zweier semantischer Räume konspirativ übergeht, allerdings infolgedessen das System dieser semantischen Räume in der dargestellten Welt hypothetisch im Sinne eines metafiktionalen ‚Als-ob‘ „selbst in der Zeit transformiert wird“ und sich der Zustand der Figur verändert. Die Weltordnung wird mit einer List modifiziert und es findet keine heldenhafte Konfliktaustragung, keine Endbereinigung statt. Das Pseudo-Metaereignis revolutioniert folglich die Ausgangssituation der Handlungswelt in der Komödie, obgleich die Reaktion auf die Grenzüberschreitung ausbleibt, da die Geschichte vorzeitig endet und mit Balletttänzen ausklingt. Da die Endsituation im Einklang mit den Intentionen der vermeintlich reüssierenden Figur steht, zeigt dieses Schauspiel ein Potenzial an subversiven Elementen auf. Das Theaterstück divergiert sowohl vom eigentlich herrschenden Weltbild der Handlungswelt in der Komödie als auch von der tatsächlichen Wirklichkeitserfahrung der Zuschauer, sodass ein komplexer Grenzraum zwischen gesellschaftlicher Referenzialität und (meta-)theatraler Fiktion entsteht. Diese Komödien enden im Zeichen des Scheins eines Metaereignisses, sind aber aufgrund der inszenierten Täuschung in ihrer Sujethaftigkeit als Pseudo-Metaereignisse zu bezeichnen. Ein limitiertes Metaereignis grenzt sich schließlich von einem Pseudo-Metaereignis dadurch ab, dass hier eine objektive Weltbildtransformation gelingt und sonach ein höheres revolutionäres Potenzial impliziert ist. In Anbetracht der Tatsache einer Koexistenz von Pseudo-Metaereignissen und limitierten Metaereignissen spiegeln Molières Ballettkomödien gesellschaftliche Umbrüche in ihren Sujethaftigkeitsgraden wider.
Für die Erfassung der Sujethaftigkeit der Komödien spielt die Struktur der einzelnen Sujetschichten eine wichtige Rolle, die wiederum im Hinblick auf die Bestimmung der komischen Agone relevant sind. Die erläuterten Zusammenhänge lassen erkennen, dass sich das künstlerische Sujet in verschiedene Schichten unterteilen lässt, da die sujetkonstitutiven Ereignisse einen Knotenpunkt von textexternen und -internen Weltsystemen bilden. Sie werden sowohl auf den lebensweltlichen Kontext hin zugeschrieben als auch bedeutsam im Hinblick auf ihren binnenfiktionalen Handlungsweltkontext. Die Hauptsujetschicht orientiert sich am kulturellen System, da dieses den Maßstab für die Sujethaftigkeit literarischer Texte bildet; sie ist als Grundstruktur zu bezeichnen. Ergänzend treten textspezifische Nebensujetschichten hinzu, die auf dieser Grundstruktur beruhen, sich aber aus dem textinternen Normenverständnis ergeben, welches sich in Molières Ballettkomödien aufgrund unmoralischer wie auch amoralischer Verhaltensweisen der Figuren in der Handlungswelt konstituiert. Es ist davon auszugehen, dass beide Schichten in einem Interdependenzverhältnis zu den genannten Kommunikationsebenen stehen.13 Daraus folgt, dass die Sujetebenen als „Ermöglichungsmomente für bestimmte Vermittlungsformen“14 begriffen werden. Der thematische Kern der Ballettkomödie entfaltet sich über die verschiedenen Sujetschichten und die Kommunikationsebenen. Doch worin besteht dieser thematische Kern in Molières Ballettkomödien?