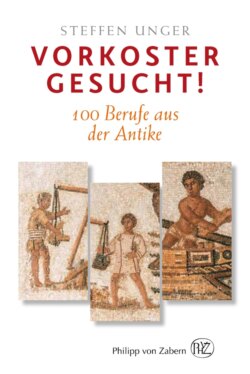Читать книгу Vorkoster gesucht! - Steffen Unger - Страница 36
ОглавлениеJuristisches
Die Jurisdiktion der alten Griechen und Römer war auf zahlreiche Gerichtshöfe verteilt. Sie war entweder Teil des Aufgabenbereichs von Institutionen wie dem Areopag oder dem Rat, wenn es um politische Delikte oder Bluttaten ging, oder es wurden Gremien für spezielle Strafsachen eingerichtet. Über viele Fälle entschieden auch die anwesenden Bürger als Mitglieder eines Volksgerichts.
Heliastes und Dikastes – viele dürfen mal
Heliaia bedeutete ursprünglich „Volksversammlung“; es konnte sich aber auch um eine andere politisch-juristische Institution handeln. In Athen war es ein großes Geschworenengericht, dessen Mitglieder, die heliastai, sich seit Solon aus dem versammelten Volk zusammensetzten und unter freiem Himmel auf der Agora zugleich als Geschworene und Richter tätig wurden. Aufgrund etlicher Prozesse entstanden in klassischer Zeit selbstständige Abteilungen, Dikasterien genannt. Ihnen saßen die Thesmotheten vor, doch hatten diese wie etwa die Prätoren in Rom die Fälle lediglich vorbereitet – die Urteile fällten letztlich die dikastai. Dazu wählten sie Kiesel oder Muschel bzw. einen vollen oder gelochten Stimmstein, die bzw. den sie in die entsprechende Stimmurne – oder in eine Ersatzurne – warfen.
Bei Heliasten und Dikasten handelte es sich also um Laienrichter. Sie besaßen Bürgerstatus, durften keine Schulden beim Staat haben und mussten mindestens dreißig Jahre alt sein. Sie stammten aus allen attischen Phylen und meldeten sich freiwillig; 6000 wurden zu Jahresbeginn und die Anwesenden später täglich festgelegt und auf die Dikasterien verteilt. Damit wurde Bestechung erschwert. Je nach Ausmaß der Straftat war eine unterschiedliche Anzahl an dikastai Voraussetzung. Seit Mitte des 5. Jahrhunderts v. Chr. wurden die Laien für jeden Gerichtstag bezahlt, und zwar aus der Gerichtskasse, die sich mit Bußgeldern und Prozessgebühren füllte.
Der vielleicht erste hingerichtete Philosoph Eins der berühmtesten Urteile der Antike fällte ein athenisches Volksgericht: Es verhängte über den Philosophen Sokrates 399 v. Chr. die Todesstrafe durch den Schierlingsbecher. Die Gründe waren Nichtachtung der alten und Verehrung neuer Götter sowie Verführung der Jugend. Frühe Christen verglichen Sokrates mit Jesus.
Diaitetai: in privaten oder auch öffentlichen Streitfällen von den Parteien bestellte Schiedsrichter, und zwar oft drei, da jede Partei eine Person ihres Vertrauens stellte und diese beiden sich auf eine dritte, quasi „unparteiische“ einigten. Mit diaitetai waren alle älteren Athener wie beispielsweise der berühmte Hypereides im Jahr 330 v. Chr. gemeint, die verpflichtet waren, die Thesmotheten zu vertreten. Sie konnten den Fall beenden oder ihn bei Klage einer der Prozessparteien an ein Gericht weitergeben.
Ephetai: die Geschworenen dreier Kollegien, die als Gerichte neben dem Areopag, von dessen Mitgliedern sie ernannt wurden, vorrangig Tötungsdelikte untersuchten, in ihrem Fall eher unvorsätzliche; von Drakon eingerichtet; den Vorsitz hatte der archon basileus.
Nautodikai: ein im klassischen Athen eingerichtetes See(manns-)richterkollegium, das sich mit dem komplexen Seehandelsrecht im attischen Seereich befasste. Wie die xenodikai (Fremdenrichter) urteilten sie über Fremde (nicht Metöken), die vorgegeben hatten, Bürger zu sein. Auflösung beider Gremien Mitte des 4. Jahrhunderts v. Chr.; die xenodikai fungierten auch in anderen Poleis in verschiedenen Streitfällen, zum Beispiel als Beamte (nicht als Richter), und sind gewissermaßen das Pendant zum praetor peregrinus.
Synegoros: eine Person, die zumindest in klassischer Zeit offiziell unentgeltlich vor dem Dikasterion „Partei ergreift“, also mit dieser zusammen anklagt oder verteidigt (nicht der logographos).
Die Vierzig: ein athenisches Kollegium mit vier Vertretern aus jeder Phyle. Sie behandelten private Streitigkeiten, deren Wert maximal zehn Drachmen betrug. Sie waren also mit etlichen, insgesamt jedoch eher unbedeutenden Fällen beschäftigt.
Die Logografen – Meister des Wortes
Logographoi waren geschickte Rhetoren, die als Redner im klassischen Griechenland auch ohne politisches Amt zu Ansehen und Einfluss kommen konnten. Ihre eigentliche Einnahmequelle war neben Grundeigentum oder vielleicht einer Werkstatt das Verfassen von Schriften, vor allem von Gerichtsreden. Eine solche Auftragsarbeit las der Angeklagte oder der Ankläger während des Prozesses selbst vor, während der „Redenschreiber“ im Hintergrund blieb, falls er nicht wie Hypereides auch als synegoros auftrat. Isokrates etwa, der nicht als Redner auftrat, aber bedeutende Reden schrieb, hatte erfolgreich als Logograf gewirkt, bevor er eine Schule für Redner eröffnete.
In Rom konnten hohe Magistrate – Konsuln, Prätoren, Volkstribunen oder außerordentliche Amtsträger –, der Senat oder einige andere Gremien – etwa die tresviri capitales – als Richter fungieren. Seit Mitte des 2. Jahrhunderts v. Chr. entstanden verschiedene dauerhafte Gerichte (quaestiones perpetuae), die für diverse Strafsachen zuständig waren und sich aus Senatoren oder Rittern zusammensetzten, besonders unter dem Diktator Sulla. Grund für ihre Entstehung war, dass sie die zahlreichen Fälle zügiger „bearbeiten“ konnten als vor allem die Komitien. Das römische Volk hatte demnach weniger Einfluss auf die Gerichtsbarkeit als im alten Griechenland.
In der Kaiserzeit gingen richterliche Kompetenzen verstärkt auf Kaiser, Senat und Präfekten über, der quaestio blieben weniger bedeutende Strafsachen. In den Provinzen entschied oftmals der Statthalter oder Legat über Streitfälle.
Der Iudex – Richter in den eigenen vier Wänden
Mit iudex war in Rom im Allgemeinen der Einzelrichter gemeint, der das von einem Magistrat (Prätor) vorgegebene Urteil in einem meist weniger bedeutenden Prozess nach der Beweisaufnahme fällte. Er musste Senator, seit spätrepublikanischer Zeit auch Ritter und seit Augustus wohlhabender Bürger sein und mindestens dreißig Jahre alt. Er wurde vom Magistrat nach Absprache mit den Prozessparteien ausgewählt. Der iudex handelte als Privatperson, also in keinem Amtsgebäude, sondern im eigenen Heim und bekleidete zeitgleich kein politisches Amt.
Da auch die römischen Richter des Öfteren keine Juristen im engeren Sinn waren, standen ihnen in diesem Fall entsprechende Fachleute zur Seite. In der Kaiserzeit wurden jedoch verstärkt „Berufsrichter“ mit Beamtenstatus eingesetzt. Legaten und Statthalter unterstanden dem imperium maius des Kaisers, der also auch in der Funktion als Richter das letzte Wort hatte, wenn das kaiserliche Gericht aus Protest gegen das Urteil eines Statthalters angeschrieben worden war.
Arbiter: ein oft mit dem iudex vermischter „Streitrichter“, der aber eher in Fällen gefragt war, die ein typisches gerichtliches Verfahren und die damit verbundene Schuldfrage umgingen und sich auf die eigentliche Problemlösung konzentrierten – ähnlich einer außergerichtlichen Einigung; wurde oft von den Parteien, also ohne Magistrat bestellt.
Centumviri: die „Hundertmänner“, ein Gericht mit Mitgliedern aus den 35 tribus, seit frührepublikanischer Zeit bis zum 2. Jahrhundert n. Chr. tätig; zuständig vor allem für Erbschafts- und Statusfälle.
Quaesitor: der für die Dauer eines Streitfalls gewählte Vorsitzende der Geschworenen, der aber keine Entscheidungsgewalt hatte, sondern stellvertretend für sein Gremium sprach.
Recuperatores: wie die centumviri ein spezielles, jedoch meist dreiköpfiges Richterkollegium, das über publikumswirksame Fälle urteilte, vor allem in sogenannten Repetundenverfahren, bei denen es um die Rückerstattung illegitim konfiszierter Ländereien und Wertsachen ging; in der späten Republik verstärkt eingerichteter Gerichtszweig, der sich durch schnelle Urteilsfindung „auszeichnete“; Auswahl aus einer Richterliste, daher keine „freie“ Wahl der Parteien und damit erschwerte Korruption.
Unmittelbarer Strafvollzug in einer römischen Schule.