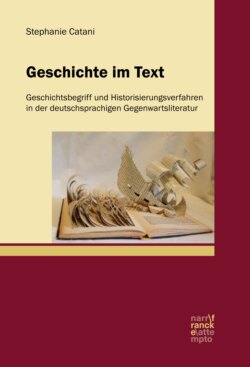Читать книгу Geschichte im Text - Stephanie Catani - Страница 14
3 Geschichte als Text: Linguistic turn und die Folgen
ОглавлениеNoch immer versteht sich der linguistic turn als der ›Mega‹-Turn der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts – häufig auch als Paradigmenwechsel aufgefasst, dem sämtliche sich anschließende und vorrangig kulturwissenschaftliche turns verpflichtet bleiben.1 Die dieser sprachlichen Wende zugrunde liegende zentrale Erkenntnis fasst Richard Rorty, dessen Herausgeberband The linguistic turn 1967 für die Namensgebung verantwortlich zeichnet, in seiner Einleitung pointiert zusammen:
Since traditional philosophy has been (so the argument goes) largely an attempt to burrow beneath language to that which language expresses, the adoption of the linguistic turn presupposes the substantive thesis that there is nothing to be found by such burrowing.2
Wenn aber mit Rorty jenseits der Sprache keine Realität zu finden ist und man sich der Wirklichkeit ausschließlich über die Einsicht in ihre sprachliche Verfasstheit zu nähern vermag, hat das unmittelbare Konsequenzen für gerade jene Wissenschaft, die sich der (Re-)Konstruktion einer vergangenen Wirklichkeit verschreibt – die Geschichtswissenschaft eben. Das viel zitierte positivistische Bemühen Rankes zu »zeigen, wie es eigentlich gewesen,« führt spätestens jetzt nicht mehr zu den Fakten der Vergangenheit, den res gestae, sondern ausschließlich zu ihrer sprachlichen Vermittlung (historia rerum gestarum) zurück, welche die Fakten erst konstituieren. Mit dem linguistic turn gerät die Geschichtswissenschaft in eine Legitimations- und Existenzkrise: Nicht zufällig werden der linguistic turn und die Frage nach dem »Ende der Geschichte als Wissenschaft« häufig in einem Atemzug genannt.3 Von einer zeitnahen Reaktion der (zumindest deutschsprachigen) Geschichtswissenschaft auf den vermeintlichen Paradigmenwechsel kann dabei schwerlich die Rede sein, vielmehr werden Einsichten des linguistic turn erst verspätet rezipiert und reflektiert.4
Der Begriff selbst, darauf wurde in jüngster Zeit hingewiesen, ist durchaus missverständlich, insbesondere wenn er vorschnell zu einer Übersetzung mit »die linguistische Wende« führt.5 Um eine solche handelt es sich bei dem Paradigmenwechsel innerhalb der Geschichtswissenschaft im Eigentlichen nicht – vielmehr bietet sich hier der Ausdruck narrative, zumindest aber sprachliche Wende an.6 Denn hinter den geschichtswissenschaftlichen bzw. -theoretischen Überlegungen im Anschluss an den linguistic turn verbergen sich in der Regel keine die Linguistik als Struktur- oder Systemwissenschaft reflektierenden oder rein semiotische Fragestellungen, sondern erzähltheoretische, hermeneutische und textanalytische Ansätze. Dementsprechend ist die Referenzgröße in den seltensten Fällen Ferdinand de Saussure, mitunter Roland Barthes, vor allem aber Hayden White. Gerade letzterer fällt hingegen, wie noch zu zeigen sein wird, in seinen frühen, zugleich aber am stärksten rezipierten Schriften, hinter die Radikalität textsemiotischer Analysen, wie sie etwa Barthes vollführt, zurück.
Die sprachliche Wende der Geschichtswissenschaft ist in ihrer ambivalenten Auswirkung zu begreifen, die auf die grundsätzlich Polyvalenz des Geschichtsbegriffes zurückzuführen ist: Zunächst leitet die Fokussierung auf die ›Sprache der Geschichte‹ zur Geschichtsschreibung als dem Diskurs über, der die historischen Fakten im Medium der Erzählung, der historia rerum gestarum, erst verfügbar macht. Die Einsicht in die rhetorische Verfasstheit der Geschichte und die Gleichsetzung des Historikers weniger mit dem ›Entdecker‹ als vielmehr dem Interpreten der Geschichte sind im Ganzen dabei nicht neu. Sie finden sich, wie bereits dargelegt wurde, im auslaufenden 18. Jahrhundert, allen voran bei Schiller, und später im Kontext der Diskussion um einen weiter gefassten Historismusbegriff und die Positivismus-Kritik Nietzsches. In der Tat erfolgt das eben dargestellte, neu entdeckte Interesse der Geschichtswissenschaft an der Aufklärungshistorie nicht zufällig zu einer Zeit, in der Geschichte als Text und damit mit seiner narrativen Qualität diskutiert wird. Diese Diskussion steht dem Selbstverständnis der Geschichtsschreiber um 1800 deutlich näher als den positivistischen Zugriffen auf die historischen Fakten, wie sie im Verlauf des 19. Jahrhunderts von den Vertretern eines positivistischen Historismus verteidigt wurden. Neben dieser Problematisierung der Geschichtsschreibung im Besonderen, der sprachlichen Verfasstheit der Geschichte, zielt der linguistic turn – gerade in seiner Fortführung durch poststrukturalistische Ansätze – auf eine weitere, ungleich brisantere Diskussion, in der nun die historischen Fakten selbst, die res gestae, verhandelt werden: Wenn eine der Sprache vorgängige Wirklichkeit in Frage gestellt wird, wenn das Signifikat, mit Derrida, »seit je als ein Signifikant« fungiert,7 dann wird die bis dato vollzogene scharfe Trennung zwischen den res gestae und der historia rerum gestarum hinfällig. Da auch das historische Faktum als erst ›gemacht‹ und nicht etwa immer schon vorhanden gedacht werden muss, geraten sowohl die Konstitutions- wie Konstruktionsbedingungen der Geschichtserzählung wie auch das von ihnen Bezeichnete unter den Verdacht der Unzuverlässigkeit.
Erst in dieser zweifachen Rückführung zur ›Sprache der Geschichte‹ und der damit verbundenen gleichzeitigen Problematisierung von res gestae und historia rerum gestarum versteht sich das Ausmaß der Erschütterung, die das Fach in der Folge prägt.