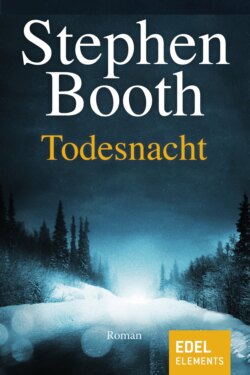Читать книгу Todesnacht - Stephen Booth - Страница 14
Оглавление9
Bei den meisten Feldern der Bridge-End-Farm unterhalb des Hügels handelte es sich noch immer um gutes Weideland. Doch das nutzte heutzutage niemandem mehr viel.
Matt behauptete, er werde bald kein Farmer mehr sein, sondern ein besserer Parkaufseher. Zunächst einmal könne er ohne finanzielle Förderung unmöglich Schafe züchten. In Zukunft werde es kein britisches Lammfleisch mehr geben, und alles, was die Verbraucher kauften, würde aus Neuseeland eingeflogen werden. Es werde genau dasselbe sein wie mit brasilianischem Rindfleisch und dänischem Schweinefleisch, sagte er. Umweltschutz war schön und gut. Die Landschaft erhalten und die Artenvielfalt schützen? Na schön. Aber Matt war es ein Rätsel, weshalb das Land keinen Nutzen darin sah, in der Lage zu sein, sich selbst zu ernähren.
Ben fuhr mit seinem Wagen auf den Hof vor das Farmhaus und versuchte, sich die Farm leer, verlassen und ohne Tiere vorzustellen. Nicht nur im Frühling ruhig, sondern ganzjährig.
Bridge End war eine der traditionellen Mischfarmen gewesen, die einst typisch für die britische Landwirtschaft waren. Die Tiere wurden mit Produkten gefüttert, die auf der Farm angebaut wurden, und im Gegenzug lieferten sie den Dünger für die Felder für die nächste Ernte. Für Ben und Matt, die auf der Farm aufgewachsen waren, war dies ein so logischer und natürlicher Kreislauf gewesen, dass sie angenommen hatten, es werde immer so weitergehen. Doch bereits in den 1990er-Jahren waren Mischfarmen zu einer altmodischen Exzentrizität geworden.
Vielleicht hätte sich ihr Vater nicht allzu sehr daran gestört. Joe Cooper hatte niemals wirklich großes Interesse an der Farm gehabt. Selbstverständlich hatte er trotzdem gelegentlich die Ärmel hochgekrempelt, um mit anzupacken. Die obersten Hemdknöpfe geöffnet, hatte er ein Stück verletzliche weiße Haut zur Schau gestellt, während er mit einem stolzen Lächeln an der Seite seiner beiden Söhne arbeitete. Das war eines jener unvergänglichen Bilder, die Ben noch immer mit sich herumtrug – wenngleich ihm sein Vater damals nicht im Entferntesten verletzlich vorgekommen war. Er hatte den Eindruck gehabt, als würde Sergeant Joe Cooper genauso wie die Farm ewig überdauern.
Ben hatte versucht, sich anzugewöhnen, sich an diese glücklicheren Bilder zu erinnern, anstatt an jenes, das ihn seit Jahren quälte: die blutüberströmte Leiche auf den Pflastersteinen, die er selbst niemals gesehen hatte. Ein paar von den Jugendlichen, die für Joe Coopers Tod verantwortlich waren, hatten ihre Haftstrafe bereits verbüßt und waren wieder auf freiem Fuß. Zwei Jahre für Totschlag, das war alles gewesen. Ersttäter, natürlich. Ben wusste, dass ihm sicher bald einer von ihnen über den Weg laufen würde. Vermutlich war es sinnlos, zu hoffen, dass er ihn nicht erkennen würde.
»Schlimme Sache, das mit dieser Familie in Edendale«, sagte Matt, nachdem er seinen Bruder vor dem Haus begrüßt hatte. »Das Feuer, meine ich.«
»Ja, wirklich schlimm.«
»Arbeitest du an der Sache?«
»Wir wissen noch nicht, ob es böswillige Absicht war oder nicht.«
»Es ist nicht gut, wenn Kinder betroffen sind, was auch immer es war.«
Matt zog im Windfang seine Stiefel aus und streifte seinen Overall ab. Sofort sprang eine getigerte Katze auf und inspizierte den Overall, um zu prüfen, ob er ein brauchbares Bett abgeben würde.
»Ich war vorher unten in Foxlow«, erzählte Ben. »Dort wurde jemand erschossen.«
»Ja, das habe ich gehört«, sagte Matt.
»Tatsächlich?«
»Neville Cross hat die Leiche gefunden, nicht wahr?«
»Na ja, nicht ganz. Aber er hat die Polizei verständigt.«
»Neville ist der Vertreter der National Farmers’ Union, weißt du.«
»Dann hat die Gerüchteküche der Farmer also gebrodelt, oder?«
»Könnte man so sagen.«
Matt streichelte geistesabwesend die Katze. Ihr Kopf verschwand fast vollständig unter seiner riesigen Hand. Nur ihre Ohren schauten hervor, die von den Vibrationen ihres tiefen Schnurrens zitterten.
»Komm mal mit ins Büro, Ben. Ich möchte dir was zeigen.«
»Haben da drin überhaupt zwei Leute Platz?«
»Wenn es dir nichts ausmacht, dir deine Atemluft mit einem stinkenden alten Hund zu teilen.«
Das Farmbüro war eng und unordentlich. Büroarbeit war der Aspekt des Farmerdaseins, dem Matt am allerwenigsten Aufmerksamkeit widmete, da sie mit einem Aufenthalt im Haus verbunden war. Gelegentlich kam Kate herein, um bei den Schreibarbeiten zu helfen und für eine gewisse Ordnung im Chaos zu sorgen. So schlugen sich die beiden Jahr für Jahr durch und brachten ihren Steuerberater auf die Palme. »Ich bin Landwirt und kein Buchhalter«, sagte Matt immer. Doch tief in seinem Inneren wusste er vermutlich, dass diese Schwäche der Grund dafür war, dass er letztendlich zum Scheitern verurteilt war. Heutzutage mussten Farmer vor allem Manager und Unternehmer sein, wenn sie überleben wollten.
Matt ließ sich auf dem Bürostuhl vor dem Computer nieder. Da er mit zunehmendem Alter immer fülliger wurde, wirkte er zu wuchtig für den Schreibtisch, als säße ein Erwachsener in einem Klassenzimmer für Grundschüler.
»Ich habe im Internet nachgesehen«, sagte er.
»Verflucht, wir müssen auf dich aufpassen. Wenn du so weitermachst, wirst du noch im einundzwanzigsten Jahrhundert ankommen.«
Matt machte ein finsteres Gesicht. »Das meiste im Internet ist ein Haufen Mist.«
»Ja, da hast du vermutlich recht.«
»Genau genommen habe ich noch nie so viel Mist gesehen.«
»Man muss lernen, den Müll rauszufiltern, um die nützlichen Dinge zu finden.«
»Ich bin Viehfarmer, also weiß ich, was Mist ist.«
»Ja, Matt.«
Ben hockte sich auf die Armlehne eines tiefen Sessels. Die Sitzfläche hatte bereits eine alte Border-Collie-Hündin namens Meg in Beschlag genommen, die sich nicht einmal die Mühe machte, die Augen zu öffnen. Sie hatte ein Recht auf diesen Platz und war nicht gewillt, ihn für irgendjemanden zu räumen. Ben hätte nicht im Traum daran gedacht, sie zu verscheuchen.
Matt fuhr seinen Computer hoch und starrte den Bildschirm finster an, während er wartete, bis er sein Passwort eingeben konnte. »Ich möchte dir was zeigen.«
»Sag bloß, du hast dir schon wieder Vorschläge für Diversifikation angesehen. Was ist es diesmal – Rock Festivals? Die Felder dafür hättest du ja und den Schlamm auch.«
»So weit kommt’s noch, dass ich Tausende von Hippies auf meinem Land campieren lasse.«
»Bei Lord Montagu of Beaulieu hat es funktioniert.«
»Nein, hat es nicht. Bei ihm gab es Krawalle zwischen rivalisierenden Jazz-Fans.«
Ben lachte. »Worum geht’s dann?«
»Es geht gar nicht um die Farm«, sagte Matt in düsterem Tonfall, ohne den Blick vom Bildschirm abzuwenden.
Als Ben bewusst wurde, dass er nicht das Geringste gegen die mürrische Laune seines Bruders unternehmen konnte, beugte er sich vor, um zu sehen, was dieser betrachtete. Er hatte eine Website geöffnet, die er unter seinen Favoriten abgespeichert haben musste, da er nicht die Tastatur benutzt hatte, um eine Adresse einzugeben. Ben war überrascht, dass Matt überhaupt wusste, wie das funktionierte.
»Ich habe diesen Artikel hier über Schizophrenie gefunden«, sagte Matt. »Tja, genauer gesagt, über ihre Vererbbarkeit.«
Einen Augenblick lang brachte Ben das Wort »Vererbbarkeit« aus dem Konzept. Er war daran gewöhnt, diesen Begriff von Matt zu hören, aber immer im Zusammenhang mit Viehzucht. Wie hoch war die Wahrscheinlichkeit, dass eine gute Milchkuh Nachwuchs produzierte, der ebenfalls viel Milch gab? Wie viel Prozent der Lämmer, die ein Texel-Schafbock gezeugt hatte, besaßen dasselbe Muskelverhältnis? Das war Vererbbarkeit. Genetik spielte eine große Rolle, wenn man Tiere mit erwünschten Charakteristika züchtete. Aber Schizophrenie? Das ergab keinen Sinn.
»Was, in aller Welt, willst du mir damit sagen, Matt?«
»Ich habe gehört, wie es jemand vom Personal im Pflegeheim erwähnt hat, bevor Mum starb. Mir war es bis dahin gar nicht bewusst gewesen, und niemand hat jemals die Möglichkeit erwähnt. Zumindest nicht mir gegenüber. Ich weiß nicht, ob sie es dir gegenüber erwähnt haben, aber du hast nie etwas gesagt.«
»Matt, ich weiß wirklich nicht, wovon du sprichst.«
»Ich bin auf die Idee gekommen, dass es wie bei anderen Krankheiten sein könnte. Erinnerst du dich noch an die Jersey-Kühe, die zu Hufrehe neigten? Das wurde von Generation zu Generation weitergegeben, und wir haben es nie geschafft, das beim Züchten wegzubekommen. Am Schluss mussten wir sie alle töten.«
»Ja, ich erinnere mich.«
»Tja, dieser Website zufolge ist Schizophrenie auch vererbbar.«
»Was?«
»Ben, es geht mir vor allem um die Mädchen. Ich muss wissen, wie die Chancen stehen – wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Schizophrenie vererbt wird. Würdest du das bitte mal lesen?«
Widerwillig ließ Ben den Blick über den Text auf dem Bildschirm wandern. Schizophrenie liegt nachweislich in der Familie. Bei Menschen, die einen engen Verwandten haben, der unter Schizophrenie leidet, ist das Risiko höher, dass sie die Krankheit ebenfalls bekommen. Schizophreniekranke Eltern laufen Gefahr, die Krankheit an ihre Kinder zu vererben.
Er richtete sich wieder auf. »Ich will das gar nicht wissen, Matt.«
»Es geht noch weiter. Lies den Rest.«
»Nein. Das ist doch lächerlich.«
»Ich drucke es dir aus, dann kannst du es später lesen.«
»Ich will es aber nicht später lesen, danke. Ich verstehe nicht, warum du das tust, Matt. Was soll das?«
»Was das soll? Hier steht, dass Menschen aus Familien, die anfällig für Schizophrenie sind, unter Umständen die Gene in sich tragen, obwohl sie selbst nicht schizophren sind. Man nennt so jemanden einen ›mutmaßlichen obligaten Träger‹.«
»Matt, du verstehst davon doch gar nichts.«
»Aber ich versuche, mich zu informieren. Sieh mal, in diesem Absatz steht was über Vorausberechnung.«
»Was?«
»Die Entwicklung einer Krankheit über mehrere Generationen. Man hat von Schizophrenie betroffene Familien untersucht und herausgefunden, dass Mitglieder dieser Familien mit jeder Generation früher und schwerer von der Krankheit betroffen waren.«
»Und deine Schlussfolgerung, Doktor …?«
Matt drückte ein paar Tasten, und der Laserdrucker erwachte mit einem Surren zum Leben. Er drehte sich um und sah seinen Bruder an.
»Meine Schlussfolgerung ist, dass meine Kinder ein achtmal höheres Risiko haben, Schizophrenie zu bekommen, als andere Menschen.«
Ben schüttelte den Kopf. »Das ist trotzdem noch ein geringes Risiko, Matt. Man hat uns gesagt, dass einer von hundert Menschen unter Schizophrenie leidet. Selbst wenn du die Vererbbarkeit einrechnest, beträgt die Wahrscheinlichkeit höchstens, wie viel … acht Prozent?«
»Das ist zugegebenermaßen etwas geringer als unser Risiko.«
»Unseres?«
»Deines und meines, kleiner Bruder. Bei den Kindern und Geschwistern von Schizophreniekranken beträgt die Wahrscheinlichkeit bis zu dreizehn Prozent, dass sie die Krankheit bekommen.«
Matt nahm einige Seiten aus dem Drucker, stapelte sie aufeinander und hielt sie seinem Bruder hin. Ben nahm sie nicht.
»Glaubst du dieses ganze Zeug tatsächlich?«
»Schau es dir bitte an, ja?«
Doch Ben schüttelte den Kopf und setzte sich wieder auf die Sessellehne. Meg stöhnte und sah ihn mit einem Auge müde und vorwurfsvoll an. Sie war ein Hund, der Frieden mochte. In ihrem Schlafbereich die Stimme zu heben gehörte sich einfach nicht.
Matt hielt ihm die Seiten abermals hin. »Man vermutet, dass einigen Familien möglicherweise der genetische Code fehlt, der die Krankheit bekämpft. Weißt du, ich frage mich, ob Grandma vielleicht schizophrene Neigungen hatte. Sie hatte ein paar seltsame Angewohnheiten – erinnerst du dich? Aber alle in der Familie haben so getan, als wäre sie nur ein bisschen exzentrisch gewesen.«
»Ich erinnere mich, dass sie etwas merkwürdig war, aber das hat gar nichts zu bedeuten. Es bedeutet ganz bestimmt nicht, dass du den Mädchen irgendwas vererbt hast.«
»Weiß du, ich versuche, es mir auszumalen«, sagte Matt. »Ich sehe mich selbst, wie ich bei Amy und Josie immer nach irgendwelchen frühen Warnzeichen Ausschau halte. In gewisser Weise wäre das auch vernünftig – bei frühem Eingreifen und Behandeln ist die Prognose am besten. Aber welche Auswirkungen hätte es für die Mädchen, wenn wir die ganze Zeit nach verräterischen Anzeichen suchen würden?«
Ben war sich nicht sicher, mit wem sein Bruder gerade sprach. Er hätte ebenso gut allein mit seinem Hund im Büro sein können.
»Manchmal bin ich wie gelähmt bei dem Gedanken, dass einem der Mädchen einmal dasselbe Schicksal wie Mum drohen könnte. Vielleicht muss ich irgendwann mal Angst vor meiner eigenen Tochter haben. Dann wieder stelle ich mir vor, welche Erleichterung es wäre, wenn sich herausstellen sollte, dass meine Kinder irgendein anderes Problem als Schizophrenie haben. Ich habe das Gefühl, ich wäre vielleicht sogar in der Lage, eine Art Abmachung mit Gott zu treffen.«
»Du glaubst nicht an Gott, Matt«, sagte Ben.
»Nein, das tue ich nicht. Aber das hält mich nicht davon ab. Es ist die Vorstellung, mich auf einen Handel einzulassen, das Spiel mit Prozentsätzen. Ich gehe die Zahlen in Gedanken immer und immer wieder durch. Aller Wahrscheinlichkeit nach, sage ich mir, werden beide Mädchen gesund bleiben. Und Gene sind nicht der einzige Faktor. Schizophrenie ist nur zu etwa siebzig Prozent ererbt – was bedeutet, dass Umweltfaktoren dreißig Prozent ausmachen, richtig?«
»Ja.«
»Wenn wir also wüssten, welche anderen Faktoren einen Einfluss haben … Wenn wir das wüssten, könnten wir vielleicht eine andere Umwelt erschaffen, damit der genetische Schalter nicht umgelegt wird.«
»Matt, du machst dir viel zu viele Gedanken wegen dieser Sache. Du hast doch selbst gesagt, dass das meiste im Internet Müll ist.«
»›Mist‹, habe ich gesagt. Ein dampfender Haufen Kuhmist, wenn du möchtest. Aber das hier nicht. Du weißt, dass das kein Müll ist, Ben.«
»Du machst dir umsonst Sorgen. Mit deinen Kindern ist alles in Ordnung.«
Eine Bewegung im Freien erregte Bens Aufmerksamkeit. Das Fenster ging zum schmalen Garten und dem dahinter liegenden Farmhof hinaus. Auf der Trennmauer saß seine jüngste Nichte Josie.
»Das ist der Grund, warum ich mir Sorgen mache«, sagte Matt.
Ben klopfte an die Fensterscheibe, und als Josie aufsah, winkte er.
Sie kicherte, winkte zurück und warf ihm eine Kusshand zu.
»Josie ist völlig normal«, sagte er. »Und Amy ebenso.«
»Erinnerst du dich noch, dass Josie eine imaginäre Freundin hatte, bevor sie in die Schule kam? Sie hat immer behauptet, ihre Freundin wäre bei ihr, und sie hat sich die ganze Zeit mit ihr unterhalten.«
»In Gottes Namen, Matt, jedes Kind hat in diesem Alter einen imaginären Freund.«
»Ich hatte keinen.«
»Das liegt daran, dass du keine Phantasie hattest.«
»Danke.«
Als Ben sich wieder zum Fenster umdrehte, sah er, wie Josie ihm die Zunge herausstreckte. Vielleicht lag es daran, dass er ihr einen Augenblick lang nicht seine Aufmerksamkeit gewidmet hatte.
»Hat sie noch immer eine imaginäre Freundin?«, fragte er.
»Das weiß ich nicht«, entgegnete Matt. »Josie spricht nicht mehr von ihr, seit sie zur Schule geht. Aber vielleicht hat sie gemerkt, dass andere Leute das merkwürdig fanden, und erwähnt sie deshalb nicht mehr.«
»Oder es liegt daran, dass sie jetzt echte Freundinnen hat und die imaginäre Freundin nicht mehr braucht.«
»Meinst du wirklich, Ben?«
»Beim besten Willen, aber es war wirklich ganz schön einsam hier für Josie, als Amy bereits in der Schule war und sie noch nicht.«
»Die Zeit wird es zeigen, nehme ich an«, sagte Matt. »Aber ich muss die Fakten kennen. Schließlich habe ich die Entscheidung getroffen, Kinder zu bekommen. Na ja, ich und Kate.«
»Hast du schon mit Kate darüber gesprochen?«
Matt wischte sich mit der Hand übers Gesicht. »Ich muss erst wissen, was ich ihr sagen soll.«
»Als du im Internet nach all diesen Informationen gesucht hast, bist du da irgendwo auf Tipps gestoßen? Was wird einem denn geraten, das man tun soll?«
»Mit einem Psychiater sprechen.«
»Und das wirst du auch tun, oder?«
Matt seufzte. »Einigen dieser Websites zufolge wird man die Genetik von Geisteskrankheiten in zwanzig Jahren viel besser verstehen. Aber die Chancen stehen schlecht, dass die Forschung in den nächsten fünf Jahren in der Praxis Anwendung finden wird – wenn es mir was nützen würde. Oder dir, Ben.«
»Ich habe nicht vor, in nächster Zeit Kinder in die Welt zu setzen.«
»Du bist über dreißig. Allzu lange solltest du nicht mehr warten. Auch Männer haben eine biologische Uhr.«
»Wenn du das sagst.«
»Was ist denn mit deiner Freundin?«
»Liz? Wir sind nur … Na ja, wir sind nur zusammen, das ist alles.«
Matt zog die Augenbrauen hoch und warf ihm einen skeptischen Blick zu.
»Was ist?«, fragte Ben.
»Nichts. Ich finde nur, dass du dich verändert hast, seit du mit ihr zusammen bist.«
»Nein, das habe ich nicht.«
Sein Bruder schnaubte verächtlich. »Wie dem auch sei. Letzten Endes, Ben, musst du der Tatsache ins Auge sehen, dass dir niemand sagen kann, ob ein Kind von dir gesund oder anfällig für Schizophrenie sein wird.«
»Deswegen werde ich mir keine Sorgen machen«, sagte Ben bestimmt.
Ein paar Minuten später ließ er seinen Bruder im Büro zurück und ging hinaus in den Flur, der mitten durchs Haus verlief. Als Kind hatte er diesen Flur und die Treppe als düsteren Ort empfunden. Er erinnerte sich an dunkelbraunen Lack, schwarz gestrichene Dielen und schmale Läufer, die unter Schmutzschichten ihre Farbe verloren hatten.
Jetzt sah alles anders aus. Auf dem Boden lag ein hochfloriger Teppich, und die Wände waren weiß gestrichen. Vielleicht war es aber auch ein gebrochenes Weiß. Kate kannte sicher die genaue Farbbezeichnung aus dem Katalog. Das Holz war bis auf seinen natürlichen Kieferfarbton abgebeizt worden, und in Spiegeln und Bildern fing sich das Licht.
Ben drehte sich widerwillig um und blickte die Treppe hinauf. Oben sah er die erste Tür auf dem Korridor, die ins ehemalige Zimmer seiner Mutter führte. Nach dem Tod seines Vaters hatte sich ihr Zustand zunehmend verschlechtert, bis ihre Angehörigen nicht mehr verleugnen konnten, dass sie psychisch krank war.
Bei Isabel Cooper war chronische Schizophrenie diagnostiziert worden, und schließlich waren die Besorgnis erregenden Zwischenfälle untragbar geworden, vor allem mit Kindern im Haus. Ben schauderte bei dem Gedanken daran. Er wollte so etwas nie wieder mit ansehen müssen.
An einem Montagabend im Oktober waren die Derwent Gardens in Matlock Bath menschenleer. Niemand war auf den Wegen zwischen den Blumenbeeten und dem Brunnen zu sehen, und niemand in der Nähe des Musikpodiums oder der Kalktuffhöhle. Die Bergahornbäume entlang dem Flussufer verfärbten sich bereits goldgelb. Ihre Blätter wehten über die Wege, unberührt von vorübergehenden Füßen.
Am hintersten Ende der Parkanlage, hinter einer Reihe von Ständen mit gestreiften Markisen, befand sich derzeit ein Festplatz. Eine altmodische Krake und ein Riesenrad, ein Miniaturzug, ein Autoskooter – alle still und regungslos.
Vom Pavillon näherte sich eine Gestalt, ein Mann im Mantel, der am Flussufer entlangging, vorbei am Landesteg, an dem die Boote für die Parade am Samstag festgemacht waren. Er wanderte scheinbar ziellos dahin und trat gegen Baumwurzeln. Unter seinen Füßen raschelte das frische, trockene Laub.
Er ging an der Krake und dem Riesenrad vorbei und kam zu einer kleinen Hütte, die als Kartenverkaufsstand für die Fahrgeschäfte diente.
Vor der Tür der Hütte blieb er stehen. In der Finsternis im Inneren war niemand zu sehen. Trotzdem hielt er den Blick abgewendet und sah hinauf zu dem Turm auf den Heights of Abraham, hoch oben über der Ortschaft. Das war der Ort, an dem er lieber gewesen wäre, umgeben von brausender Luft, den heulenden Wind in den Ohren. Doch der Vergnügungspark auf dem Hügel hatte seine Pforten für heute geschlossen.
»Und, ist es erledigt? Alles vorbei?«
Er erstarrte. Das Flüstern mochte aus der Hütte gekommen sein oder vom Flussufer hinter ihm. Oder es mochte aus seinem Kopf gekommen sein.
»Ja, alles vorbei«, sagte er.
Hinter der Hütte sah er die Wagen des Autoskooters, die in der Dunkelheit des hölzernen Parcours aussahen wie eine Gruppe farbiger Käfer. Auf der Windschutzscheibe eines Leyland-Lastwagens, der hinter dem Autoskooter geparkt war, klebte ein Rams-Aufkleber. Einer der Schausteller musste ein Fan des Derby County Football Clubs sein. Er fragte sich, ob sich in dem Lastwagen der Generator befand, der die Skooter antrieb, der Leben in die Käfer brachte und sie knattern und Funken sprühen ließ.
»Du bist böse, nicht wahr?«
»Bin ich das?«, fragte er.
»Richtig böse.«
Das Geräusch des plätschernden Brunnens lenkte ihn ab. Einige Wassertropfen, die von der Brise erfasst wurden, prasselten auf die Rosensträucher. Tip-tap, wie winzige Schritte.
»Ich höre nicht mehr zu.«
In seinem Kopf ertönte Gelächter und ließ ihn erzittern. »Zu spät.«
John Lowther zog sich seinen Mantel enger um die Schultern, als er durch das Laub davonstapfte. Er wusste nicht, was er als Nächstes tun sollte. Und er wusste nicht, was er von der Stimme halten sollte, von diesem schrecklichen geisterhaften Flüstern. Sie hatte geklungen wie die Stimme eines Kindes.