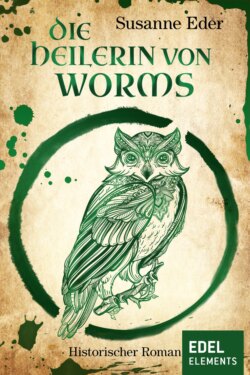Читать книгу Die Heilerin von Worms - Susanne Eder - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 4
ОглавлениеDer Burggraf verließ die Schänke am Markt mit vollem Magen und einem grimmigen Ausdruck im Gesicht.
Für zwei Schalen Eintopf, eine großzügig bemessene Scheibe Speck, einen halben Laib Brot und zwei Krüge Bier hatte sich Fortunatus nicht lumpen lassen. Aber das Ergebnis war nicht ermutigend, und der Burggraf hatte in den Auskünften des Bettlers nicht das gefunden, was er sich erhofft hatte: einen Anhaltspunkt, wer Ebertine von Hollerborn nach dem Leben getrachtet haben könnte.
Wie Bandolf den oft blumigen Schilderungen des Bettlers entnehmen konnte, unterschied sich Guntram von Hollerborns Leben kaum von dem anderer Männer von Stand. Der Stammsitz der Familie, dessen Oberhaupt Guntram war, sowie der Löwenanteil seiner Güter befanden sich offenbar im Lahngau. Zu Zeiten Kaiser Heinrichs III., des Vaters des jetzigen Königs, schien die Sippschaft über beträchtlichen Einfluss bei Hof verfügt zu haben. Nach dem Tod des Kaisers hatte Guntram sich dann offenbar Erzbischof Adalbert von Bremen und Hamburg angeschlossen, der bis vor kurzem noch Vormund und enger Vertrauter des jungen Königs Heinrich gewesen war. Mit der Entmachtung des Erzbischofs von Bremen durch die Fürsten im vergangenen Jahr schien auch Guntram von Hollerborn an Einfluss bei Hof eingebüßt zu haben.
Das mochte vielleicht der Grund sein, warum er nach dem Tod seiner vormaligen Gattin die junge Ansild von Dernau zum Weib genommen hatte. Wie Fortunatus behauptete, schien Ansild eine Tochter des Grafen Sikko von Dernau zu sein, der zu jenen Männern gehörte, denen der junge König Heinrich nun sein Ohr lieh. Mit dieser Heirat mochte sich Guntram vielleicht die Rückgewinnung seiner einstigen Macht erhofft haben.
Kurz nach der Vermählung mit Ansild von Dernau im Herbst letzten Jahres hatte Guntram das Anwesen in der Salzgasse erworben, augenscheinlich mit der Absicht, sich auf Dauer in Worms niederzulassen.
Worms war eine Stadt, die dem König nahestand und in der Fürsten und hoher Klerus kein seltener Anblick waren. Hier, am Schauplatz bedeutender Hoftage, wurden Entscheidungen getroffen und Beschlüsse gefasst, die Auswirkungen weit über die Grenzen des Reichs hinaus hatten. Das mochte ein weiterer Grund für Guntrams Entschluss gewesen sein, sich hier anzusiedeln. Zumal er wohl auch noch die eine oder andere Hufe im weiteren Umkreis der Stadt sein Eigen nannte.
Wie Fortunatus bestätigte – und was ihm schon die Heilerin gesagt hatte -, führte offenbar Reimut, Guntrams älteste Tochter, den Haushalt ihres Vaters; und es schien so, als wünsche sie nicht, dass sich daran auf absehbare Zeit etwas änderte. Die Hoffnung auf eine Verbindung mit einer einflussreichen Familie hatte Guntram offenbar auf seine jüngere Tochter Ebertine gesetzt.
Was kein Wunder sei – so meinte Fortunatus -, galt die Ältere, Reimut, doch als eine, »mit der nicht gut Kirschen essen ist« und »die wie eine Glucke auf dem Münzbeutel zu hocken pflegt, wenn’s gilt, Almosen zu verteilen«, während die Jüngere, Ebertine, zum »wahren Augenschmaus« herangewachsen war. Sie sei wohl ein wenig herrisch gewesen, gab Fortunatus zu, aber liebreizend anzuschauen und vor allem auch nicht gar so knausrig wie ihre Schwester.
Man erzähle sich, der plötzliche Tod seiner geliebten Tochter habe den Vater schwer getroffen, berichtete Fortunatus weiter. Guntram sei außer sich vor Trauer, hieß es, und habe gar die Anhänger seiner Sippschaft aus der Umgebung zur Bestattung seiner Tochter nach Worms gerufen.
Auf Bandolfs Frage, ob Ebertine schon versprochen gewesen wäre, hatte Fortunatus den Kopf geschüttelt. Ihr Vater hatte sich offenbar noch für keinen der Anwärter auf Ebertines Hand entschieden.
»Jedermann hat doch gewusst, dass der Vater sich bei seinem Sonnenschein mit der Mitgift nicht hätt’ lumpen lassen. Na, und ansehnlich war das junge Ding ja noch dazu«, hatte Fortunatus ihm zugeraunt. »Da hat’s denn auch an Anwärtern nicht gemangelt.«
Auch ihr Vetter Folcmar schien um die Gunst seiner Base bemüht gewesen zu sein. Doch angesichts der Tatsache, dass sein älterer Bruder Gernot einem Gewerbe nachging, das unter seinem Stand war, war Folcmar als Gatte für die schöne Ebertine offenbar nicht in Frage gekommen.
Fortunatus hatte gehört, dass die Geschwister von Medenheim einem verarmten Zweig der Sippschaft entstammten. Ein Missstand, den der Älteste, Gernot, offenbar zu beheben trachtete, indem er sich als Kaufmann versuchte. Obwohl er damit sogar recht erfolgreich zu sein schien, hieß Guntram naturgemäß die Beschäftigung seines Neffen alles andere als gut. Dass ein Mitglied seiner Familie sich zu schnödem »Ums-Geld-Schachern« herabließ, schien auch zu regelmäßigen Auseinandersetzungen zwischen Guntram und seinem Neffen zu führen.
Offenkundig hielt Folcmar sich von den Geschäften seines Bruders fern und vertrieb sich die Zeit lieber mit seinen Kumpanen, mit Zechereien und Würfelspiel beim Fischerwirt und mit dummen Streichen. Fortunatus vermutete, dass dies der Grund dafür sei, weshalb man Guntram auf den Gassen weit häufiger in Folcmars Gesellschaft sah als in der seines Bruders.
Was ihre Schwester Kunigunde anbelangte, hielt Fortunatus sie für ein junges Ding, »durchaus passabel anzuschauen«, dennoch unversprochen, und wie es nun mal sei, würde es gewiss nicht leicht sein, einen tauglichen Gatten für sie zu finden, »alldieweil doch der Geruch der Kaufmannsbuden an ihr hängt«, solange sich ihr Bruder Gernot nicht wieder auf seinen Stand besann.
Alles in allem war Guntram von Hollerborn offenbar ein Edelmann wie viele andere auch, die in Stand und Reichtum hineingeboren worden waren, dachte der Burggraf, als er auf dem Rückweg zu seinem Haus in die Brotgasse einbog.
Von Feinden des Edelmanns wüsste er nichts, hatte der Bettler behauptet, doch bezogen sich seine Auskünfte auch nur auf die nähere Vergangenheit, die Guntram in Worms verbracht hatte.
Falls es einen dunklen Fleck auf Guntrams Wams gab, dann musste er vermutlich woanders als in Worms suchen, überlegte Bandolf.
Aber wie er es auch drehte und wendete, er konnte sich nicht vorstellen, was ein solcher Fleck mit dem Tod von Guntrams Tochter zu tun haben könnte. Wenn der Edelmann Feinde hatte, wäre er dann nicht selbst das Opfer gewesen? Allenfalls hätte man sich wohl noch an seinem Sohn gerächt, der just dem Gängelband entwachsen war.
Wahrscheinlicher war es da doch, dass er den Täter im Umfeld des Opfers finden würde, grübelte der Burggraf weiter. Vielleicht war es zu Eifersüchteleien unter Ebertines Verehrern gekommen? In dem Fall wäre das Opfer dann aber vermutlich einer jener jungen Schnösel gewesen, die dem jungen Weib und der Börse ihres Vaters zugeneigt gewesen waren.
Möglich war auch, dass Ebertine einen ihrer Verehrer abgewiesen hatte, der diese Kränkung an ihr gerächt hatte. Nur ... wie hätte es einem abgewiesenen Verehrer gelingen sollen, ihr ein Gift zu verabreichen? Wenn man sie vergiftet hatte, müsste das nicht in der Zeit geschehen sein, als sie ihr Lager gehütet hatte? Hätte man es einem abgewiesenen Verehrer denn gestattet, in Ebertines Kammer vorzudringen?
Und wie stand es mit Ebertines Anverwandten? Streitigkeiten zwischen Neffen und Onkel und Zank unter den Frauen, das gab es überall.
›Nicht zuletzt in meiner eigenen Halle‹, dachte der Burggraf und verzog das Gesicht. Dann seufzte er. Bevor er sich in fruchtlosen Spekulationen erging, wer der Täter gewesen sein könnte, wäre es gewiss hilfreich, herauszufinden, ob es überhaupt einen Täter gegeben hatte. Und wie, zum Teufel, sollte er das anstellen?
Alles in allem schien Ebertine zwar ein liebreizendes, jedoch kein liebenswertes junges Weib gewesen zu sein, und fest stand, dass jemand ihr Übles gewünscht hatte. Das bewies wohl hinreichend der Katzenschwanz. Aber hatte ihr auch jemand nach dem Leben getrachtet und dem Wunsch die Tat folgen lassen?
Mit der Zeit hatte der Burggraf gelernt, dem Urteil der Heilerin zu vertrauen, besonders da sie ein Gespür für derlei Dinge zu besitzen schien. Doch dieses Mal fürchtete er, dass sie sich geirrt hatte und nur ihr dringlicher Wunsch, es möge so sein, Vater ihres Verdachts gewesen war.
Noch entmutigender als Fortunatus’ Auskünfte über Guntram und seine Sippschaft fand der Burggraf das, was ihm der Bettler über die Heilerin ins Ohr geraunt hatte.
»Gottlose Drude« war offenkundig noch das Geringste, das man ihr in der Stadt nachsagte. Von Unzucht war die Rede und von Hurerei, von blasphemischem Lästern, von Kindsmord und Wahrsagerei. Engelmacherin nannte man sie nicht mehr nur hinter vorgehaltener Hand. Mit Gotteszeichen würde sie Schindluder treiben, hörte man munkeln, und beim Mischen der Salben und Tränke den Höllenfürsten anrufen.
Auf Bandolfs Frage, wer, zum Henker, denn einen solchen Mumpitz glaubte, hatte Fortunatus nur vielsagend die Brauen gehoben. Es wäre wohl die Tuchweberwitwe gewesen, die zuerst gegen die Heilerin gehetzt hätte. Irgendwann hätte sich das Geschwätz dann gelegt, und eine ganze Weile sei es ruhig um die Drude gewesen. Doch dann wären die Stimmen wieder lauter geworden. Und auch um einiges deutlicher.
Am Ende hatte Fortunatus seinen Bericht mit der Bemerkung gekrönt: »Irgendwas hat sie sich gewiss zuschulden kommen lassen, sonst würden die Leut’ ja nicht so reden.«
Es war kalt geworden. Die dunklen Wolken hatten die Stadt erreicht, und die Sonne war dahinter verschwunden. Als Bandolf sein Heim betrat, sah er eine große graue Katze auf der niedrigen Mauer sitzen, die den Kräutergarten seiner Gattin vom übrigen Hof abgrenzte. Die Possierlichkeit, mit der die Domkatze ihre Pfote benetzte und sich damit die Ohren rieb, entlockte Bandolf ein Lächeln.
Derzeit war Penelope kein gern gesehener Gast in seinem Haus. Zum einen behauptete Filiberta, Penelope habe sie erschreckt und trüge die Schuld an ihrem unseligen Sturz. Zum anderen hielt seine Gattin Matthäa die Anwesenheit einer Katze in der Schlafkammer für unpassend und schädlich für die kleine Lavinia. Bandolf, der beobachtet hatte, mit welcher Geschwindigkeit und Begeisterung seine Tochter auf Penelope zuzukrabbeln pflegte, sie an den Ohren zog und ihre winzigen Hände in ihrem Fell vergrub, dachte im Stillen, es sei wahrscheinlicher, dass die Anwesenheit seiner Tochter schädlich für die Katze war. Penelope pflegte sich mit angelegten Ohren aus dem Staub zu machen, wenn Lavinia am Gängelband auf dem Boden der Halle umherkrabbelte, doch hin und wieder ließ sie sich auch herbei, die groben Zärtlichkeiten der Kleinen einen Augenblick zu dulden.
Als der Burggraf sich mit einem tiefen Seufzen neben Penelope auf die Mauer sinken ließ, unterbrach sie ihre Tätigkeit und rieb schnurrend den Kopf an seinem Knie. Abwesend strich er über ihren Rücken.
»Es sieht übel aus für Garsende«, teilte er ihr mit.
Wenn nicht rasch etwas geschah, das den Leuten das Maul stopfte, würde die Heilerin nächstens vor dem Sendgericht stehen. Das war so sicher wie das Amen bei der Messe.
»Verdammnis!«, knurrte er halblaut. So viele Leumundszeugen würden sich nirgendwo auftreiben lassen, die Garsende brauchte, um bei solchen Anschuldigungen mit heiler Haut davonzukommen.
Garsende hatte sich an ihn um Hilfe gewandt, und er stand tief genug in ihrer Schuld, um sein Bestes zu geben. Doch die bittere Wahrheit war, dass er nicht die geringste Ahnung hatte, wie er ihr helfen konnte.
Fortunatus hatte Garsendes Befürchtung bestätigt. Die Neuigkeit, dass die Tochter eines Edelmanns in der Obhut der Heilerin gestorben war, hatte sich rascher in Worms verbreitet als der Wind und Öl in die Flammen gegossen.
Könnte der Burggraf jemand anderen für Ebertines Tod an den Pranger stellen, würde das die Gemüter zweifellos beruhigen. Doch da es bislang nicht einmal einen Hinweis darauf gab, dass das junge Weib keines natürlichen Todes gestorben war, war die Aussicht auf einen solchen Erfolg mehr als gering.
Der Burggraf seufzte. »Da bleibt nichts anderes übrig, als blind in diesem Trauerhaus herumzustochern und zu beten, dass sich etwas findet.« Gedankenverloren spielte er mit Penelopes Ohren, die sich hingebungsvoll an ihn schmiegte.
»Was, zum Teufel, hat das Weib nur angestellt, das die Leute derart gegen sie aufgebracht hat?«, fragte er die Katze und fügte rasch hinzu: »Nicht, dass ich auch nur ein Wort davon glauben würde.«
Aber Fortunatus hatte recht. Irgendetwas musste sie getan haben, dass sich die Gemüter so erhitzten.
Bandolf schüttelte den Kopf. Die Heilerin mochte mehr Vernunft haben als manch anderes Weib, das er kannte, doch sie besaß auch eine spitze Zunge, die hin und wieder mit ihr durchging. Und wenn sie nun ...
Ein Gedanke schoss ihm durch den Kopf. Bandolf runzelte die Stirn. Seine Hand stockte. Die Katze hob den Kopf und schien ihn mit ihren bernsteingelben Augen vorwurfsvoll anzustarren. Dann sprang sie plötzlich von der Mauer und schoss wie der Blitz davon.
Zum Henker, wieso war ihm das nicht gleich eingefallen? Womöglich konnte er doch etwas für die Heilerin tun. Und wenn er recht hatte, dann ließe sich das auch heraus ...
Ein Räuspern unterbrach seine Gedanken, und Bandolf sah unwillig auf.
Vor ihm stand sein Hausmeier Werno, mit einem langen Gesicht, das die Miene eines zutiefst gekränkten Mannes zeigte.
»’s ist wegen der Knechte Eures Gastes, Herr«, berichtete er nach einem neuerlichen Räuspern. »Die nämlich wollen das Lager nicht haben, das ich ihnen zugewiesen habe. Behaupten, sie wären Bess’res gewöhnt, als im Stall zu schlafen, alldieweil’s da wie im Schweinekoben stinken würd’. Und ihrem edlen Herrn wär’s auch ganz gewiss nicht lieb, dass man seine Knechte so herabwürdigt. Die Unsrigen wiederum wollen ihre Lager in der Scheune nicht räumen. Und darum wollt’ ich fragen, Herr, was ich jetzt ...«
Die finster zusammengezogenen Brauen des Burggrafen mochten ihm nicht recht geheuer sein. Er räusperte sich ein drittes Mal. »’s ist nämlich so, Herr, dass Herwald just dazwischen musste, weil einer der fremden Knechte uns’rem Jacob an die Gurgel ging, nur weil er gesagt hat, die Onsheimer Knechte könnten doch froh sein, dass sie überhaupt ein Dach überm Kopf kriegten, alldieweil der Platz ohnehin schon reichlich knapp wär’ und noch knapper würd’, wenn erst der Herr vom Diemerstein eintreffen tät’ und mit ihm seine Knechte kämen.«
»Wenn ich auch nur noch ein einziges unzufriedenes Wort darüber höre, bringe ich sie allesamt in der Schlafkammer ihrer Herrschaft unter! Wollen doch mal hören, ob das ihrem edlen Herrn dann mehr behagt«, schnappte der Burggraf erzürnt. »Jetzt lass mich mit den Knechten zufrieden und bring mir meinen Nichtsnutz von Schreiber aus der Halle. Ich habe einen Auftrag für ihn.«
»Endlich ist sie eingeschlafen«, flüsterte die Burggräfin und strich ihrer Tochter eine flaumige dunkle Strähne aus der Stirn.
»Das glaube ich erst, wenn sie in der Wiege liegt und immer noch still ist«, brummte ihr Gatte verhalten.
Seit Sonnenuntergang hatte Matthäa das augenscheinlich schlafende Kind schon ein halbes Dutzend Mal in die Wiege gelegt. Und jedes Mal hatte die Kleine mit anhaltendem Wehgeschrei dagegen protestiert. Inzwischen hatte Bandolf die Glockenschläge zur Komplet gezählt und war nahe daran, sich andernorts eine Bleibe für die Nacht zu suchen.
Mit scheelem Blick beobachtete er, wie Matthäa seine Tochter behutsam in die Wiege legte und dann darübergebeugt verharrte.
Unwillkürlich hielt er den Atem an.
Augenblicke verstrichen, während in der Schlafkammer nur noch der Regen zu hören war, der seit geraumer Zeit gegen den Fensterverschlag prasselte.
Schließlich seufzte sein Weib erleichtert auf. »Sie schläft«, hauchte sie.
›Hoffentlich‹, dachte Bandolf, gähnte und ließ sich tiefer in die Felle gleiten. Mit halbgeschlossenen Lidern sah er zu, wie seine Gattin die Zöpfe löste, die sie über ihren Ohren zu Schnecken aufgerollt hatte. Sie schüttelte den Kopf. Eine Pracht rotblonder Locken floss über ihren Rücken.
»Filiberta hat mir erzählt, dass Garsende hier gewesen ist und mit Euch gesprochen hat. Was wollte sie denn von Euch?«, fragte sie, während sie die Schlaufen ihres Gewandes aufnestelte.
Für einen kurzen Moment erwog er, seinem Weib von den Schwierigkeiten der Heilerin zu erzählen, entschied sich dann jedoch anders. Jeder andere Zeitpunkt würde wahrlich besser sein als jetzt, da sie ihr Gewand abstreifte und ihr nackter Leib seine Begehrlichkeit weckte.
»Nichts im Besonderen«, schwindelte er. »Sie hat sich nur nach dem Befinden des Kükens erkundigt.«
»Lavinia! Sie heißt Lavinia«, raunte Matthäa ungehalten. »Ihr musstet Eurer Tochter doch unbedingt diesen heidnischen Namen geben. Dann nennt sie nun auch so!«
Bandolf unterdrückte ein Seufzen. Noch immer hatte Matthäa ihm nicht verziehen, dass er seine Tochter weder Notburga nach seiner Mutter noch Katharina nach der ihren hatte nennen wollen. Als er ihr mitgeteilt hatte, er würde das Kind auf den Namen Lavinia taufen lassen, war sie entsetzt gewesen und hatte ihm zwei Wochen lang die kalte Schulter gezeigt, obwohl er ihr versichert hatte, dass an dem Namen nichts auszusetzen wäre. Lavinia sei eine Königstochter gewesen, die mit Äneas vermählt worden war, einem großen Helden.
»Zweifellos ein großer heidnischer Held«, hatte sie kühl erwidert und spitz gefragt, ob er gedächte, seine Tochter dereinst mit einem Heiden zu vermählen.
Erst zwei Tage vor seiner Abreise nach Sachsen hatte Matthäa nachgegeben. »Wenn Euer Herz daran hängt, dann nennt sie denn meinethalben Lavinia. Doch ich bitte Euch, lasst mich dafür die Paten wählen.«
Erleichtert hatte Bandolf zugestimmt. Dass sein Weib dann ausgerechnet Grimbald vom Diemerstein zum Paten benennen würde, auf den Gedanken wäre er in hundert Jahren nicht verfallen. »Was, zum Henker, denkt Ihr, wird so ein Eigenbrötler wie mein Onkel mit einem Mädchen anfangen? Glaubt mir, der alte Kauz wird rundweg ablehnen«, hatte Bandolf prophezeit.
Zu seiner grenzenlosen Überraschung hatte der alte Kauz jedoch zugestimmt.
Matthäas Haar kitzelte auf Bandolfs Brust, als sie nahe an ihn heranrückte, und ihr Lächeln ließ jeden anderen Gedanken verblassen. »Löscht das Licht«, raunte er.
Kaum hatte er in der Dunkelheit die Lippen seines Weibs gefunden, ertönte ein leiser Jammerlaut, dem ein Lidschlag später das wohlbekannte Wehgeschrei folgte.
»Verdammnis!«, fluchte Bandolf laut, als Matthäa sich ihm seufzend entzog.